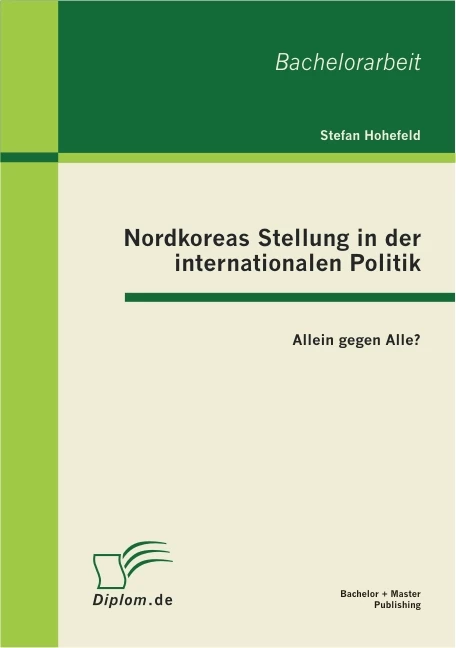Nordkoreas Stellung in der internationalen Politik: Allein gegen Alle?
©2009
Bachelorarbeit
70 Seiten
Zusammenfassung
Die Bachelorarbeit beschäftigt sich mit der Isolation Nordkoreas und den daraus resultierenden Problemen und Folgen. Das Hauptaugenmerk dieser Arbeit liegt auf der Beantwortung der Frage: Warum und inwiefern ist Nordkorea eine isolierte Nation?
Den theoretischen Rahmen der Arbeit bilden die Realistische und Institutionalistische Schule. Mit empirisch-analytischen Methoden sowie mithilfe der Theorien werden Ursachen gesucht, die maßgeblich für die nordkoreanische Abschottung sind. Das Kapitel "Der Weg in die Isolation - Ein kurzer historischer Überblick von 1866 bis zum Koreakrieg" bildet den Übergang zum Hauptteil. Dieser gliedert sich dabei in zwei Abschnitte, in denen zum einen die selbst gewählte Isolation Nordkoreas analysiert wird und zum anderen Gründe aufgezeigt werden, warum und inwiefern das Ausland Nordkorea isoliert. Dabei werden die unterschiedlichen Außenpolitikstile der beteiligten Nationen untersucht und erklärt, inwiefern realpolitische Ansätze wie die Machterhaltungsstrategie des nordkoreanischen Regimes und kooperative Ansätze wie Hilfsleistungen und Gesprächsrunden im Verhältnis zu Nordkorea eine Rolle spielen. Schließlich werden Möglichkeiten aufgezeigt, wie im Rahmen einer "Sozialisierung" der Außenpolitik die Isolation Nordkoreas überwunden werden kann, um eine Normalisierung der politischen Verhältnisse im ostasiatischen Raum herzustellen.
Den theoretischen Rahmen der Arbeit bilden die Realistische und Institutionalistische Schule. Mit empirisch-analytischen Methoden sowie mithilfe der Theorien werden Ursachen gesucht, die maßgeblich für die nordkoreanische Abschottung sind. Das Kapitel "Der Weg in die Isolation - Ein kurzer historischer Überblick von 1866 bis zum Koreakrieg" bildet den Übergang zum Hauptteil. Dieser gliedert sich dabei in zwei Abschnitte, in denen zum einen die selbst gewählte Isolation Nordkoreas analysiert wird und zum anderen Gründe aufgezeigt werden, warum und inwiefern das Ausland Nordkorea isoliert. Dabei werden die unterschiedlichen Außenpolitikstile der beteiligten Nationen untersucht und erklärt, inwiefern realpolitische Ansätze wie die Machterhaltungsstrategie des nordkoreanischen Regimes und kooperative Ansätze wie Hilfsleistungen und Gesprächsrunden im Verhältnis zu Nordkorea eine Rolle spielen. Schließlich werden Möglichkeiten aufgezeigt, wie im Rahmen einer "Sozialisierung" der Außenpolitik die Isolation Nordkoreas überwunden werden kann, um eine Normalisierung der politischen Verhältnisse im ostasiatischen Raum herzustellen.
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
1
1. Einleitung
Nach dem ersten erfolgreichen Atombombentest am neunten Oktober 2006 zündete die Armee der
Demokratischen Volksrepublik Korea (Nordkorea, DVRK) am 25. Mai 2009 erneut eine Atombom-
be zu Testzwecken und sorgte damit für Aufruhe im asiatischen Raum und bei der Staatengemein-
schaft.
1
In der internationalen Presse werden überwiegend negative Meldungen über Nordkorea und
dessen Regime verbreitet. Die DVRK wird dort als ein isoliertes Land beschrieben, dass sich bisher
aus den Netzwerken der Globalisierung herausgehalten hat und dessen Regierung unter Missachtung
der Menschenrechte, die eigene Bevölkerung unterdrückt, Hungersnöte zu verantworten hat und mit
ihrem ,,verrückten Diktator" und dessen ,,irrationalen Entscheidungen" die Welt in Angst und
Schrecken versetzt oder zumindest verunsichert.
2
Trotz zahlreicher Gesprächs- und Verhandlungs-
runden, über Jahrzehnte hinweg, insbesondere mit den USA und Südkorea konnte bisher keine An-
näherung zu Nordkorea erreicht werden. Lediglich zu China scheint die DVRK zurzeit bilaterale
Beziehungen und Vertrauen aufbauen zu wollen. Eine Wiedervereinigung mit dem Nachbarstaat
Südkorea scheint in der gegenwärtigen politischen Lage als utopisch.
Trotz einer katastrophalen, wirtschaftlichen Situation überlebte das nordkoreanische Regime sogar
den Niedergang und Zerfall des Realsozialismus der sogenannten Ostblockstaaten. Die Hauptursa-
chen für das Überleben des Regimes und die Aufrechterhaltung der kommunistischen Staatsordnung
werden darin gesehen, dass sich Nordkorea vollständig vom Ausland isoliert hat und unter anderem
ein riesiger Propagandaapparat für die Machterhaltung der politischen Führung sorgt.
Die Leitfrage, mit der sich diese Arbeit beschäftigt, lautet nun:
Warum und inwiefern ist die Demokratische Volksrepublik Korea eine isolierte Nation?
Das Hauptaugenmerk richtet sich dabei auf die Analyse, warum Nordkorea eine selbst gewählte
Isolation anstrebt und warum und inwiefern andere Nationen versuchen Nordkorea zu isolieren. Der
Begriff der Isolationspolitik wird in dieser Arbeit mit einer negativen Konnotation benutzt.
3
Denn
auf der einen Seite führt eine selbst gewählte Isolation einer Nation immer zu einer Beschränkung
der Freiheitsrechte der betroffenen Bevölkerung. Auf der anderen Seite führt der Versuch eine
1
Siehe Anhang: Chronik: Der Atomstreit mit Nordkorea.
2
Vgl. Pressemitteilungen: Nass, Matthias: Die feudale Atommacht, Juni 2009; Fackler, Martin/ Choe Sang-Hun: Will
Sanctions Ever Work on North Korea? in: The New York Times, Juni, 2009; Bork, Hendrik: Nordkoreas Diktator
Das Leid der Bevölkerung ist ihm egal, Okt. 2006.
3
Vgl. zum Begriff: Isolationismus, Schubert, Klaus/ Klein, Martina: Das Politiklexikon, 4. Auflage, Bundeszentrale
für politische Bildung, Bonn, 2004.
Einleitung
2
Nation von außen zu isolieren automatisch zu Machtkonflikten, die zu internationalen Krisen führen
können. Die Mittel die Staaten dazu wählen ein anderes Land zu isolieren liegen hauptsächlich im
wirtschaftlichen (Wirtschafts- und Handelsembargo) und militärischen (Waffenembargo) Sektor, im
schlimmsten Falle aber auch im Abbruch der diplomatischen Beziehungen.
Die Gliederung der Arbeit gestaltet sich wie folgt: Der einleitende Teil besteht aus den Kapiteln
,,Einleitung", ,,Analyse- und Arbeitsverfahren" sowie ,,Theorien der internationalen Beziehungen",
die einen inhaltlichen, methodischen und theoretischen Überblick auf die Arbeit geben. Den Über-
gang zum Hauptteil bildet das Kapitel ,,Der Weg in die Isolation Ein kurzer historischer Überblick
von 1866 bis zum Koreakrieg". Der Hauptteil ist in zwei Abschnitte eingeteilt. In Kapitel fünf ,,Ist
Nordkoreas Isolation ein hausgemachtes Problem" wird zunächst die selbstgewählte Isolation Nord-
koreas analysiert, während das Kapitel sechs ,,Warum und inwiefern ist Nordkorea von den Nach-
barstaaten isoliert?" die internationalen Beziehungen Nordkoreas beschreibt und mögliche Ursachen
für die Isolation vom Ausland erläutert. Das Ergebnis wird zusammenfassend im Schlusskapitel
vorgestellt.
Die Relevanz des Themas ist in sofern von Bedeutung, dass Nordkorea durch den jüngsten Atom-
bombentest nicht nur für eine Bedrohungslage im asiatischen Raum sorgt, sondern auch eine Ge-
fahr für Europa oder die Bundesrepublik Deutschland darstellen könnte. Zwar besteht keine direkte
militärische Bedrohung, aber dennoch die latente Gefahr der Proliferation und somit die Möglich-
keit für Terroristen oder den sogenannten ,,Schurkenstaaten" Massenvernichtungswaffen zu erlan-
gen.
4
Weiterhin besteht zwischen Korea und Deutschland eine Art Schicksalsgemeinschaft, denn
beide Nationen wurden nach dem zweiten Weltkrieg geteilt. In Deutschland gelang jedoch die
Wiedervereinigung, wohingegen in Korea nach wie vor zwei getrennte Staaten bestehen.
5
Die
möglichen Ursachen für das Scheitern einer Wiedervereinigung zwischen Nord- und Südkorea
werden zu einem späteren Zeitpunkt in dem Kapitel ,,Ein gemeinsames Volk, zwei Staaten und die
gescheiterte Sonnenscheinpolitik Beziehungen zu Südkorea" untersucht. Zunächst werden je-
doch im nächsten Kapitel die Analyse- und Arbeitsverfahren dieser Arbeit vorgestellt.
4
Wulf, Herbert: Poker um Nordkoreas Atomprogramm, aus: Politik und Zeitgeschichte, Nr.48, Bonn, 2005.
5
Ahn, Bong-Rock: Die Wiedervereinigungsfrage Koreas unter der Berücksichtigung der deutschen Erfahrungen, Dis-
sertation, Berlin, 2005.
Analyse- und Arbeitsverfahren
3
2.
Analyse- und Arbeitsverfahren
Die größte Schwierigkeit bei der Bearbeitung dieses Themas lag in der Informationsbeschaffung
über Nordkorea. Denn die DVRK ist ein stark isolierter Staat, der sich von internationalen Informa-
tionsprozessen abkapselt und dessen Entscheidungsprozesse häufig nicht nachvollziehbar sind, da
sie hinter verschlossenen Türen stattfinden. Statistiken über das Land sind nur spärlich bis gar nicht
vorhanden und beruhen daher häufig auf Schätzungen.
6
Eine direkte Berichterstattung von ausländi-
schen Journalisten aus Nordkorea ist nicht möglich. Ausländern wird nur selten eine Einreise er-
laubt. Wenn doch die Möglichkeit besteht in die DVRK einzureisen, werden die Besucher rund um
die Uhr bewacht und dürfen nur ausgewählte Plätze besichtigen. Diese Isolation hat ein Informati-
onsdefizit zur Folge, weshalb viele Autoren über die Schwierigkeit berichten, verlässliche Informa-
tionen über Nordkorea zu erlangen.
7
Dementsprechend rar sind daher politikwissenschaftliche Lite-
ratur, Dokumente oder Quellen aus und über Nordkorea. Ziel ist es aus der ausgewählten Literatur
Informationen zu erhalten, die die tatsächlichen Lebensbedingungen und das politische System
Nordkoreas beschreiben, um ungerechtfertigte Verallgemeinerungen, Gerüchte und subjektive, ver-
zerrte Eindrücke auszuklammern.
8
Zur Klärung des politikwissenschaftlichen Problems beziehungsweise der Fragestellung dieser Ar-
beit (Warum und inwiefern ist die Demokratische Volksrepublik Korea eine isolierte Nation?) wer-
den hauptsächlich empirisch-analytische Methoden verwendet.
9
Sie haben ihre Wurzel in der Frühen
Neuzeit und sind eng mit der Entwicklung der Naturwissenschaften verbunden. Im Bereich der So-
zialwissenschaften, die damals noch eine Untergliederung der Philosophie waren, gehören zu den
Vertretern des empirisch-analytischen Wissenschaftsverständnis Namen wie Niccolò Machiavelli
(1469-1527), Thomas Hobbes (1588-1679), John Locke (1632-1704), Auguste Conte (1798-1857),
6
Statistisches Bundesamt: Nordkorea, Informationen aus internationalen Datenquellen, Wiesbaden, 2009.
7
Allgemeine Informationen über Nordkoreas Geschichte, Politik, Kultur und Wirtschaft: Maull, Hanns W./ Maull, Ivo
M.: Im Brennpunkt: Korea, München, März 2004.
8
Die Suche nach geeigneter Literatur zu dem Thema begann zunächst im privaten Bereich mit dem Sammeln von
verschiedenen Tages- und Wochenzeitungen beziehungsweise Zeitschriften. Die Hauptsuche nach geeigneter Literatur
beschränkte sich jedoch auf das Internet. Material in ausreichenden Mengen war unter den Schlagwörtern ,,Korea",
,,Nordkorea", ,,Sonnenscheinpolitik", ,,Juche" und ,,Koreakrieg" bei den Suchmaschinen google.com und yahoo.com
zu finden. Nach einer Vorauswahl wurden die geeigneten Titel gezielt über die ,,digiBib" der Universität Dortmund
gesucht, um diese dann direkt in der Universitätsbibliothek Dortmund zu sichten und gegebenenfalls auszuleihen.
9
Vgl. zum empirisch-analytischen Ansatz: Lenk, Kurt: Methoden der politischen Theorie, in Lieber, Hans-Joachim
(Hrsg.): Politische Theorien von der Antike bis zur Gegenwart, Bonn, 1991, S. 1001-1006, sowie
Alemann, Ulrich von/ Forndran, Erhard: Methodik der Politikwissenschaft. Eine Einführung in Arbeitstechniken und
Forschungspraxis, 4. Auflage, Stuttgart, 1990, S. 50-53.
Analyse- und Arbeitsverfahren
4
Max Weber (1864-1920) und Karl R. Popper (1902-1994). Der empirisch-analytische Ansatz hat
zum Ziel, die Realität wertfrei zu beschreiben, zu erklären und hinsichtlich der zukünftigen Entwick-
lung Prognosen abzugeben.
10
Weiterhin wird der Wahrheitsbegriff von der greifbaren und überprüf-
baren Realität abhängig gemacht, wonach empirische Sätze nur dann wahr sind, wenn sie mit der
Realität korrespondieren. Nach Popper kann es dabei keine Wahrheiten geben, sondern nur eine An-
näherung durch die Falsifikation von Thesen.
11
Mit einer Sinn verstehenden, interpretierbaren und
wissenschaftlichen Verfahrensweise wird der Inhalt des erhobenen Sekundärmaterials (Dokumente,
Texte und Berichte von verschiedenen Autoren und Politkern mit nachprüfbaren und vollständigen
Quellenangaben) analysiert, um dann mithilfe hermeneutischer Methoden die politikwissenschaftli-
che Problemfrage zu beantworten.
Aus dieser Auswahl von Literatur und Quellen werden die politischen Hintergründe beschrieben, die
für die Isolation Nordkoreas ursächlich sind, um dann herauszufinden warum und inwiefern eine
Isolation gegeben ist. In einem weiteren Schritt werden Auswege und Lösungen gesucht, die eine
Isolation beenden könnten. Anlehnend an die Konkordanzmethode wird die selbst gewählte Isolati-
on Nordkoreas mit der Isolationspolitik, der mit den USA verbündeten Nachbarstaaten untersucht
und analysiert. Weiterhin wird die Machtpolitik der untersuchten Staaten mit möglichen kooperati-
ven Alternativen, die zur Überwindung der Isolation beitragen können, verglichen.
12
Da wie anfangs beschrieben, der nordkoreanischen Regierung eine irrationale Handlungslogik
vorgeworfen wird, bilden komparativ die Theorie des politischen (Neo-)Realismus und des
(Neo-)Institutionalismus, die auf metatheoretischer Ebene beide einer rationalen Handlungslogik
folgen, den theoretischen Rahmen dieser Arbeit. Der politische Realismus dient zur Klärung der
Frage, inwiefern Machterhaltsstreben des nordkoreanischen Regimes und der Kampf um Macht im
internationalen anarchischen System zur Isolation beitragen. Im Gegensatz dazu soll die Theorie
des (Neo-)Institutionalismus dazu verwendet werden, die Möglichkeiten von internationaler Ko-
operation aufzuzeigen, welche zu einer Überwindung der nordkoreanischen Isolation führen
kann.
13
10
Karl Otto Hondrich sieht den Prognoseanspruch des empirisch-analytischen Ansatzes kritisch: ,,Der logische Empi-
rismus (...) gibt damit seine Stringenz als Geisteswissenschaft auf, denn fast alle Spekulationen sind durch eine Reihe
von Bedingungen logisch so formulierbar, dass sie in irgendeiner Zukunft bei Eintritt der Bedingungen empirisch
überprüfbar werden." (Hondrich 1972; S. 132).
11
Popper, Karl: Die offene Gesellschaft und ihre Feinde, 6.Aufl., München, 1980.
12
Vgl. Lauth, Hans-Joachim (Hrsg.): Vergleichende Regierungslehre Eine Einführung, 2. Auflage, Wiesbaden,
2006, S. 15-36.
13
Vgl. Wilhelm, Andreas: Außenpolitik: Grundlagen, Strukturen und Prozesse, München, Juni 2006, S.34ff.
Theorien der internationalen Beziehungen
5
3.
Theorien der internationalen Beziehungen
Die beiden Theorien der internationalen Beziehungen, die in dieser Arbeit verwendet werden, die-
nen in erster Linie als Hilfsmittel zur Verarbeitung der untersuchten Empirie. Dabei können insge-
samt mindestens sechs Hilfsfunktionen einer Theorie unterschieden werden, die sich zum Teil in-
haltlich überschneiden:
14
1.
Die Orientierungsfunktion: Theorien dienen dem Wissenschaftler als Navigationsmittel in
einer zunehmenden Flut von Einzelinformationen.
2.
Die Selektionsfunktion: Theorien schärfen den Fokus für die Auswahl des relevanten empiri-
schen Datenmaterials, mit dem Ziel eine äußerst komplexe Realität auf das Wesentliche zu
reduzieren.
3.
Die Ordnungsfunktion: Die ausgewählten Daten können an Hand zuvor festgelegter Kriterien
geordnet und systematisiert werden.
4.
Die Erklärungsfunktion: Die theoretisch fundierten Kausalbeziehungen können auf das iden-
tifizierte und systematisierte Datenmaterial angewandt werden, um es mit Blick auf Sinnzu-
sammenhänge interpretieren zu können.
5.
Die Zielbeschreibungsfunktion: Theorien können Handlungsempfehlungen für die Politik
formulieren.
6.
Die Handlungslegitimationsfunktion: Theorien können Handlungen von Politikern legitimie-
ren.
Um Kausalbeziehungen zwischen den Ereignissen aufzudecken, mögliche Erklärungen für die
Problemfrage zu finden und Prognosen für vergleichbare Zusammenhänge aufstellen zu können,
werden in dieser Arbeit der (Neo-)Realismus und der (Neo-)Institutionalismus verwendet. Diese
beiden Theorien der internationalen Beziehungen lassen sich auf metatheoretischer Ebene als rati-
onalistische Theorien klassifizieren und werden nun im weiteren Verlauf näher vorgestellt.
15
14
Wagner, Martin: Hegemonialer Wandel in Südostasien? Der Machtpolitische Aufstieg Chinas als sicherheitsstrate-
gische Herausforderung der USA, Dissertation, Trier, 2009, S. 23; vgl. Evera, Stephen van: Guide to methods for
students of political science, Cornell University, 1997, S. 17-21.
15
,,Im Unterschied zu Erfahrungstheorien stellen Metatheorien kein Ergebnis, sondern das Fundament der Wissen-
schaft dar, indem sie deren Erkenntnisprämissen und Leitbilder begründen." (Bürklin; Wetzel 1994, S. 309).
Theorien der internationalen Beziehungen
6
3.1 Realistische
Schule
Der Realismus als Theorie der internationalen Beziehungen löste nach 1945 die optimistische
Sicht auf die Gestaltbarkeit des internationalen Systems ab, welche noch zwischen den beiden
Weltkriegen führend war. Während der normative Idealismus (Kant 1795; Wilson 1917/1918) da-
nach fragte, wie die internationale Politik beschaffen sein sollte (normative Zukunftsorientierung),
analysiert der klassische Realismus die internationale Politik so, wie sie gegenwärtig beschaffen ist
(pragmatische Gegenwartsorientierung).
16
Vertreter des klassischen Realismus (Morgenthau 1963; Carr 1994) gehen von der Prämisse aus,
dass Nationalstaaten alleinige Träger der internationalen Politik sind, die sich keiner übergeordne-
ten Rechtsinstanz unterwerfen müssen. Dementsprechend werden in realistischen Analysen der
internationalen Politik gesellschaftliche Akteure sowie die inneren Unterschiede zwischen ver-
schiedenen Nationalstaaten ausgeblendet. Aus der Sicht Morgenthaus befindet sich die Welt in
einem Zustand der Anarchie, das heißt, es existiert weder eine Zentralmacht noch eine allgemein
akzeptierte, politische Autorität, die die internen Beziehungen zwischen Staaten regeln würden.
17
Da es nach Morgenthau in der Natur des Menschen liegt nach Macht zu streben (,,Krieg aller ge-
gen alle", Hobbes 1651), ist analog dazu die internationale Politik genauso durch das stetige
Machtstreben aller Staaten gekennzeichnet. Die internationale Politik erscheint im realistischen
Verständnis jedoch als Nullsummenspiel:
,,Was der eine Staat an Ressourcen, Territorien, Einfluss, Macht gewinnt, geht stets zu Lasten an-
derer; die Gesamtmenge dieser Elemente im internationalen Staatensystem ist begrenzt und kann
daher nur umverteilt, nicht aber wie im idealistischen Verständnis durch Zuwachs der verteilba-
ren Wirtschafsgüter vergrößert werden."
18
Im Kern ist die internationale Politik also durch Machtbeziehungen gekennzeichnet woraus Mor-
genthau folgert:
16
Zur Dreiteilung der Theorien internationaler Beziehungen in Realismus, Institutionalismus und Idealismus vgl. Ritt-
berger, Volker/ Zangl, Bernhard: Internationale Organisationen Geschichte und Politik, Studienbrief der Fernuniver-
sität Hagen, 1995, S. 37.
17
Vgl. Lemke, Christian: Internationale Beziehungen. Grundkonzepte, Theorien und Problemfelder, München, Juni
2000, S. 20ff.
18
Lehmkuhl 2001, S. 73.
Theorien der internationalen Beziehungen
7
,,Da Machtstreben das Merkmal internationaler Politik wie aller Politik ist, muss internationale
Politik zwangsläufig Machtpolitik sein... Der Kampf um Macht hat universellen Charakter in Zeit
und Raum und stellt eine unwiderlegliche Erfahrungstatsache dar."
19
Da jeder Staat versucht in einem solchermaßen anarchischen Selbsthilfesystem sein eigenes Natio-
nalinteresse (Macht) gegen die übrigen Staaten durchzusetzen, sind Konflikte, die auch zu Kriegen
führen können unausweichlich. Kriege sind daher nur dann zu vermeiden, wenn ein Gleichgewicht
der Mächte besteht, das bedeutet, wenn die Macht eines jeden Staates durch die Macht anderer
Staaten kompensiert werden kann, sodass alle Staaten von Gewaltanwendung absehen (Balance of
Power).
20
Zusammenfassend werden nun die sechs Prinzipien des klassischen Realismus nach
Morgenthau vorgestellt:
21
1.
Der politische Realismus geht davon aus, dass die Politik, so wie die Gesellschaft allgemein,
von objektiven Gesetzen beherrscht wird, deren Ursprung in der menschlichen Natur liegt.
Um die Gesellschaft zu verbessern, muss man vor allem jene Gesetze verstehen, denen sie
gehorcht. Für den Realismus besteht Theorie darin, Tatsachen festzustellen und ihnen durch
Vernunft Sinn zu verleihen.
2.
Das hervorstechendste Wegzeichen, an dem sich der politische Realismus im weiten Gebiet
der internationalen Politik orientieren kann, ist der im Sinne von Macht verstandene Begriff
des Interesses. Dieser Begriff ist das Bindeglied zwischen der Vernunft, die sich bemüht, in-
ternationale Politik zu verstehen, und den zu bewältigenden Tatsachen.
3.
Der Begriff des Interesses definiert als Macht ist nicht zeitlos, sondern immer unter den je-
weiligen politischen Umständen zu verstehen; die Ziele, die Nationen in ihrer Außenpolitik
verfolgen und für deren Umsetzung sie Macht benötigen, können ein ganzes Spektrum von
grausamer Eroberungspolitik bis hin zu aufgeklärter Ordnungspolitik umfassen; auch der
Begriff der Macht ist abhängig von den zeitlichen Umständen.
4.
Der politische Realismus ist sich der moralischen Bedeutung politischen Handelns bewusst,
geht aber davon aus, dass die direkte Verfolgung moralischer Ziele in der Politik eher zum
Gegenteil dessen führt, was man erreichen will; es kommt darauf an, moralische Ziele in der
Politik in realistischer Weise zu verfolgen.
19
Morgenthau 1963; S65
20
Vgl. Cho, Sung Bok: Die Außen- und Sicherheitspolitik der USA seit dem Ende des Ost-West-Konflikts und die
Nuklearpolitik Nordkoreas, Köln, 2007, S. 31-32
21
Vgl. Rohde, Christoph: Hans J. Morgenthau und der weltpolitische Realismus, Wiesbaden, 2004, S. 55-64
Theorien der internationalen Beziehungen
8
5.
Politischer Realismus lehnt es ab, die moralischen Ambitionen in der Außenpolitik einzelner
Länder für bare Münze zu nehmen. Vielmehr kommt es darauf an, die dahinter stehenden In-
teressen eines Staates zu analysieren, erst dann ist zu fragen, ob die Politik dieses Landes tat-
sächlich eine moralisch positive oder negative Folge haben wird.
6.
Im politischen Realismus zählt die Autonomie des Politischen über dem Ökonomischen; dass
heißt, Politik ist der Ökonomie übergeordnet und nicht umgekehrt. Der politische Realismus
versucht die Gesetzmäßigkeit der Politik mit der gleichen methodischen Strenge zu beurtei-
len, wie die Wirtschaftswissenschaften das wirtschaftliche Leben analysieren.
Während der klassische Realismus das Machtstreben der Staaten anthropologisch begründet (Pro-
jektion von der Natur des Menschen auf Nationalstaaten), so geht der Neorealismus (Grieco 1988;
Mearsheimer 2001; Waltz 1979) von einem anarchischen internationalen System aus, welches die
Staaten vor einem Sicherheitsdilemma stellt (struktureller Realismus).
22
Um diesem Dilemma zu
begegnen, müssen die Staaten durch Machtmittel selbst für ihr Fortbestehen im internationalen
System sorgen, da keine übergeordnete Rechtsinstanz das Überleben der Staaten garantieren kann.
Aus neorealistischer Sicht ist eine Kooperation von Staaten kaum möglich, da in einem anarchi-
schen internationalen System der Kooperationspartner schnell zum Widersacher werden kann.
Wenn der Kooperationspartner von heute bereits morgen ein die Sicherheit gefährdender Konkur-
rent sein könnte, müssen Staaten aus Sicht der Neorealismus darauf achten, dass andere Staaten
von einer Kooperation nicht mehr profitieren als sie selbst. Daher kann es nur zu einer Kooperati-
on kommen, wenn einer der Staaten hinsichtlich seiner Machtmittel gegenüber der anderen Staaten
so überlegen ist (Hegemonialmacht), dass er es sich leisten kann, relative Gewinne anderer Staaten
zu tolerieren, um selbst absolute Gewinne erzielen zu können.
23
Um in diesem anarchischen System ,,überleben" zu können gibt es zwei unterschiedliche Konzepte
beziehungsweise theoretische Strömungen in der neorealistischen Theorieschule:
Der offensive Realismus (Mearsheimer 2001) hat die Grundannahme, dass Staaten im
internationalen System vor allem nach Macht streben, verstanden als die Fähigkeit andere Staaten
zu kontrollieren (Hegemonialmachtsstreben). Das Machtstreben impliziert, dass es keine stabilen
Machtgleichgewichte im internationalen System geben kann und alle Staaten versuchen ihre Macht
22
Vgl. zur Einteilung in drei Realismen: Hellmann, Gunther/ Baumann, Rainer/ Wagner, Rainer: Deutsche Außenpoli-
tik - Eine Einführung, Wiesbaden, 2006.
23
Vgl. Mearsheimer, John J.: Reckless States and Realism, University of Chicago, März 2009.
Theorien der internationalen Beziehungen
9
gleichgewichte im internationalen System geben kann und alle Staaten versuchen ihre Macht aus-
zubauen. Die Staaten betreiben demnach eine Überlegenheitspolitik.
24
Vertreter des defensiven Realismus (Waltz 1979) gehen davon aus, dass Staaten im internationalen
System vor allem nach Sicherheit streben, verstanden als Schutz der nationalen Interessen vor ge-
waltsamen Übergriffen. Das Sicherheitsstreben impliziert, dass sich die relative Machtposition
eines Staates im internationalen Umfeld nicht verschlechtern darf. Die Staaten sind demnach dar-
auf bedacht eine Gleichgewichtspolitik zu betreiben.
25
3.2 Institutionalistische
Schule
Der Institutionalismus geht gemeinsam mit der realistischen Theorienschule davon aus, dass Staa-
ten die Hauptakteure in einem internationalen System der Anarchie sind und einer rationalen
Handlungslogik folgen.
26
Beide Theorien beschreiben außerdem die Abwesenheit einer, das Sys-
tem regelnden Instanz, die das System hierarchisch, mit der Möglichkeit bindende Entscheidungen
zu treffen, kontrolliert. Der wesentliche Unterschied zwischen der realistischen und institutionalis-
tischen Schule besteht darin, dass für den Institutionalismus Interdependenz und Regime als wirk-
mächtige Strukturmerkmale des internationalen Systems zur internationalen Anarchie hinzukom-
men. Die wechselseitige Abhängigkeit der Staaten voneinander (Interdependenz) verringert zum
Einen die Nützlichkeit militärischer Gewalt und damit die Bedrohung der Staaten. Zum Anderen
erhöht sie den Bedarf an internationaler Kooperation.
27
Internationale Regime (Regelwerke) und die mit ihnen verknüpften internationalen Organisationen
setzen die Möglichkeit voraus, dass ein Kooperationsbedarf der Staaten befriedigt werden kann,
indem sie die Regeln festlegen, die Regeleinhaltung der Nationen beaufsichtigen und Regelverstö-
ße bei Bedarf sanktionieren. Unter diesen Bedingungen der Interdependenz sind rational handelnde
Staaten demnach eher an internationaler Kooperation und friedlichen Miteinander interessiert. Sie
streben daher nicht in erster Linie nach Machtgewinn, sondern nach absoluten Gewinnen. Daraus
24
Maersheimer, John J.: The Tragedy of Great Power Politics, New York, 2001.
25
Waltz, Kenneth N.: Theory of International Politics, New York, 1979.
26
Vgl. Lemke, Christian: Internationale Beziehungen. Grundkonzepte, Theorien und Problemfelder, München, Juni
2000, S. 13-27.
27
Vgl. Spindler, Manuela: Interdependenz, in: Schieder, Siegfried/ Spindler, Manuela: Theorien der Internationalen
Beziehungen, Stuttgart, Dez. 2006, S. 93-116.
Theorien der internationalen Beziehungen
10
resultiert ein Prozess der Wohlfahrtskonkurrenz. Die gemeinsamen, grenzüberschreitenden Prob-
lemlagen, die durch die Interdependenz hervorgebracht werden und die Kontrollfunktion internati-
onaler Regime können jedoch das Dilemma kollektiven Handelns in der Wohlfahrtskonkurrenz
überwinden, indem sie eine stabile Kooperation gewährleisten.
28
Die konkreten Ergebnisse dieser Kooperationen ermitteln dann die Interessenskonstellationen und
die Verhandlungsmacht der Staaten. Durch diese stabile Kooperation festigt und verstärkt sich
wiederum die Interdependenz und die Institutionalisierung der internationalen Politik und führt
zwar nicht zu einer Abschaffung der internationalen Anarchie, jedoch zu einer ,,Zivilisierung".
29
Die älteren Ansätze der Liberal-Institutionalistischen Schule gliedern sich in mehrere Theorierich-
tungen, die im Folgenden kurz skizziert werden:
Der Föderalismus (C. J. Friedrich 1964; 1968) wird als Prozess verstanden, in dessen Verlauf sich
souveräne Teilstaaten eine gemeinsame Ordnung geben, in der jeder Staat seine Identität weitge-
hend erhalten kann. Das Ziel des Föderalismus ist die Schaffung von supranationalen, gemein-
schaftlichen Strukturen und Institutionen.
30
Der Funktionalismus (Mitrany 1943; 1966) beschreibt wie aus der zunehmenden funktionalen Zu-
sammenarbeit zwischen den Staaten in Interdependenzbeziehungen ein immer dichter werdendes
Netzwerk der Kooperation entstehen kann. Die grundlegende These des Funktionalismus ist:
,,form follows function". Das heißt, die durch die zunehmenden verknüpften Interdependenzbezie-
hungen über Staatsgrenzen hinweg entstehenden Problemlagen ziehen gleichsam automatisch die
Organisationen nach sich, die zu einer erfolgreichen Problembearbeitung notwendig sind.
31
Der Neofunktionalismus (E. B. Haas 1964) betont die Interdependenz von Wirtschaft und Politik,
anstatt die Abhängigkeit der Politik vom technischen Fortschritt und von wirtschaftlichen Erfor-
dernissen. Durch diese Interdependenz wird nach neofunktionalistische Ansicht die Integration in
benachbarte Sektoren begünstigt, was zu einem Spill-Over-Effekt führen kann.
32
28
Schimmelpfennig, Frank: Internationale Politik, Lübeck, Sept. 2008, S. 90.
29
Für den Begriff ,,Zivilisierung" wird im weiteren Verlauf analog der Begriff ,,Sozialisierung" verwendet. Vgl. Keo-
hane, Robert O./ Nye, Joseph S.: Interdependence in World Politics, in: Crane, George T./ Amawi, Abla: The Theo-
retical Evolution of International Political Economy: A Reader, 2. Auflage, Oxford, Feb. 1997, S. 122ff.
30
Rittberger, Volker/ Zangl, Bernhard: Internationale Organisationen Geschichte und Politik, Studienbrief der Fern-
universität Hagen, 1995 , S. 41. Vgl. Friedrich, Carl J: Trends of Federalism in Theorie and Practice, New York, 1968.
31
Ebd. S. 42. Vgl. Mitrany, David: A Working Peace System, Chicago, 1966.
32
Ebd. S. 42. Vgl. Haas, Ernst B.: Beyond the Nation State, Stanford, 1964.
Theorien der internationalen Beziehungen
11
Der Transaktionismus (Deutsch et al. 1957) bekannt auch als Kommunikationstheorie kommt zu
dem Ergebnis, dass eine erfolgreiche Integration entscheidend von der Dichte der politischen, öko-
nomischen und sozialen Transaktionen und Kommunikationsprozesse innerhalb des Integrations-
raumes abhängt.
33
Hierbei ergibt sich dann eine gewisse Automatik der weiteren Integration, in-
dem die Erkenntnisse der Vorteile zu einer weiteren Vernetzung führen:
,,Mutually responsive transactions resulted from a learning process from which shared symbols,
identities, habits of cooperation, memories, values and norms would emerge."
34
Dem Transaktionismus zufolge muss es dabei keine vollständige Vergemeinschaftung aller Berei-
che geben, sondern es kann auch ein Nebeneinander von Staaten mit spezifischen supranationalen
Institutionen dabei entstehen. Entscheidend ist nur, dass ein gewisser Mehrwert vor allem Frie-
den dabei herauskommt.
Die Interdependenzanalyse (Keohane/ Nye 2001) geht wie der Funktionalismus davon aus, dass
sich durch die zunehmende komplexe Interdependenz und grenzüberschreitenden Problemlagen
Kooperationen bilden und internationale Organisationen an Bedeutung gewinnen. Die Bildung der
Organisationen hängt dabei von den jeweils problemfeldspezifischen Machtverhältnissen der Staa-
ten ab.
35
Der heute dominante Neoinstitutionalismus (Keohane 1984; Rittberger 1990) basiert auf vier
Grundannahmen:
1.
In der internationalen Politik sind sowohl Staaten als auch gesellschaftliche Gruppen inner-
halb der Staaten als Akteure von Bedeutung.
2.
Der Neoinstitutionalismus beruht auf der Annahme der Rational-Choice-Theorie.
3.
Interdependente Beziehungen zwischen den Staaten ,,zivilisieren" das anarchische internatio-
nale System.
33
Ebd. S. 43. Vgl. Deutsch, Karl W.: Political Community and the North Atlantik Area: International Organization in
the Light of Historical Experience, New York, 1957.
34
Richardson 2001, S. 53.
35
Rittberger, Volker/ Zangl, Bernhard: Internationale Organisationen Geschichte und Politik, Studienbrief der Fern-
universität Hagen, 1995, S. 43. Vgl. Keohane, Robert O./ Nye, Joseph S.: Power and Interdependence. World Politics
in Transition, 3. Auflage, Boston, 200, S. 3-32.
Theorien der internationalen Beziehungen
12
4.
Transnationale Interdependenzen sorgen für ein gesteigertes Kooperationsinteresse der Ak-
teure, was zur Entstehung internationaler Institutionen führt. Die Institutionen entwickeln ei-
ne Eigendynamik, durch die sie das Verhalten der Staaten teilweise sogar über ihren Reg-
lungsgehalt hinaus beeinflussen.
36
Die zentrale Hypothese des Neoinstitutionalismus ist daher, dass die internationale Politik geprägt
wird durch Regeln und Normen, die in internationalen Institutionen verankert sind. Der Neoinstitu-
tionalismus untersucht dabei, unter welchen Umständen internationale Institutionen gebildet wer-
den und wie sie auf die internationale- und die Innenpolitik der beteiligten Nationen wirken. Dabei
unterscheidet Keohane klar zwischen Konventionen, Regime und Institutionen als unterschiedliche
Stufen der Integration in übergreifende Systeme.
37
36
Ebd. S. 43-46.
37
Vgl. Keohane 1984.
Der Weg in die Isolation
13
4.
Der Weg in die Isolation Ein kurzer Historischer Überblick von
1866 bis zum Koreakrieg
Im Jahre 1866 kam es zum ersten Aufeinandertreffen zwischen den USA und dem Königreich Ko-
rea. Das Handelsschiff USS General Sherman gelang über den Taedong-Fluss nach Korea, um dort
unter amerikanischer Flagge Verhandlungen über die Öffnung des hermetisch abgeschotteten Lan-
des aufzunehmen.
38
Dieses Unterfangen war allerdings zum Scheitern verurteilt, denn Korea stand
seit 1627 unter der Vorherrschaft der chinesischen Mandschu-Dynastie und war fortan dem Tribut-
system des Reichs der Mitte unterworfen. Mit Ausnahme von dem Kaiserreich China schottete
sich Korea im 17. 19. Jahrhundert komplett von der Außenwelt ab. Alle Grenzen und Häfen
wurden geschlossen und jeglicher Kontakt zum Ausland abgebrochen. Missionare, die über China
nach Korea gelangten, um den christlichen Glauben zu verbreiten, wurden gewaltsam verfolgt und
der christliche Glaube nicht toleriert.
39
So war es auch nicht verwunderlich, als Taewongun Vater des koreanischen Kindskönigs Gojong
im Jahre 1866 entschied, die USS General Sherman habe das Land umgehend zu verlassen. Nach
dieser Absage entführte die amerikanische Schiffsbesatzung jedoch den Gouverneur von Pjöng-
jang, um Verhandlungen mit der koreanischen Regierung zu erpressen. Diese Geiselnahme hatte
allerdings einen koreanischen Angriff auf das Schiff zur Folge, in dessen Verlauf das Handels-
schiff versenkt und die gesamte Besatzung getötet wurde. Als Symbol seiner Entschlossenheit lies
Taewongun darauf in allen Teilen des koreanischen Reichs Steintafeln mit folgender Inschrift auf-
stellen:
,,Nicht zurückschlagen, wenn die westlichen Barbaren einfallen, bedeutet, weitere Angriffe zu pro-
vozieren. Durch Friedensverhandlungen das Land zu verkaufen, ist die größte Gefahr, gegen die
man wachsam sein muss."
40
Zum ersten militärischen Kontakt mit den Vereinigten Staaten kam es schließlich am zehnten Juni
1871, in Korea bekannt als der Shinmiyangyo.
41
Mit der Entsendung von Kriegsschiffen in die
38
Bleiker, Roland: Divided Korea: Toward a culture of Reconciliation, University of Minnesota Press,
März 2005, S. 7.
39
Die allgemeine Bezeichnung für das Korea der damaligen Zeit lautete: ,,The Hermit Kingdom" (,,Abgeschottetes
Königreich"). Kranewitter, Rudolf: Dynamik der Religion: Schamanismus, Konfuzianismus, Buddhismus und Chris-
tentum in der Geschichte Koreas von der steinzeitlichen Besiedlung des Landes bis zum Ende des 20. Jahrhunderts,
Münster, Jan. 2005.
40
Kranewitter 2005, S. 324.
Der Weg in die Isolation
14
Region der Insel Ganghwa, wollten die Vereinigten Staaten dem Königreich Korea ihre Handels-
beziehungen aufzwingen, was aber letztendlich nicht glückte. Erst Japan gelang es 1876 durch den
Vertrag von Ganghwa, dass Korea die Handelshäfen an der Küste für japanische Schiffe öffnete.
Im Mai 1882 unterschrieben schließlich auch Korea und die Vereinigten Staaten ein Friedens- und
Handelsabkommen, womit die Isolation Koreas nun endgültig aufgehoben wurde.
Durch den erweiterten Handel insbesondere mit Japan kam es infolge dessen zu machtpolitischen
Spannungen zwischen Peking und Tokio, die 1894 in einem Krieg endeten, den Japan für sich ent-
scheiden konnte. Im Friedensvertrag von Shimoneseki im Jahre 1895 erkannte China nun die Un-
abhängigkeit Koreas an und gab seine Tributansprüche auf. Als sich Korea daraufhin stärker an
Moskau anlehnte und Russland sich gleichsam verstärkt um Hegemonie über die koreanische
Halbinsel bemühte, kam es erneut zu Konflikten mit Japan, die 1904/1905 zum Russisch-
Japanischen Krieg führten. Japan siegte wieder und nach dem Frieden von Portsmouth stand Ko-
rea nun direkt unter der Einflusssphäre Japans. Am 22. August 1910 verlor Korea schließlich sei-
ne Souveränität und wurde vollständig in das japanische Kaiserreich annektiert.
42
Zu einer Veränderung der so zementierten Machtverhältnisse kam es erst nach dem Zweiten Welt-
krieg. Nach Japans Niederlage wurde das annektierte Korea am 38. Breitengrad geteilt. Im Norden
errichtete die Sowjetunion ein kommunistisches Regime mit Kim Il-sung an der Spitze. Im Süden
rief der von den USA unterstütze Syng-man Rhee am 15. August 1948 in der Hauptstadt Seoul die
Republik aus. Die Vereinigten Staaten spielten auch im folgenden Koreakrieg eine wichtige Rolle.
Nordkoreanische Truppenverbände hatten am 25. Juni 1950 die Republik Südkorea überfallen und
in wenigen Wochen circa 90 Prozent des Südens erobert. Unter UN-Flagge griffen die USA dar-
aufhin am 15. September 1950 mit einer groß angelegten Landungsoperation bei Inchon in das
Kriegsgeschehen ein. Es kam zu einem mehrfachen Wechsel der Kräftebalance, die seit Oktober
1950 auch von chinesischen Truppen beeinflusst wurde, die den Norden Koreas unterstützten.
Schließlich einigten sich die Kriegsparteien am 27. Juli 1953 auf einen Waffenstillstand, der die
Demarkationslinie am 38. Breitengrad bestätigte. Die Demarkationslinie trennt bis heute das
kommunistische Nordkorea von der Republik Südkorea.
43
41
Vgl. Kim, Jang-Soo: Korea und der ,,Westen" von 1860 bis 1900, Frankfurt/ New York, 1986 S. 13ff.
42
Vgl. Maull, Hanns W.: Die Außenpolitik Japans, in: Knapp, Manfred/ Krell, Gerd: Einführung in die Internationale
Politik, München, 2004, S. 314-315.
43
Vgl. Bleiker, Roland: Divided Korea: Toward a culture of Reconciliation, University of Minnesota Press, März
2005, S. 8-10 und Kantowicz, Edward R.: The World in the 20
th
Century (Vol. 2) - Coming Apart, Coming Together,
William B. Eerdman Co (Verlag), Dez.1999, S. 130-141.
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Erstausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2009
- ISBN (Paperback)
- 9783863410131
- ISBN (PDF)
- 9783863415136
- Dateigröße
- 333 KB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- FernUniversität Hagen
- Erscheinungsdatum
- 2015 (Februar)
- Note
- 2,1
- Schlagworte
- Nordkorea internationale Politik Asien internationale Beziehungen Realismus Isolation
- Produktsicherheit
- BACHELOR + MASTER Publishing