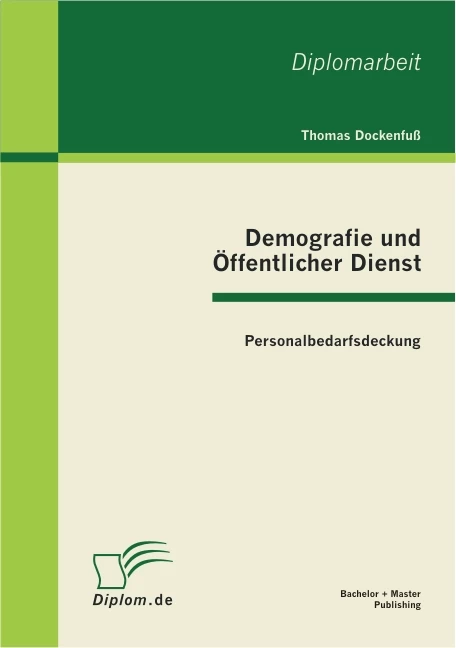Demografie und Öffentlicher Dienst: Personalbedarfsdeckung
©2010
Diplomarbeit
57 Seiten
Zusammenfassung
Die Demografie hat sich in den vergangenen Jahren zu einem bedeutendem Instrument und Index in der Arbeitswelt entwickelt. Waren die hieraus gewonnenen Werte in der Vergangenheit zwar nicht unbedeutend, so hat sich ihr Stellenwert doch grundlegend verändert. Den Angaben zur Demografie, in Deutschland herausgegeben vom Statistischen Bundesamt, wird nun ein erhöhtes Augenmerk geschenkt.
Der Demografische Wandel bietet den Beteiligten auf dem Arbeitsmarkt auch Chancen. Die Arbeitgeber werden sich einer Überprüfung und Optimierung ihrer bisherigen Maßnahmen zur Personalbeschaffung nicht verschließen können. Für qualifizierte Arbeitnehmer kämen evtl. entsprechende gute Perspektiven für den beruflichen Werdegang in Frage. Denkbar ist, dass sie künftig bessere Verhandlungsoptionen im Vergleich zu Ihren Arbeitgebern des ö. D. aufweisen können, da auch die Privatwirtschaft geeignetes Personal benötigt. Die Veränderung weg von einem Arbeitgebermarkt hin zu einem Arbeitnehmermarkt wird eine Konsequenz des Wandels sein. In dieser Studie wird schwerpunktmäßig die Personalbedarfsdeckung für die Landesverwaltung in Niedersachsen behandelt. Wenn weniger qualifizierte Kandidaten auf dem Arbeitsmarkt verfügbar sind, wird es auch für die Verwaltung im ö. D. darauf ankommen, wie sich ein auftretender Personalbedarf decken lassen kann. Die Arbeitgeber im öffentlichen Dienst werden in den kommenden Jahrzehnten in einem noch engeren Konkurrenzverhältnis zu den Unternehmen der freien Wirtschaft stehen, wenn es um die Gewinnung von geeigneten Mitarbeitern geht. Beide Seiten werden mittels der zur Verfügung stehenden Möglichkeiten versuchen sich entsprechend positiv als Arbeitgeber zu positionieren. Der ö. D. kann sicherlich noch von einigen Maßnahmen, die derzeit eher in der freien Wirtschaft verbreitet sind, profitieren. Hierzu sind das Employer Branding, verstärktes Hochschulmarketing oder ein gezieltes Headhunting nennenswert.
In Teilen dieser Arbeit fließen neben der allgemeinen Informationsbeschaffung aus diversen Quellen aus der Literatur und Gesetzen auch Kenntnisse und Erfahrungen des Autors ein.
Thomas Dockenfuß zeigt mögliche Instrumente für eine künftige Personalbedarfsdeckung auf.
Der Demografische Wandel bietet den Beteiligten auf dem Arbeitsmarkt auch Chancen. Die Arbeitgeber werden sich einer Überprüfung und Optimierung ihrer bisherigen Maßnahmen zur Personalbeschaffung nicht verschließen können. Für qualifizierte Arbeitnehmer kämen evtl. entsprechende gute Perspektiven für den beruflichen Werdegang in Frage. Denkbar ist, dass sie künftig bessere Verhandlungsoptionen im Vergleich zu Ihren Arbeitgebern des ö. D. aufweisen können, da auch die Privatwirtschaft geeignetes Personal benötigt. Die Veränderung weg von einem Arbeitgebermarkt hin zu einem Arbeitnehmermarkt wird eine Konsequenz des Wandels sein. In dieser Studie wird schwerpunktmäßig die Personalbedarfsdeckung für die Landesverwaltung in Niedersachsen behandelt. Wenn weniger qualifizierte Kandidaten auf dem Arbeitsmarkt verfügbar sind, wird es auch für die Verwaltung im ö. D. darauf ankommen, wie sich ein auftretender Personalbedarf decken lassen kann. Die Arbeitgeber im öffentlichen Dienst werden in den kommenden Jahrzehnten in einem noch engeren Konkurrenzverhältnis zu den Unternehmen der freien Wirtschaft stehen, wenn es um die Gewinnung von geeigneten Mitarbeitern geht. Beide Seiten werden mittels der zur Verfügung stehenden Möglichkeiten versuchen sich entsprechend positiv als Arbeitgeber zu positionieren. Der ö. D. kann sicherlich noch von einigen Maßnahmen, die derzeit eher in der freien Wirtschaft verbreitet sind, profitieren. Hierzu sind das Employer Branding, verstärktes Hochschulmarketing oder ein gezieltes Headhunting nennenswert.
In Teilen dieser Arbeit fließen neben der allgemeinen Informationsbeschaffung aus diversen Quellen aus der Literatur und Gesetzen auch Kenntnisse und Erfahrungen des Autors ein.
Thomas Dockenfuß zeigt mögliche Instrumente für eine künftige Personalbedarfsdeckung auf.
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Abb. 1 - Statistisches Bundesamt, Bevölkerungspyramiden in Deutschland
1970 - 2010 - 2030 (2009)
Seite 5
Abb. 2 - Statistisches Bundesamt, Demografische Entwicklung (2009)
Seite 6
Abb. 3 - Entwicklung der Geburtenraten in Deutschland
Seite 7
Abb. 4 - Altersstruktur im LZN
Seite 9
Abb. 5 - Niedersachsen - Karte
http://cdl.niedersachsen.de/blob/images/C1456162_L20.jpg Seite
11
Abb. 6 - Aufbau der unmittelbaren Landesverwaltung
http://www.mi.niedersachsen.de/cda/pages/printpage.jsp?C
=8008136&N=13789&L=20&D=0&1=522 Seite
12
Abb. 7 - Aufbau der mittelbaren Landesverwaltung
http://www.mi.niedersachsen.de/cda/pages/printpage.jsp?C
=8008136&N=13789&L=20&D=0&1=522 Seite
12
Abb. 8 - Laufbahnen-Gegenüberstellung, vom Autor erstellt
Seite 14
Abb. 9 - STEP 4, Grafische Darstellung, vom Autor erstellt
Seite 24
1
1.
Einleitung
,,Zukunft - das ist die Zeit, in der du bereust,
dass du das, was du heute tun konntest, nicht getan hast!"
(Verfasser unbekannt)
Die Demografie hat sich in den vergangenen Jahren zu einem bedeutendem Instrument
und Index in der Arbeitswelt entwickelt. Waren die hieraus gewonnenen Werte in der
Vergangenheit zwar nicht unbedeutend, so hat sich ihr Stellenwert doch grundlegend
verändert. Den Angaben zur Demografie, in Deutschland herausgegeben vom Statist-
ischen Bundesamt, wird nun ein erhöhtes Augenmerk geschenkt.
Die Entwicklungen der Altersstrukturen in der Bundesrepublik geben Anlass zur Sorge,
in wie weit die Strukturen der Arbeitswelt in Deutschland, besonders im Hinblick auf
die Personalbedarfsdeckung, den kommenden Anforderungen gewachsen sein werden.
Als Folge der geburtenschwachen Jahrgänge wird sich das Verhältnis von Erwerbstäti-
gen zu Nichterwerbstätigen zu Gunsten der Nichterwerbstätigen verschieben. Mit der
Konsequenz eines zu erwartenden Fachkräftemangels. Als zweite Ursache, welcher eine
große Bedeutung im Hinblick auf den steigenden Anteil der älteren Bevölkerung bei-
gemessen wird, lässt sich der fortwährende Anstieg der Lebenserwartung nennen
1
.
Nach Angaben der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder kommen in der
Bundesrepublik im Jahr 2030 auf 100 Personen im erwerbstätigen Alter (20 - 65 Jahre)
bereits 50 Personen im Rentenalter (ab 65 Jahren)
2
. Diese Zahlen belegen deutlich, dass
in den nächsten Jahren Maßnahmen getroffen werden müssen, um für die bevorstehen-
den Veränderungen entsprechende Lösungen zu finden. Darüber hinaus haben diese
Veränderungen auch Einfluss auf die sozialen Leistungen in Deutschland, wie z. B.
Renten / Pensionen sowie Steueraufkommen durch Einkommenssteuern.
Der Demografische Wandel bietet den Beteiligten auf dem Arbeitsmarkt jedoch auch
Chancen. Die Arbeitgeber werden sich einer Überprüfung und Optimierung ihrer bishe-
rigen Maßnahmen zur Personalbeschaffung nicht verschließen können. Für qualifizierte
Arbeitnehmer kämen evtl. entsprechende gute Perspektiven für den beruflichen Werde-
gang in Frage. Denkbar ist, dass sie künftig bessere Verhandlungsoptionen im Vergleich
zu Ihren Arbeitgebern des ö. D. aufweisen können, da auch die Privatwirtschaft geeig-
netes Personal benötigt. Die Veränderung weg von einem Arbeitgebermarkt hin zu ei-
1
Ver.di, Mythos Demografie, 2003, Seite 6
2
Statistisches Bundesamt, Demografischer Wandel in Deutschland, Heft 1, 12/2007, S. 3
2
nem Arbeitnehmermarkt wird eine Konsequenz des Wandels sein
3
. Ein positiver
Aspekt sei an dieser Stelle noch vermerkt: Der Wandel wird nicht urplötzlich von einem
Tag auf den anderen auftreten und so bleibt den Arbeitgebern und -nehmern Zeit sich
systematisch und gezielt vorzubereiten
4
. Zu dem eben Genannten ist ein Verweis auf
das eingangs aufgeführte Zitat angebracht. Dort findet sich die Kernaussage wieder,
dass man bereits frühzeitig Regelungen und Vorsorge treffen muss, damit in der
Zukunft eine unzureichende Auseinandersetzung mit der Problematik des demografi-
schen Wandels erst gar nicht eintritt.
In dieser Diplomarbeit wird schwerpunktmäßig die Personalbedarfsdeckung für die
Landesverwaltung in Niedersachsen behandelt. Wenn weniger qualifizierte Kandidaten
auf dem Arbeitsmarkt verfügbar sind, wird es auch für die Verwaltung im ö. D. darauf
ankommen, wie sich ein auftretender Personalbedarf decken lassen kann. Die Arbeitge-
ber im öffentlichen Dienst werden in den folgenden Jahrzehnten in einem noch engeren
Konkurrenzverhältnis zu den Unternehmen der freien Wirtschaft stehen, wenn es um die
Gewinnung von geeigneten Mitarbeitern geht. Beide Seiten werden mittels der zur
Verfügung stehenden Möglichkeiten versuchen sich entsprechend positiv als Arbeitge-
ber zu positionieren. Der ö. D. kann sicherlich noch von einigen Maßnahmen, die
derzeit eher in der freien Wirtschaft verbreitet sind, profitieren. Hierzu sind das
Employer Branding, verstärktes Hochschulmarketing oder ein gezieltes Headhunting
nennenswert.
In Teilen dieser Arbeit fließen neben der allgemeinen Informationsbeschaffung aus
diversen Quellen aus der Literatur und Gesetzen auch Kenntnisse und Erfahrungen des
Autors ein.
Die nachfolgenden Kapitel bauen nach einem konkreten Schema aufeinander auf.
Beginnend mit allgemeinen Informationen rund um das Thema Demografie, folgen
einige Daten und Fakten zum Bundeslandes Niedersachsen und einem kurzen Einblick
in den Aufbau der dortigen Landesverwaltung, inkl. Personalbestand. Diese Angaben
dienen dem leichteren Verständnis über Aspekte, welche nicht unbedingt allgemein
bekannt sind, so z. B. die verschiedenen Laufbahnen im öffentlichen Dienst.
Aber auch als Einstieg in die Thematik erscheint diese Gliederung sinnvoll. Eine Grafik
3
www.pro-active.at, http://www.pro-active.at/article/2005_05_23.php, 2009, S. 2
4
Schmidt, M., Vorbohle, K., Demografischer Wandel als unternehmerische Herausforderung Der
Wandel als Chance?, 2008, S. 13
3
im Bezug auf die Demografie in der Verwaltung, an Hand von Daten des Logistik Zent-
rum Niedersachsen (LZN), wird als ein Beispiel aus der aktuellen Praxis aufgeführt.
Weitergehend wird auf die bisherigen Wege der Personalbedarfsdeckung und der Per-
sonalentwicklung in der nds. Landesverwaltung eingegangen, bevor der Blick auf die
möglichen Methoden gerichtet wird. Dabei werden Varianten aufgezeigt, die für den ö.
D. Optionen für eine Personalbedarfsdeckung darstellen können. Der Bereich des
Erhalts der Beschäftigten wird ebenfalls in einem eigenen Gliederungspunkt wiederge-
geben, auf den im späteren Verlauf noch eingegangen wird. In einem kurzen Abschnitt
am Ende dieser Ausarbeitung, erfolgt eine Betrachtung bezüglich der Ausstattung von
Bildschirmarbeitsplätzen mit adäquater Technik und Möbeln.
Die Abschnitte im Punkt 7. werden durch ein hierfür erdachtes Akronym dargestellt:
STEP, englisch für Schritt, steht in diesem Sinne für ,Strategien für eine erfolgreiche
Personalbedarfsdeckung`. Zwar werden in der Diplomarbeit keine konkret definierten
Strategien aufgezeigt, jedoch potentielle Schritte / Methoden für eine Personalbedarfs-
deckung, welche auch für die Gegebenheiten in der Landesverwaltung als geeignet
scheinen. Somit kann das eben Erwähnte, nämlich die Darstellung bzw. Erwähnung
möglicher Instrumente für eine künftige Personalbedarfsdeckung, als die hauptsächliche
Zielsetzung für diese Arbeit angesehen werden.
4
2.
Allgemeines zum Thema Demografie
Im Anschluss an die vorstehende Einleitung dieser Diplomarbeit folgen im Verlauf
dieses Abschnittes Informationen zum Thema Demografie. Jedoch noch nicht konkret
auf das Thema dieser Diplomarbeit fokussiert, sondern allgemein gehalten.
Der demografische Wandel beschreibt die Entwicklung einer Bevölkerung u. a. im
Hinblick auf deren Aufbau nach Angaben über das Alter und Geschlecht.
Der Begriff Demografie ist griechischen Ursprungs: Demo + graphie = Bevölkerung +
Lehre. Sie stellt eine wissenschaftliche Disziplin dar und bezeichnet die Erforschung
des Zustandes der Bevölkerung und deren zahlenmäßigen Veränderungen
5
. Die Ergeb-
nisse hieraus konzentrieren sich in weiten Teilen auf die im Folgenden genannten
6
. Dies
wären zum einen die räumlichen Bevölkerungsbewegungen (Explizit: die Verlagerung
der Wohnsitze vom Land in die Städte) und zum anderen die natürlichen Bewegungen
durch Geburten und Sterbefällen.
Darüber hinaus kann die Demografie hilfreiche Informationen über die Entwicklung
einer Bevölkerung im Hinblick auf die existierende Altersstruktur liefern. Aussagekräf-
tige Werte lassen sich sowohl für vergangene Zeiten, als auch für die Gegenwart
gewinnen und entsprechend interpretieren. Mittels der Ergebnisse aus diesen Studien
können Ausblicke auf zukünftige Erfordernisse gewonnen werden. So sind die mögli-
chen Konsequenzen aus den ,,zweiten geburtenschwachen Jahrgängen"
7
(seit ca. 1965),
im Hinblick auf die Altersstruktur der Erwerbstätigen, durch die Demografie plakativ
darzustellen.
Das Statistische Bundesamt (Destatis) mit Hauptsitz in Wiesbaden zeichnet für die
Erhebung der relevanten demografischen Daten sowie deren Auswertung in Deutsch-
land verantwortlich. Länderübergreifend ist noch das Statistische Amt der Europäischen
Gemeinschaft (EuroStat) in Luxemburg, als Pendant zum Bundesamt, zu erwähnen.
5
Schubert, K. / Klein, M., Das Politiklexikon
6
Arbeiter Samariter Bund, Was ist Demografie?, S. 2
http://www.morgen-waechst-heute.de/pages/arbeitshilfe/Arbeitshilfe DruckversionEinfuehrungstext.pdf
7
Kaufmann, F.-X., Schrumpfende Gesellschaft, 2005, S. 122
5
3.
Demografischer Wandel in Deutschland
Welche Schlüsse ergeben sich konkret aus der Demografie für die Bundesrepublik?
Derartige Aspekte werden in diesem Kapitel behandelt.
In Deutschland existiert seit ca. 1965
8
bzw. 1970
9
ein Rückgang der Geburtenrate oder
auch im Bereich der Demografie als Fertilität bezeichnet, der wie in den nachfolgenden
Grafiken erkennbar ist, bis in die heutige Zeit anhält.
Abbildung 1: Bevölkerungspyramiden in Deutschland 1970 - 2010 - 2030
10
Aus den Grafiken lässt sich zudem herauslesen, dass das Durchschnittsalter der
Erwerbstätigen in den nächsten Jahren stark ansteigen wird. Als Anmerkung an dieser
Stelle wird noch einmal auf die Angaben bzgl. des Verteilungsverhältnisses zwischen
erwerbstätigen und nichterwerbstätigen Personen des Statistischen Bundesamtes unter
Punkt 1. - Einleitung hingewiesen (Seite 1).
8
Kaufmann, F.-X., Schrumpfende Gesellschaft, 2005, S. 122
9
Rostocker Zentrum für Demografischen Wandel,
http://www.zdwa.de/zdwa/artikel/20060601_44669235W3DnavidW2635.php, 2010, S. 1
10
Statistisches Bundesamt, www.destatis.de/bevoelkerunspyramide, 2009
6
Exemplarisch werden für die Entwicklung der Demografie im Nachgang einige Daten
des Statistischen Bundesamtes
11
erwähnt:
Jahr
< 20
20 - 64
65 +
Gesamt
Bevölkerung
1970 23,4 43,9 10,8 78,1 Millionen
30 56 14 100
%
2010
15 49,7 16,8 81,5 Millionen
18 61 21 100
%
2030 12,9 42,1 22,3 77,4 Millionen
17 54 29 100
%
Abbildung 2: Demografische Entwicklung in Deutschland
Hieraus wird ersichtlich, dass der Anteil der Erwerbstätigen (20 64 Jahre) an der
Gesamtbevölkerung stetig sinken wird. Speziell die Berechnungen hinsichtlich der unter
20-jährigen, also den künftigen Arbeitnehmern, nehmen für den Ausblick auf die
Gestaltung und Aufrechterhaltung eines funktionierenden Arbeitsmarktes in Deutsch-
land eine besondere Stellung ein.
Das Herabsinken der Geburtenzahlen ist bereits seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert
nachgewiesen
12
und nicht ein auf Deutschland konzentriertes Phänomen. Derartige
Beobachtungen werden auch in den anderen Industrienationen (wie z. B. USA, Großbri-
tannien) festgestellt. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts brachten Frauen durchschnittlich
4,6 Kinder auf die Welt. Im Jahre 1915 verzeichnen die Statistiken gar einen Wert von
nur noch 2,9 Kindern. Während der beiden Weltkriege kam es bereits zu noch deutli-
cheren Geburtenrückgängen. Anfang der 1960 Jahre ist der Schnitt auf 2,5 Kinder pro
Frau angestiegen. Zum Verständnis sei noch erwähnt, dass zum Ersetzen einer Eltern-
generation, eine durchschnittliche Geburtenrate von 2,1 Kindern pro Frau erforderlich
ist.
Für das Jahr 1970 belief sich die Zahl der Geburten in Westdeutschland auf durch-
schnittlich 1,4 pro Frau. Auch ca. 35 Jahre später konnte die Quote der Geburtenrate
nicht erhöht werden und beläuft sich daher im Jahre 2004 auf ca. 1,35 Neugeborene. Als
ergänzender Hinweis sei an dieser Stelle vermerkt, dass kurz nach der Wende die
11
Statistisches Bundesamt, Angaben aus den Bevölkerungspyramiden, 2009
12
Rostocker Zentrum für Demografischen Wandel,
http://www.zdwa.de/zdwa/artikel/20060601_44669235W3DnavidW2635.php, 2010, S. 2
7
Geburtenrate in der ehemaligen DDR von 1,9 auf 0,8 Kinder gesunken war. Solch ein
Wert lässt u. a. auf die damalige Unsicherheit der Bevölkerung der ehem. DDR
schließen, da die zukünftigen Perspektiven noch sehr im Unklaren lagen.
Abbildung 3: Entwicklung der Geburtenrate in Deutschland
Die Angaben in o. g. Grafik
13
verdeutlichen nochmals die Entwicklung der Geburtenra-
ten. Werte aus den Jahren 1960 und 1970 geben lediglich die westdeutschen Zahlen an.
Bedingt durch die geburtenschwachen Jahrgänge in den letzten vergangenen Jahrzehn-
ten wird dieses zu einem Nachwuchsmangel führen. Für die neuen Bundesländer sehen
die Prognosen besonders negativ aus, da seit der politischen Wende eine große Anzahl
von Einwohnern, ca. 1,5 Millionen, in die westlichen Bundesländer abgewandert ist
14
.
Welche Gründe könnten ggf. erklären, was vor allem ab 1965 / 1970 zu einem erneuten
Rückgang der Geburtenzahlen führte? Die Literatur
15
spricht hier u. a. von zwei Ereig-
nissen, die in den 1960er Jahren ihren Ursprung bzw. weitere Entwicklungen hatten.
Erstens, eine aus den USA nach Westeuropa übergreifende Emanzipation und zweitens
die Verbreitung der Anti-Baby-Pille. Im Falle des zuletzt genannten Ereignisses, welche
eine unabhängige Empfängnisverhütung durch die Frau ermöglichte, verschob sich das
Machtverhältnis zwischen den Geschlechtern zu Gunsten der Frauen. Bei den Frauen ab
Geburtsjahrgang 1935 konnten, teils drastische, Rückgange im Hinblick auf die Neuge-
borenen festgestellt werden
16
. Einhergehend änderten sich auch nach 1950 die Arten
von Lebenspartnerschaften zu Ungunsten der bisherigen traditionellen Form: der Ehe
17
.
13
Rostocker Zentrum für Demografischen Wandel,
http://www.zdwa.de/zdwa/artikel/20060601_44669235W3DnavidW2635.php, 2010, S. 2
14
Kröhnert, St., Medicus, F., Klingholz, R., Die demografische Lage der Nation, Deutscher Taschenbuch
Verlag, 2006, S. 36
15
Kaufmann, F.-X., Schrumpfende Gesellschaft, 2004, S. 122
16
Kaufmann, F.-X., Schrumpfende Gesellschaft, 2004, S. 123
17
Kaufmann, F.-X., Schrumpfende Gesellschaft, 2004, S. 124
8
Von nun an stieg das Durchschnittsalter der jungen Frauen von knapp 23 Jahren (um
1975) auf ca. 28,5 Jahre (2000). Auf der anderen Seite vergrößerte sich der Anteil der
nichtverheirateten Paare. Ein weiterer Faktor für die Alterung der Bevölkerung ist das
stetige Ansteigen der durchschnittlichen Lebenserwartung der Menschen.
Folgende Gründe lassen die Erhöhung der durchschnittlichen Lebenserwartung
erklären:
-
eine sinkende Säuglings- und Kindersterblichkeit
-
rückläufige Erwachsenensterblichkeit
Aufgrund des stetigen technischen und medizinischen Fortschritts der vergangenen
Jahre, wurde ein erhöhtes Gesundheitsbewusstsein innerhalb der Bevölkerung sowie
verbesserte Arbeitsplatzbedingungen (Arbeitsstättenrichtlinien) erreicht, die im Ergeb-
nis zu den o. g. Punkten führten. Das Durchschnittsalter für Geburten bis 2060 wird die
Lebenserwartung auf ca. 89 Jahre für Mädchen (82,4 Jahre im Jahr 2007/2008) und 85
Jahre bei Jungen (77,2 Jahre im Jahr 2007/2008)
18
steigern.
Für das Land Niedersachsen bleiben die Bevölkerungszahlen bis 2020 auf einem kon-
stanten Niveau, da Niedersachsen wie kaum ein anderes Bundesland durch die Zuwan-
derung, z. B. von Spätaussiedlern, profitiert
19
. Die westlichen Regionen weisen zudem
eine jüngere Bevölkerung mit einer höheren Geburtenrate auf. Des Weiteren entstanden
in den vergangenen Jahren neue Arbeitsplätze im sehr großen Umfang in der Nordsee-
region rund um Cloppenburg und dem Emsland
20
. Hierbei sind Wanderungen aus struk-
turschwächeren Regionen zu beobachten.
Die Stufenweise Erhöhung der Lebensarbeitszeit für den einzelnen Arbeitnehmer wird
wohl auf Sicht die fehlenden jungen Arbeitnehmer nicht ersetzen können. Diese fehlen
dann u. a. im Hinblick auf die Lebensarbeitszeit. Durch die Zunahme der älteren Bevöl-
kerung am Gesamtanteil, wird die derzeit oftmals praktizierte Option eines vorzeitigen
Übertritts in die Pension bzw. Rente nur noch sehr schwer umsetzbar sein
21
.
Die Leistungsfähigkeit des ö. D. sowie der Wirtschaft wird auch davon abhängen, in
wie fern es gelingen wird, die Arbeitnehmer den künftigen Anforderungen entsprechend
18
Egeler, R., Statement vom 18.11.2009, Destatis, Wiesbaden, 2009, S. 3 und 4
19
Kröhnert, St., Medicus, F., Klingholz, R., Die demografische Lage der Nation, Deutscher Taschenbuch
Verlag, 2006, S. 58
20
Kröhnert, St., Medicus, F., Klingholz, R., Die demografische Lage der Nation, Deutscher Taschenbuch
Verlag, 2006, S. 60
21
Lutz B., Demographie als Herausforderung für den öffentlichen Sektor, 2008, S. 21
9
einzusetzen und den begrenzt auf dem Arbeitsmarkt vorkommenden Nachwuchs zu
gewinnen. Für den öffentlichen Dienst ist es auch zukünftig von sehr großer Bedeutung
benötigtes Personal zu beschaffen, um den gesetzlichen Auftrag zu erfüllen. Zu diesen
Aufgaben gehört z. B. die Wahrung der öffentlichen Sicherheit durch Polizei und Ord-
nungsämter, aber auch die schulische und akademische Ausbildung.
An Hand eines Beispiels aus der Praxis soll aufgezeigt werden, in wie weit sich die der-
zeitige Altersstruktur in einer nds. Dienststelle darstellen und welche Schlüsse man für
die kommenden Jahre hieraus ziehen kann. Als Beispiel dient das Logistik Zentrum
Niedersachsen (LZN) in Hann. Münden. Das LZN ist ein Landesbetrieb und direkt dem
Niedersächsischem Ministerium für Inneres und Sport (MI) in Hannover untergeordnet.
Es versorgt die Ressorts der nds. Landesverwaltung mit benötigtem Bedarf an Büroma-
terialien, Fahrzeugen und Dienstkleidung um nur einen kleinen Auszug des Leistungs-
spektrums zu nennen. Der Hauptsitz befindet sich in Hann. Münden, eine Außenstelle
(Einkauf) ist in der Landeshauptstadt angesiedelt.
Mit Stand vom 19.01.2010
22
weist das LZN eine Personalstärke i. H. v. 84 Mitarbeitern
auf. Hiervon sind 33 Männer und 51 Frauen. Das Durchschnittsalter der Beschäftigten
des LZN beträgt 43,19 Jahre. Die dortigen Arbeitnehmerinnen weisen ein etwas niedri-
geres Durchschnittsalter auf (42,06 Jahre), als die Männer (44,94 Jahre). Zwecks Veran-
schaulichung der Verteilung der vorhandenen Altersstruktur wird auf die nachstehende
Grafik hingewiesen:
Abbildung 4: Altersstruktur des LZN
22
Logistik Zentrum Niedersachsen, Demografische Daten, 2010
10
Sehr deutlich wird, dass der Anteil der 40 - 49-Jährigen Mitarbeiter mit ca. 43 % sehr
groß ist, wohin gegen die Gruppe der 20 bis 29-Jährigen mit gerade mal 9,52 % vertre-
ten wird. Einen beachtlichen Wert weisen auch die 50 - 59-Jährigen Arbeitnehmer, mit
ca. 23 % auf.
Aber was verheißen diese Zahlen für die künftigen Jahrzehnte?
Sicher ist, dass sich in naher Zukunft (ca. 10 - 15 Jahren) die derzeit größte vertretende
Gruppe (40 bis 49 Jahre) zu den dann 50 - 59 bzw. den über 60-Jährigen zählen lässt.
Von den eben erwähnten Beschäftigten wird zu diesem Zeitpunkt mit großer Wahr-
scheinlichkeit ein derzeit nur ungenau abzuschätzender Anteil durch Rente / Pension
aus dem Dienst ausgeschieden sein.
Die heute noch jüngeren Arbeitnehmer, die Angehörigen der Gruppen der 20 bis 39-
Jährigen, werden die entstehenden freien Kapazitäten nur ungenügend nachbesetzen
können. Aufgrund der vorgenannten Zahlen wird der zu erwartende Nachwuchsmangel,
nicht nur jener für das LZN, anschaulicher.
4.
Allgemeines zur niedersächsischen Landesverwaltung
Im folgenden Kapitel werden einige wesentliche Fakten und Informationen rund um die
Verwaltung des Landes Niedersachsen dargestellt, um u. a. an die Thematik dieser
Diplomarbeit heranzuführen und Begrifflichkeiten aus dem Bereich der Verwaltung
verständlicher zu machen. Ein Abschnitt wird sich mit der Struktur bzw. dem Aufbau
der Landesverwaltung beschäftigen und ein weiterer Punkt dieses Kapitels gibt Informa-
tionen rund um den derzeitigen Personalbestand im öffentlichen Dienst in Niedersach-
sen wieder. Arbeitnehmer des Landes werden in die Statusgruppen der Beamten,
Richter und Beschäftigte untergliedert. In dieser Diplomarbeit werden die einzelnen
Statusgruppen allgemein als Arbeitnehmer bzw. Beschäftigte aufgeführt, gleich welcher
Gruppe sie tatsächlich angehören, außer es sei des Verständnisses halber angebracht,
den Status konkret zu erwähnen.
11
Nachstehend folgen ein paar allgemeine statistische Informationen rund um das
Bundesland Niedersachsen:
Das Bundesland Niedersachsen, gegründet 1946, zählt mit ca. 7.95 Mio. Einwohnern
23
(Stand: 31.12.2008) zu den bevölkerungsreichsten (viertgrößtes) und einer Fläche
24
von
48.000
km² zu den größten Bundesländern (zweitgrößtes) in Deutschland.
Zum Vergleich, die Bundesrepublik weist mit Stand vom 31.12.2008 eine Bevölkerung
von ca. 82 Mio. Einwohnern
25
auf. Das Staatsgebiet der BRD beläuft sich auf eine
Fläche von ca. 357.000 km²
26
.
Von den knapp 8 Mio. Einwohnern in Niedersachsen stehen etwa 3,6 Mio. in einem
Beschäftigungsverhältnis. Die Gesamtzahl der Erwerbstätigen für ganz Deutschland
belief sich mit Stand vom vierten Quartal 2009 auf rund 40,6 Mio.
27
Einwohner.
Abbildung 5: Niedersachsen
23
LSKN - Bevölkerung nach Altersjahren, http://www1.nls.niedersachsen.de/statistik/html/
mustertabelle.asp?DT=K1000151&LN=DBP&DA=11, 2008, S. 1
24
LSKN Niedersachsen Ein Land stellt sich vor
http://www.nls.niedersachsen.de/Tabellen/Allgemeines/Vorstellung.html, 09/2009
25
Statistisches Bundesamt, Bevölkerung, http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/destatis
/Internet/DE/Navigation/Statistiken/Bevoelkerung/Bevoelkerungsstand/Bevoelkerungsstand.psm 2010
26
Deutschland Fläche, http://www.deutschland.de, 2010
27
Statistisches Bundesamt, Erwerbstätigkeit,
http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/Internet/DE/Content/Statistiken/
Arbeitsmarkt/Erwerbstaetige/Aktuell,templateId=renderPrint.psml, 2010, S. 1
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Erstausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2010
- ISBN (Paperback)
- 9783863410544
- ISBN (PDF)
- 9783863415549
- Dateigröße
- 1 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Verwaltungs- und Wirtschafts- Akademie VWA gemeinnützige GmbH, Kassel
- Erscheinungsdatum
- 2011 (Juli)
- Note
- 2,3
- Schlagworte
- Demografie Öffentlicher Dienst Niedersachsen Landesverwaltung Personalbedarfsdeckung
- Produktsicherheit
- BACHELOR + MASTER Publishing