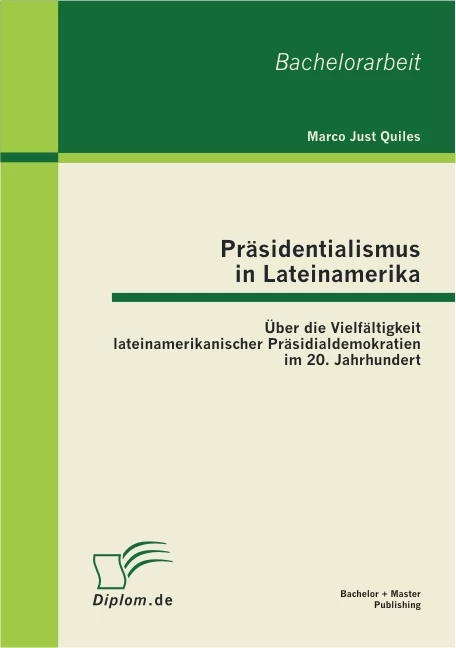Präsidentialismus in Lateinamerika: Über die Vielfältigkeit lateinamerikanischer Präsidialdemokratien im 20. Jahrhundert
Zusammenfassung
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem Wesen des Präsidentialismus in Lateinamerika. Dabei stellt sich die grundlegende Frage nach dem Charakter der lateinamerikanischen Präsidialdemokratien: Handelt es sich in Lateinamerika um einen regionalspezifischen Präsidentialismustypus mit einheitlichen Merkmalen oder lässt die große Anzahl an länderspezifischen Systemmerkmalen eine derartige Vereinheitlichung nicht zu? Für die Untersuchung dieser Frage werden zwei unterschiedliche Politikebenen betrachtet. Im ersten Teil sollen anhand einer verfassungsrechtlichen Analyse die formalen Unterschiede und Gemeinsamkeiten der verschiedenen lateinamerikanischen Regierungssysteme herausgearbeitet werden. Der zweite Teil konzentriert sich verstärkt auf die Verfassungswirklichkeit, also die tatsächlichen politischen Auswirkungen der formalen Verfassungsbestimmungen; dabei werden vier Länderbeispiele zur Analyse herangezogen. In der abschließenden Zusammenfassung soll neben der Beantwortung der Leitfrage ein genereller Ausblick auf das Forschungsthema gegeben werden.
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
I Einleitung
II Forschungsstand: Die Diskussion über die lateinamerikanischen Präsidialsysteme
III Gemeinsamkeiten und Unterschiede präsidentieller Regierungssysteme in Lateinamerika
1 Unterschiede zum US-amerikanischen System
2 Unterschiede zwischen den lateinamerikanischen Präsidialdemokratien
2.1 Die Exekutive
2.1.1 Reaktive Machtkompetenzen des Präsidenten
2.1.2 Proaktive Machtkompetenzen des Präsidenten
2.2 Die Legislative
2.2.1 Gesetzgebungsfunktion des Parlaments
2.2.2 Kontrollfunktion des Parlaments
2.2.3. Repräsentationsfunktion des Parlaments
IV Verfassungswirklichkeit in lateinamerikanischen Präsidialdemokratien: vier Länderbeispiele
1 Venezuela (1958–1995)
1.1 Historischer Überblick
1.2 Merkmale des venezolanischen Regierungssystems
1.2.1 Starker Präsident trotz geringer verfassungsrechtlicher Kompetenzen
1.2.2. Das venezolanische Parteiensystem
1.2.3. Geschwächter Kongress trotz stabiler Mehrheiten
1.3 Fazit
2 Argentinien (1983–1995)
2.1 Historischer Überblick
2.2 Merkmale des argentinischen Regierungssystems
2.2.1 Dekrete – die Machtquelle des argentinischen Präsidenten
2.2.2 Der gelähmte Kongress
2.3 Fazit
3 Brasilien (1985–1995)
3.1 Historischer Überblick
3.2 Merkmale des brasilianischen Regierungssystems
3.2.1 Die weitreichenden formalen Machtkompetenzen des Präsidenten
3.2.2 Der hohe Grad der Fragmentierung im brasilianischen Kongress
3.2.3 Regionalismus, Patronage und mangelnde Parteidisziplin
3.3 Fazit
4 Kolumbien (1968–1991)
4.1 Historischer Überblick
4.2 Merkmale des kolumbianischen Regierungssystems
4.2.1 Die Machtbefugnisse des kolumbianischen Präsidenten
4.2.2 Der kolumbianische Kongress
4.2.3 Der dominante Präsident im Dienste des Kongresses
4.3 Fazit
V Zusammenfassung und Ergebnis
VI Bibliografie
1 Dokumente
2 Literatur
I Einleitung
Seit gut zwei Jahrzehnten hat das allgemeine Interesse an den politischen und sozioökonomischen Prozessen in Lateinamerika[1] stetig abgenommen. Standen die äußerst dynamischen Entwicklungen bis Ende der 1990er Jahre verstärkt im Fokus von Wissenschaft und Medien, befindet sich der Subkontinent gegenwärtig in einer „Randlage der Weltpolitik“ (Junker 1994: 7). Zwar bestimmen in jüngster Vergangenheit vereinzelte linkspopulistische Phänomene in regelmäßigem Abstand die Schlagzeilen, dennoch wird man dem renommierten Lateinamerikaexperten Michael Reid in seiner Einschätzung Recht geben müssen, dass „(…) the flurry of interest only served to underline the region’s status as a largely forgotten continent. It is neither poor enough to attract pity and aid, nor dangerous enough to excite strategic calculation, nor until recently has it grown fast enough economically to quicken boardroom pulses. It is only culturally that Latin America makes itself felt in the world“ (Reid 2007: 2). Die bedrückende Lebenssituation in weiten Teilen des afrikanischen Kontinents, die konfliktreiche Entwicklung in der arabischen Welt, aber auch die dynamischen Wirtschaftsprozesse in Asien ziehen heutzutage eine weitaus größere Aufmerksamkeit auf sich als der lateinamerikanische Kontinent (Werz 2008: 88; Reid 2007: 1). Auch als Forschungsgegenstand ist Lateinamerika immer mehr in den Hintergrund gerückt. Während die Lateinamerikaforschung in den 1980er Jahren im Zuge der Re-Demokratisierung des Kontinentes ihre Hochphase erlebte, wurden seit 1989 durch den Zerfall des bipolaren Weltsystems, besonders in Europa, neue Forschungsakzente gesetzt (Werz 2008: 91). Dennoch erweist sich Lateinamerika bis heute vor allem für die vergleichende Regierungslehre als ein hochinteressantes Forschungsfeld. Keine andere Weltregion gleicht Europa und Nordamerika bezüglich der politischen, rechtsstaatlichen und kulturellen Realität so stark wie Lateinamerika. Trotz des „kolonialen Erbes“ (Rinke/Stüwe 2008: 9) haben sich die nach dem europäischen und vor allem nordamerikanischen Vorbild geschaffenen Regierungssysteme im regionalspezifischen Kontext gänzlich unterschiedlich entfaltet. Auch innerhalb Lateinamerikas weisen die verschiedenen politischen Regierungssysteme sehr unterschiedliche Ausprägungen auf. Dennoch zeichnen sich alle lateinamerikanischen Länder durch ein spezifisches institutionelles Merkmal aus: Lateinamerika ist und bleibt in absehbarer Zukunft die Region der Präsidialdemokratien (Nolte 2000: 1).
Präsidentielle Regierungssysteme unterscheiden sich von parlamentarischen Systemen vor allem in der Beziehung zwischen Regierung und Parlament. Für Winfried Steffani ist die Abberufbarkeit der Regierung das primäre Erkennungsmerkmal für ein parlamentarisches Regierungssystem, die Nichtexistenz der verfassungsrechtlichen Möglichkeit einer Abberufung der Regierung durch das Parlament hingegen das wesentliche Kennzeichen eines präsidentiellen Systems (Steffani 1991: 18f.). Ernst Fraenkel betont die Inkompabilität von Regierungsamt und Mandat als ein weiteres Merkmal präsidentieller Systeme. Als verfassungspolitische Folge dieser starken Trennung zwischen Parlament und Regierung sieht er die relativ lockere Beziehung zwischen dem Präsidenten und seiner Partei sowie die lose Fraktionsdisziplin (Fraenkel 1957: 224f.). Des Weiteren zählen viele Autoren die direkte oder quasi-direkte Wahl der obersten Exekutive bzw. der Regierungsspitze (Sartori 1994a: 106; Lijphart 1994: 94; Mainwaring 1990: 158; Shugart/Carey 1992: 19), die feste Mandatsdauer und die duale Legitimität der Exekutive und Legislative (Linz 1994: 5; Shugart/Carey: 1992: 19; Stepan/Skach 1993: 3) sowie die unipersonale Struktur der Exekutive (Lijphart 1994: 94) zu den entscheidenden Merkmalen eines präsidentiellen Regierungssystems. In den 1960er und 1970er Jahren entstanden im Rahmen der neuen vergleichenden Politikforschung neue Typologien, die durch eine Akzentverlagerung von der formal-institutionellen Unterscheidung hin zu anderen Kriterien gekennzeichnet waren (Thibaut 1996: 46). Während die klassische formal-institutionelle Betrachtungsweise stets die Dichotomie zwischen Präsidentialismus und Parlamentarismus betonte, typologisierte beispielsweise Arend Lijphart demokratische Systeme nach der Art des Elitenverhaltens (koalitionsorientiert vs. kompetitiv) und der politischen Kultur (homogen vs. fragmentiert). Hierbei betrachtet er als entscheidendes Kriterium die Form der Konfliktregelung: durch Wettbewerb (Mehrheitsdemokratie) oder durch gütliches Einvernehmen (Konsensdemokratie) (Lijphart 1968: 38). Roland Czada erweiterte die Kriterien Lijpharts um den Grad des Korporatismus und der konstitutionellen Politikverflechtung (Czada 2000: 37). Für die Transitionsforschung im Zuge der Demokratisierungsprozesse in Lateinamerika in den 1980er Jahren rückte die formal-institutionelle Betrachtungsweise jedoch wieder in den Vordergrund.
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem Wesen des Präsidentialismus in Lateinamerika. Dabei stellt sich die grundlegende Frage nach dem Charakter der lateinamerikanischen Präsidialdemokratien: Handelt es sich in Lateinamerika um einen regionalspezifischen Präsidentialismustypus mit einheitlichen Merkmalen oder lässt die große Anzahl an länderspezifischen Systemmerkmalen eine derartige Vereinheitlichung nicht zu? Für die Untersuchung dieser Frage werden zwei unterschiedliche Politikebenen betrachtet. Im ersten Teil (Kapitel III) sollen anhand einer verfassungsrechtlichen Analyse die formalen Unterschiede und Gemeinsamkeiten der verschiedenen lateinamerikanischen Regierungssysteme herausgearbeitet werden. Der zweite Teil (Kapitel IV) konzentriert sich verstärkt auf die Verfassungswirklichkeit, also die tatsächlichen politischen Auswirkungen der formalen Verfassungsbestimmungen; dabei werden vier Länderbeispiele zur Analyse herangezogen. In der abschließenden Zusammenfassung (Kapitel V) soll neben der Beantwortung der Leitfrage ein genereller Ausblick auf das Forschungsthema gegeben werden.
Ausgewertet wurden sowohl offizielle Verfassungsdokumente als auch die einschlägige Sekundärliteratur. Letztere umfasst die klassischen Abhandlungen von Juan Linz und Arturo Valenzuela (Linz/Valenzuela 1994), Matthew Shugart und John Carey (Shugart/Carey 1992) sowie Alfred Stepan und Cindy Skach (Stepan/Skach 1993). Als besonders inspirierend haben sich die Schriften von Dieter Nohlen (Nohlen 1991) sowie Scott Mainwaring und Matthew Shugart (Mainwaring/Shugart 1997) erwiesen. Bezüglich deutscher Literatur empfehlen sich die Texte von Stefan Rinke und Klaus Stüwe (Rinke/Stüwe 2008), Detlef Nolte und Heinrich Krumwiede (Nolte 2000; Krumwiede/Nolte 2000) sowie Bernhard Thibaut (Thibaut 1996). Zu den verwendeten Quellen auf Spanisch gehören u. a. die Sammelbände von Carlos Santiago Nino (Nino 1992) sowie Diego Valadés und José Maria Serna (Valadés/Serna 2000).
II Forschungsstand: Die Diskussion über die lateinamerikanischen Präsidialsysteme
Zentraler Gegenstand der sogenannten Präsidentialismusdebatte in den 1980er und 1990er Jahren war die Frage, inwieweit die Konsolidierungschancen junger Demokratien durch die grundlegende Wahl des Regimetyps beeinflusst werden (Krumwiede 1997: 86). Angestoßen wurde die Debatte durch einen Aufsatz des Politikwissenschaftlers Juan Linz, in dem er die These vertrat, dass die vorherrschenden präsidentiellen Regierungssysteme in Lateinamerika die Chancen der Demokratiekonsolidierung negativ beeinflussten (Linz 1994: 69).[2] Im Mittelpunkt seiner Kritik steht die „Rigidität“ des präsidentiellen Systems, welche sich besonders aus zwei institutionellen Problemen ergibt. Erstens, das Problem der doppelten Legitimation, das durch die zeitlich und personell getrennte Wahl der Exekutive und Legislative entsteht. Linz argumentiert, dass sich beide Gewalten im Konfliktfall auf die Legitimation des Volkes berufen könnten und mithin die Gefahr eines unlösbaren Konfliktes drohe: „(…) there can be no doubt that presidential regimes are based on a dual legitimacy and that no democratic principle can decide who represents the will of the people in principle“ (ebd.: 6). Zweitens, das Problem der zeitlichen Fixiertheit von Regierungs- und Parlamentsmandat, welches in Verbindung mit dem Wiederwahlverbot in den meisten lateinamerikanischen Verfassungen zu einer Instabilität der Exekutive führen kann. Zum einen stelle das Fehlen von Abberufungsmechanismen die Funktionsfähigkeit des politischen Systems in vielen Situationen vor große Probleme, beispielsweise bei Vertrauensverlust im Volk oder bei Entscheidungsblockaden im Kongress (ebd.: 9). Zum anderen könne sich der Präsident leicht seiner politischen Verantwortung entziehen, da weder die Möglichkeit einer Absetzung noch einer Wiederwahl bestehe (ebd.: 16f.). Linz plädiert daher für die Einführung parlamentarischer Strukturen, um den vorherrschenden Problemen in den Ländern Lateinamerikas besser entgegenzuwirken. In diesem Zusammenhang erschien Mitte der 1990er Jahre eine Reihe von empirischen Studien, welche die bis dahin sehr theoretische Debatte um konkrete statistische Angaben in Bezug auf die demokratische Stabilität von präsidentiellen und parlamentarischen Systemen erweiterten (siehe hierzu z. B. Stepan/Skach 1993; Mainwaring/Shugart 1997).
Die Kritik am präsidentiellen System blieb nicht unkommentiert. Mainwaring und Shugart beziehen eine Gegenposition zu Linz, indem sie auf verschiedene Vorteile des Präsidentialismus hinweisen. So sehen sie in der getrennten Wahl von Präsident und Parlament zwei zentrale Vorteile für den Wähler. Zum einen besitzt er größere Wahlmöglichkeiten, da er zwei Wahlen beeinflussen kann. Zum anderen hat der Wähler eine klarere Alternative zwischen den verschiedenen Präsidentschaftskandidaten. Gleichzeitig unterliegt der Präsident wiederum einer stärkeren Wählerkontrolle, da er für die politische Situation die unmittelbare Verantwortung trägt (ebd.: 33f.). Giovanni Sartori argumentiert, dass parlamentarische Systeme nicht per se die besseren Regierungssysteme darstellten. Vielmehr sei die Funktionsfähigkeit vieler parlamentarischer Demokratien dem stabilen Parteiensystem in den jeweiligen Ländern geschuldet. Seiner Meinung nach bedarf es mithin vor allem einer Stabilisierung der lateinamerikanischen Parteistrukturen (Sartori 1994a: 30f.). Dieter Nohlen plädiert für einen differenzierteren Forschungsansatz bei der Analyse und Bewertung lateinamerikanischer Präsidialdemokratien. Im Gegensatz zum theoretisch-deduktiven Ansatz von Linz betrachtet Nohlen in seinem „enfoque histórico-empírico“ die lateinamerikanischen Regierungssysteme vor dem Hintergrund der jeweiligen länderspezifischen Gegebenheiten, da „(…) el verdadero significado del factor institucional y la idoneidad de arreglos institucionales particulares dependen de la contigencia política, es decir, de las estructuras sociales, de las condiciones históricas y de la cultura política“ (Monsalve/Sottoli 1999: 150–154). So erweisen sich aus der Perspektive des „enfoque histórico-empírico“ viele dem Präsidentialismus zugeschriebene Defizite in Lateinamerika als historisch konstante Problematiken, die keinesfalls ausschließlich auf den Regimetyp zurückzuführen sind. Nohlen plädiert deshalb nicht für die Hinwendung zum Parlamentarismus, sondern für eine pragmatische Reform der lateinamerikanischen Präsidialsysteme, beispielsweise durch die Einführung eines Regierungschefs[3] (Nohlen 1991: 34.).
Zusammenfassend lässt sich die Diskussion über die präsidentiellen Regierungssysteme als „intellektuell sehr anregend, aber (in) ihrer politischen Auswirkungen letztlich wenig fruchtbar“ (Nolte 2000: 1) beschreiben. Dies zeigt sich besonders an der bescheidenen politischen Rezeption der wissenschaftlichen Debatte in Lateinamerika.[4] Als Hauptkritikpunkt der Präsidentialismusdebatte lässt sich die allgemein zu geringe Orientierung an spezifisch intrinsischen Bedingungen in Lateinamerika ausmachen (Carpizo 2000: 27; Nohlen 1991: 35.). Es ist Stefan Rinke zuzustimmen, wenn er resümierend feststellt, dass „(…) die meisten präsidentiellen Systeme unter schwierigeren sozioökonomischen Bedingungen existieren als die parlamentarischen Demokratien Europas. (…) Dies legt den Schluss nahe, dass es in den erfolgreichen parlamentarischen Systemen einen Standortvorteil gegeben hat. Das präsidentielle System kommt hingegen als Regierungsform in Lateinamerika unter Bedingungen vor, die für jegliche Regierungsform schwierig erscheinen“ (Rinke/Stüwe 2008: 33).
III Gemeinsamkeiten und Unterschiede präsidentieller Regierungssysteme in Lateinamerika
Vergleichende Studien über die Merkmale präsidentieller Regierungssysteme in Lateinamerika beginnen häufig mit einer Abgrenzung gegenüber dem US-amerikanischen Regierungssystem (Rinke/Stüwe 2008; Nolte 2000; Krsticevic 1992; Schultz 2000). Diese Vorgehensweise scheint insofern sinnvoll, als die Abgrenzung das Vorhaben vereinfacht, trotz der Komplexität dieses umfangreichen Forschungsfeldes Parallelen zwischen den verschiedenen lateinamerikanischen Regierungssystemen herauszuarbeiten. Unzulässig ist dabei jedoch der Rückschluss, das US-amerikanische Regierungssystem könne als Prototyp eines präsidentiellen Regierungssystems dienen. Aufgrund zahlreicher regionaler Eigenheiten wie zum Beispiel des ausgeprägten Föderalismus und der Stärke des Kongresses geben die USA keinen geeigneten Maßstab für die Beurteilung lateinamerikanischer Demokratien ab (Nolte 2000: 12; Krumwiede/Nolte 2000: 60). Dies muss im ersten Teil der folgenden Analyse berücksichtigt werden.
Auch untereinander weisen die Präsidialsysteme Lateinamerikas große Unterschiede auf: „Presidential systems vary so greatly in the powers accorded to the president, the types of party and electoral systems with which they are associated, and the socioeconomic and historical context in which they are created that these differences are likely to be as important as the oft-assumed dichotomy between presidential and parliamentary systems“ (Mainwaring/Shugart 1997: 435). Im Folgenden werden sowohl die Gemeinsamkeiten als auch die Unterschiede zwischen den verschiedenen Regierungssystemen in Lateinamerika dokumentiert. Dabei wird der Fokus besonders auf die Rolle der Exekutive und der Legislative sowie auf deren Interaktion gerichtet. Der Bedeutung der Judikative kann in dieser Arbeit nicht Rechnung getragen werden.
1 Unterschiede zum US-amerikanischen System
Obwohl die präsidentiellen Systeme Lateinamerikas alle nach dem Vorbild des US-amerikanischen Systems entstanden, sind sie keine Kopie davon. Vielmehr haben sie unterschiedliche Formen angenommen, die oftmals durch die Übernahme von parlamentarischen Elementen beeinflusst wurden (Rinke/Stüwe 2008: 29).
Als zentrales Unterscheidungsmerkmal kann die Dominanz des Präsidenten in lateinamerikanischen Regierungssystemen ausgemacht werden (Thibaut 1996; Krsticevic 1992; Rinke/Stüwe 2008; Werz 2008). Das „Primat der Exekutive“ (Fernández/Nohlen 1991: 42) ist zum einen auf die Kombination aus weitreichenden präsidentiellen Legislativbefugnissen sowie personalpolitischen Vollmachten in der Administration und der Justiz zurückzuführen (Thibaut 1996: 72). Viele lateinamerikanische Präsidenten können mithin direkten Einfluss auf den Gesetzgebungsprozess nehmen, während der US-Präsident selbst keine Gesetze in den Kongress einbringen kann.[5] So gehen in einigen Ländern Lateinamerikas 80 bis 90 % der Gesetzesinitiativen auf die Exekutive zurück (Krumwiede/Nolte 2000: 95); in Abschnitt III.2.1 werden die unterschiedlichen Einflussmöglichkeiten des Präsidenten näher erläutert.
Zum anderen profitiert die Exekutive von der geringen Ausprägung des Systems der checks and balances (Werz 2008: 179; Rinke/Stüwe 2008: 35). Die wesentlichen Gründe hierfür können aus unterschiedlichen Erklärungsperspektiven erläutert werden. Die historische Erklärung verweist besonders auf die staatlichen und politisch-kulturellen Traditionen, vorwiegend beeinflusst durch die Kolonialzeit und die Unabhängigkeitsprozesse (Davis 1958; Gómez 1967; Mols 1985). Dabei wird die institutionelle Zentralisierung der politischen Macht, welche schon Mitte des 19. Jahrhunderts in den meisten Ländern der Region zum bestimmenden Merkmal der Regierungssysteme wurde, als eine historische Konstante in Lateinamerika betrachtet (Fernández/Nohlen 1991: 42f.). Die im Präsidentenamt verkörperte nationale Exekutive entwickelte sich in vielen Staaten alsbald zum „Motor der territorialen und institutionellen Konsolidierung und der infrastrukturellen Erschließung des Staates“ (Thibaut 1996: 73), mit der Folge, dass sich eine gesellschaftliche Toleranz gegenüber einer starken Präsidentschaft herausbildete und die Rolle der Parlamente traditionell als unwichtiger verstanden wurde (siehe dazu Krumwiede/Nolte 2000). Ein völkerpsychologischer Erklärungsansatz, nach dem die Länder Lateinamerikas aufgrund des iberisch-katholischen Erbes zum Autoritarismus neigen, im Gegensatz zur freiheitlich-demokratischen Tendenz der Angloamerikaner, wird jedoch in der modernen Forschung abgelehnt (Rinke/Stüwe 2008: 50). Der institutionelle Ansatz betont die äußerst schwache Position der Legislative sowie der Judikative als Kontrollinstanz gegenüber dem Präsidenten (Sartori 1994b; Werz 2008; Rinke/Stüwe 2008). Aus verschiedenen Gründen können die Parlamente in den meisten Ländern Lateinamerikas kein Gegengewicht zum Präsidenten bilden. Während der amerikanische Kongress den Ruf des mächtigsten Parlamentes der westlichen Demokratien genießt (Hübner 2007: 113; Stüwe 2008: 558), erschweren fragmentierte Parteienlandschaften, Partikularismus, klientelistische Praktiken und Korruption die Behauptung lateinamerikanischer Parlamente gegenüber der Exekutive (siehe dazu Abschnitt III.2.2.3).
Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal zwischen den lateinamerikanischen Regierungssystemen und dem US-amerikanischen Präsidentialismus zeigt sich bei der Betrachtung der Beziehung zwischen Legislative und Exekutive. Das in der US-amerikanischen Verfassung verankerte Inkompatibilitätsgebot verbietet dem Präsidenten sowie den Regierungsmitgliedern die Teilnahme an Kongresssitzungen (Hübner 2007: 110). In lateinamerikanischen Regierungssystemen ist dies nicht so. Cox und Morgenstern unterscheiden folgende Aspekte: „(1) ministers cannot sit in the assembly in the U.S. an tipically are not appointed with an eye to building assembly support, whereas they can often sit in the assembly (practically speaking) in Latin America and are often appointed with an eye to solidifying assembly support; (2) ministers and the president wield important power in setting the assembly´s internal legislative agenda in Latin America but not in the U.S.; and (3) the integration of the executive and legislative branches of the parties is often greater in Latin America (e.g. Costa Rica, Uruguay, and Venezuela) than in the U.S.“ (Cox/Morgenstern 1998: 17).
Ein weiterer Aspekt in der Differenzierung ist der Unterschied bezüglich der Kontrollmechanismen des Kongresses gegenüber dem Präsidenten. Trotz der angesprochenen Schwäche lateinamerikanischer Parlamente im Hinblick auf ihre Kontrollfunktion sind sie im Gegensatz zum US-amerikanischen Kongress mit zahlreichen Kritik- und Kontrollkompetenzen ausgestattet. In den USA besitzt der Kongress lediglich durch das impeachement -Verfahren die Möglichkeit, den für vier Jahre gewählten Präsidenten frühzeitig abzusetzen (Art. II Sect. 4 US-Verfassung). Zu den Kontrollmechanismen in lateinamerikanischen Parlamenten gehört dagegen eine Reihe einflussreicher Sanktionsinstrumente, die üblicherweise in parlamentarischen Regierungssystemen anzutreffen sind. So räumen einige lateinamerikanische Verfassungen dem Kongress ein Zensur- bzw. ein Abberufungsrecht gegenüber Kabinettsmitgliedern ein (siehe dazu Abschnitt III.2.2.2).
Ferner bedingen weitere parlamentarische Elemente in lateinamerikanischen Präsidialdemokratien einen deutlichen Unterschied zum US-Präsidentialismus. Dazu zählen neben der erwähnten Ministerzensur vor allem die institutionelle Einführung des Regierungschefs in einigen Ländern zu Beginn der 1990er Jahre (z. B. Peru und Argentinien) sowie die Gegenzeichnungspflicht präsidentieller Akte durch Minister (siehe dazu Abschnitt III.2.2.2).
Der vorliegende Überblick dokumentiert einige signifikante Unterschiede zwischen den präsidentiellen Systemen in Lateinamerika und den Vereinigten Staaten. Dabei erweist sich die präsidentielle Dominanz aufgrund der schwachen Ausprägung des Systems der checks and balances als zentrales Merkmal lateinamerikanischer Präsidentialdemokratien. Trotz einer Reihe von Regelungen zur Beschränkung der Macht des Präsidenten, die an entsprechende Bestimmungen in parlamentarischen Regierungssystemen erinnern, fungiert weder die Legislative noch die Judikative als effektive Kontrollinstanz gegenüber der Exekutive. Die häufig zitierte These Richard Neustadts, nach der es sich in den USA um ein „government of separated institutions sharing powers“ (Neustadt 1991: 29) handelt, trifft auf lateinamerikanischen Regierungssysteme wohl kaum zu.
2 Unterschiede zwischen den lateinamerikanischen Präsidialdemokratien
Die im vorausgegangenen Abschnitt getroffenen Pauschalaussagen über den Charakter lateinamerikanischer Präsidialsysteme sollen nicht fälschlicherweise den Eindruck entstehen lassen, es handele sich in Lateinamerika um einheitliche und genuine Regierungssysteme. Zwar bestehen, wie oben erläutert, einige Parallelen und Gemeinsamkeiten, die Merkmale der präsidentiellen Systeme unterscheiden sich jedoch in den einzelnen Ländern gravierend. Die folgende Analyse basiert auf den formalen Inhalten der jeweiligen Verfassungstexte. Berechtigterweise kann gegen eine solche, auf verfassungsrechtliche Aspekte abhebende Analyse eingewendet werden, dass besonders in Lateinamerika die tatsächliche Verfassungswirklichkeit im starken Maße vom geschriebenen Verfassungstext abweicht (Serrafero 1993: 119f.; Krumwiede/Nolte 2000: 68). Auch die Kurzlebigkeit vieler lateinamerikanischer Verfassungen lässt eine solche Analyse in einem problematischen Licht erscheinen. Deshalb kann im Folgenden nicht der Anspruch erhoben werden, ein umfassendes und detailliertes Abbild der Unterschiede zwischen den verschiedenen Präsidialsystemen Lateinamerikas zu liefern.[6] Vielmehr soll ein exemplarischer Überblick gegeben werden, der dennoch zum besseren Verständnis des komplexen Forschungsfeldes beiträgt. Der Verfassungswirklichkeit soll in Kapitel IV größere Aufmerksamkeit geschenkt werden.
2.1 Die Exekutive
Der Präsident ist in den Verfassungen lateinamerikanischer Länder mit unterschiedlich starken Machtbefugnissen ausgestattet. Mainwaring und Shugart unterscheiden in ihrer vergleichenden Analyse über die Präsidialsysteme in Lateinamerika zwischen zwei verschiedenen präsidentiellen Machtkategorien, den reaktiven und den proaktiven Machtkompetenzen. Proaktive Kompetenzen ermöglichen dem Präsidenten einen direkten Einfluss auf die Gesetzgebung und die politische Lage des Landes, z. B. durch Dekrete. Reaktive Kompetenzen wiederum dienen dem Präsidenten zur Erhaltung des Status quo, z. B. durch das Vetorecht (Mainwaring /Shugart 1997: 41).
2.1.1 Reaktive Machtkompetenzen des Präsidenten
Die wichtigste reaktive Kompetenz ist das präsidentielle Veto gegenüber Entscheidungen des Parlaments im Gesetzgebungsprozess. Wie in den USA haben alle Präsidenten Lateinamerikas ein suspensives Vetorecht. Dennoch erweist sich das Vetorecht vieler lateinamerikanischer Präsidenten als weitreichender. Außer in Honduras und Guatemala statten alle lateinamerikanischen Verfassungen ihren Präsidenten mit einem partiellen Vetorecht aus (Rinke/Stüwe 2008: 30). Dies ermöglicht der Exekutive, bestimmte Artikel und sogar Wörter eines Gesetzes zu blockieren. Die meisten Verfassungen sehen vor, dass anschließend das gesamte Gesetz an den Kongress zurückgesendet wird, der erneut über die modifizierten Passagen abstimmt (Mainwaring/Shugart 1997: 43). Lediglich die argentinische Verfassung von 1853, die chilenische Verfassung von 1925 und die kolumbianischen Verfassungen von 1886 und 1991 sehen ein sogenanntes line item veto vor; Präsidenten verabschieden in diesem Falle das modifizierte Gesetz, ohne es ein weiteres Mal an den Kongress zurückzusenden. In der Praxis haben sich viele lateinamerikanische Präsidenten dieser besonderen Vetokompetenz bemächtigt, da sie ihnen einen weitaus größeren Spielraum im Gesetzgebungsprozess ermöglicht (ebd.: 44).
Das Quorum zur Überstimmung eines präsidentiellen Vetos weist erhebliche Unterschiede in den Ländern Lateinamerikas auf (siehe dazu Abschnitt III.2.2.1). Während in nur drei Ländern (Ecuador, Panama, Dominikanischen Republik) nach dem Vorbild der USA eine Zweidrittelmehrheit aller Parlamentarier benötigt wird, reicht in anderen Staaten der Region (Argentinien, Bolivien, Chile) eine Zweidrittelmehrheit der anwesenden Parlamentarier oder sogar nur eine absolute Mehrheit (Brasilien, Kolumbien, Nicaragua, Peru, Uruguay und Paraguay) bzw. eine einfache Mehrheit (Venezuela) (Nolte 2000: 19; Rinke/Stüwe 2008: 30). Damit erscheint das präsidentielle Vetorecht in vielen lateinamerikanischen Ländern, trotz der angesprochenen Möglichkeit eines line item veto, als ein weniger wirkungsvolles Instrument (Rinke/Stüwe 2008: 30). Bedenkt man jedoch, dass sich zahlreiche lateinamerikanische Parlamente durch eine chronische Abwesenheit von Mehrheiten charakterisieren (siehe hierzu Abschnitt III.2.2.3), erweist sich selbst ein niedriges Quorum zur Überstimmung des präsidentiellen Vetos als ein problematisches Unterfangen.
2.1.2 Proaktive Machtkompetenzen des Präsidenten
Zu den proaktiven Kompetenzen des Präsidenten gehört das Recht, in bestimmten Politikbereichen Gesetzesdekrete zu erlassen.[7] Dekrete sind in Lateinamerika ein bedeutsames Instrument der Exekutive, um in den Gesetzgebungsprozess einzugreifen und ihn zu steuern. Dennoch bedarf die klischeehafte Vorstellung, lateinamerikanische Präsidenten usurpierten in quasi cäsarischer Manier Gesetzgebungskompetenzen der Parlamente, indem sie per Dekret an ihnen vorbeiregierten, einer starken Korrektur (Krumwiede/Nolte 2000: 80). Zwar räumen die meisten lateinamerikanischen Verfassungen dem Präsidenten Dekretvollmachten ein, jedoch unterscheiden sich Intensität, Form, Umfang und Ausmaß der Dekrete von Land zu Land (Mainwaring/Shugart 1997: 44). Grundsätzlich muss zwischen den eigenständigen, in der Verfassung verankerten Dekretkomepetenzen und den vom Parlament delegierten Dekretvollmachten unterschieden werden (Shugart/Carey 1992: 12f.). So besitzt der Präsident beispielsweise in Chile und Venezuela ausschließlich delegierte Dekretvollmachten. Das bedeutet, dass der Präsident nur dann seine Dekretvollmachten nutzen darf, wenn ihm der Kongress die explizite Erlaubnis dazu erteilt (Nolte 2000: 20).
Des Weiteren unterscheiden sich die Politikfelder, in denen der Präsident Dekrete erlassen darf. Nur in drei Ländern (Argentinien, Brasilien und Kolumbien) gelten präsidentielle Dekrete in allen policy -Bereichen, während beispielsweise die peruanischen Verfassungen von 1979 und 1993 die Dekretrechte des Präsidenten lediglich auf Finanz- und Steuerangelegenheiten beschränken (Mainwaring/Shugart 1997: 45). Ferner muss bezüglich des gesetzlichen und zeitlichen Umfangs der Dekrete unterschieden werden. In einigen Ländern (z. B. Brasilien, Peru und Honduras) haben präsidentielle Dekrete automatisch Gesetzeskraft, die sogenannten decreto ley. Diese Dekrete bleiben so lange gültig, bis der Kongress sie widerruft. Eine Ausnahme bildet Kolumbien, wo die Dekrete des Präsidenten erst nach einem Jahr durch den Kongress geändert werden können (Rinke/Stüwe 2008: 30). In anderen Ländern wiederum werden Dekrete erst nach Ablauf einer bestimmten Frist in rechtmäßiges Gesetze umgewandelt. So werden Wirtschaftsdekrete in Ecuador bei Nichtintervention des Kongresses nach 15 Tagen automatisch in den Rechtskatalog aufgenommen, in Brasilien hingegen nach 30 Tagen (Mainwaring/Shugart 1997: 45). Die Fristenregelung wurde ursprünglich zur Begrenzung der präsidentiellen Einflussmöglichkeiten konzipiert, sie hat sich aber in der Praxis als ein „Korsett des Parlamentes“ (Nolte 2000: 21) erwiesen, da in der Regel der vorgesehene Zeitraum für eine intensive parlamentarische Beratung nicht ausreicht.
Eine besondere Form der Dekrete bilden die Notstandsbestimmungen in lateinamerikanischen Verfassungen (z. B. in Argentinien, Bolivien, Kolumbien, Ecuador und Venezuela). Diese Bestimmungen treten bei inneren Unruhen oder äußerer Bedrohung in Kraft. Sie umfassen in den meisten Fällen eine starke Machtzentrierung zugunsten des Präsidenten. Zwar hat der Kongress einige Einflussmöglichkeiten auf den Notstandsmechanismus[8], dennoch dienten die Notstandsbestimmungen lateinamerikanischen Präsidenten auch in Nichtkrisenzeiten oftmals als Instrument, um den Kongress zu umgehen (Krsticevic 1992: 141). Die Notstandsbestimmungen wurden in den Ländern Lateinamerikas unterschiedlich stark eingesetzt. Dies lag sicherlich nicht nur an den verfassungsrechtlichen Bestimmungen, sondern auch an der spezifischen Reaktion der Legislative. Besonders in Argentinien und in Kolumbien haben die Notstandsbestimmungen eine lange Tradition (siehe dazu Abschnitt IV.2.2.1; IV.4.2.1).
Neben den Dekretvollmachten besitzt der Präsident in allen lateinamerikanischen Ländern exklusive Initiativkompetenzen auf bestimmten Politikfeldern (Rinke/Stüwe 2008: 30). So ist beispielsweise die Erstellung des Haushaltsgesetzes ausschließlich Sache der Exekutive. Sowohl in Uruguay als auch in Peru hat der Präsident darüber hinaus das exklusive Legislativrecht in der Steuerpolitik (Mainwaring/Shugart 1997: 48).
Ausgehend von den Dekretkompetenzen, dem Vetorecht und den exklusiven Initiativkompetenzen des Präsidenten hat es mehrfach den Versuch gegeben, eine Rangordnung lateinamerikanischer Verfassungen bezüglich der präsidentiellen Stärke vorzunehmen (Mainwaring/Shugart 1997: 49; Shugart /Carey 1992: 155; Krumwiede/Nolte 2000: 77). Resümiert man die Ergebnisse dieser Arbeiten, ergibt sich folgendes Bild: Argentinien, Brasilien, Chile, Ecuador, Kolumbien und Peru verfügen über Verfassungen, die dem Präsidenten eine sehr starke verfassungsrechtliche Position einräumen. Die Verfassungen von Bolivien, Mexiko, Paraguay, Uruguay und Venezuela gestehen dem Präsidenten im Vergleich relativ geringe Machtbefugniss zu (Nolte 2000: 23).
2.2 Die Legislative
Parlamente fungieren in demokratischen Systemen als Ort der Gesetzgebung, als Kontrollinstanz gegenüber der Regierung und als Zentrum politischer Diskussion (Rinke/Stüwe 2008: 34). Auch im politischen Institutionsgefüge lateinamerikanischer Präsidialsysteme kommt dem Parlament eine wichtige Rolle zu. Krumwiede und Nolte nennen drei zentrale Funktionen der Parlamente in Lateinamerika: a) die Mitwirkung an der Politikgestaltung bzw. das „Mitregieren“ auf dem Wege der Gesetzgebung (Gesetzgebungsfunktion), b) die Einschränkung und Kontrolle der Macht der Exekutive (Kontrollfunktion) und c) die Repräsentation im Hinblick auf die Wählerschaft (Repräsentationsfunktion) (Krumwiede/Nolte 2000: 61–71). Im Folgenden sollen anhand der drei genannten Funktionen die Merkmale und Unterschiede zwischen den verschiedenen Präsidialdemokratien Lateinamerikas herausgearbeitet werden.
2.2.1 Gesetzgebungsfunktion des Parlaments
Lediglich in neun lateinamerikanischen Staaten gibt es unikamerale Parlamente: in Ecuador, El Salvador, Nicaragua, Panama, Peru, Venezuela, Costa Rica, Guatemala, Honduras. In den restlichen Ländern existieren, nach dem Vorbild der USA, zwei Parlamentskammern (Abgeordnetenhaus und Senat) (Rinke/Stüwe 2008: 34). Die Diskussion um die Vor- und Nachteile des Zweikammersystems kann an dieser Stelle nur rudimentär erläutert werden (siehe dazu Patterson/Mughan 1999: 9–16; Tsebelis/Money 1997: 13–43; Planas 1997: 73–98). Zu den Vorteilen werden in der Literatur gezählt: die Effizienzsteigerung und qualitative Verbesserung der Gesetzgebung durch die Arbeitsteilung (Planas 1997: 75), die gegenseitige Qualitätskontrolle beider Kammern (Tsebelis/Money 1997: 40) und die Funktion der Repräsentation regionaler Interessen, vor allem in föderalen Regierungssystemen (Lijphart 1999: 203–213). Als Hauptkritikpunkte werden die Blockademöglichkeit zwischen beiden Parteien und die gesteigerten Unterhaltungskosten angeführt (Nolte 2000: 24).
Aufgrund der Dominanz des Präsidenten im Gesetzgebungsverfahren scheint die legislative Gestaltungsmacht der lateinamerikanischen Parlamente generell begrenzt zu sein. Wie bereits angesprochen, stammen die meisten Gesetzesinitiativen aus der Exekutive, weshalb sich der Handlungsspielraum der Legislative meist auf die Umgestaltung von Gesetzesvorschlägen beschränkt (ebd.: 27). Krumwiede und Nolte verweisen in ihrer Studie über die Rolle der Parlamente in Lateinamerika zu Recht auf die Unterschiede bezüglich der Legislativkompetenzen zwischen den verschiedenen lateinamerikanischen Parlamenten (Krumwiede/Nolte 2000: 68–85).[9] Ihre Unterscheidung erfolgt anhand von vier Kriterien: Zurückweisung des präsidentiellen Vetos durch das Parlament, parlamentarischer Einfluss auf die legislativen Dekretvollmachten des Präsidenten, parlamentarischer Einfluss auf die Ausrufung des Ausnahmezustandes und Suspendierung von Grundrechten, parlamentarischer Einfluss auf Haushaltsrechte. Bezogen auf das erste Kriterium weist Venezuela die größten Einflussmöglichkeiten auf, da eine einfache Mehrheit zur Überstimmung des präsidentiellen Vetos ausreicht. Das Parlament in Ecuador hat es dagegen mit einer Zweidrittelmehrheit schwer, das Veto des Präsidenten außer Kraft zu setzen (siehe auch Abschnitt III.2.1.1). Die größten Einflussmöglichkeiten auf die präsidentiellen Dekretvollmachten haben die Parlamente in Bolivien, Mexiko und Uruguay. Dies ist darauf zurückzuführen, dass dem Präsidenten generell nur wenige legislative Dekretkompetenzen zugestanden werden. Die Parlamente in Peru und Argentinien haben aufgrund der weitreichenden Legislativbefugnisse des Präsidenten die schwächste Position inne. Parlamentarische Mitbestimmungsrechte im Hinblick auf die Ausrufung des Ausnahmezustandes und die Suspendierung von Grundrechten durch den Präsidenten sind in Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay am größten; Notstandsbestimmungen können in diesen Ländern nur mit der Zustimmung des Parlaments erlassen werden. In Chile, Peru und Bolivien hat der Kongress hingegen nur einen marginalen Einfluss auf die Notstandsmaßnahmen des Präsidenten. Bezüglich der Haushaltsgesetze fällt auf, dass alle untersuchten Parlamente einen relativ schwachen Einfluss auf deren Verabschiedung haben. Lediglich das mexikanische Parlament hat einige Mitspracherechte in Bezug auf die Haushaltspolitik (ebd.: 73).
Die Gesamtbetrachtung der Legislativbefugnisse der untersuchten Parlamente ergibt folgendes Bild: In Mexiko, Paraguay und Bolivien nimmt der Kongress, besonders wegen der Einflussmöglichkeiten auf die präsidentiellen Dekretkompetenzen, eine relativ starke Position gegenüber der Exekutive ein. Hingegen haben sowohl der peruanische als auch der kolumbianische Kongress, verfassungsrechtlich gesehen, die geringsten Einflussmöglichkeiten auf den Gesetzgebungsprozess.
[...]
[1] Zur historischen und geographischen Begriffsbestimmung siehe Maurer/Molt 1968: 8–15.
[2] Erstmals erschien der Aufsatz von Juan Linz 1984 und wurde in den folgenden Jahren mehrmals überarbeitet (siehe dazu Linz 1994: 1).
[3] Nohlen argumentiert, dass die Einführung eines Regierungschefs zur Systemstabilität beitragen könne. Erstens, der Regierungschef würde die politischen Geschäfte übernehmen, so dass sich der Präsident darauf konzentrieren könne, einen Konsens zwischen Exekutive und Legislative herzustellen. Zweitens, der Regierungschef könne als Mittelsmann zwischen Exekutive und Legislative fungieren, um mögliche Blockaden zu verhindern. Drittens, der Regierungschef könne helfen, die Popularität des Präsidenten zu schützen, indem er eine Art „Sündenbock“- Funktion übernehme. Der Vorschlag über die Einführung eines Regierungschefs wurde in Argentinien und in Peru in den 1990er Jahren übernommen.
[4] Das Verfassungsplebiszit in Brasilien von 1993, als sich lediglich 25 % der Bevölkerung für die Einführung eines parlamentarischen Systems aussprachen, markiert das Ende der Diskussion um die Bedeutung präsidentieller Regierungssysteme auf politischer Ebene (Waldmann/Krumwiede1980: 283).
[5] Dem Präsidenten der Vereinigten Staaten ist formal die Möglichkeit der Gesetzesinitiative verschlossen. Dennoch kommt auch in den USA ein erheblicher Teil der im Kongress eingebrachten Gesetzesvorschläge aus der Exekutive. Offiziell werden die Gesetzesvorschläge von nahestehenden Kongressmitgliedern eingebracht (Hübner 2007: 118).
[6] Auf wahlrechtliche Bestimmungen in den verschiedenen Verfassungen Lateinamerikas kann im Folgenden aufgrund des begrenzten Umfangs der vorliegenden Arbeit nicht eingegangen werden. Siehe dazu z. B. Rinke/Stüwe 2008: 36–39 sowie Nolte 2000: 14–17 und 25–31.
[7] Mit „Dekreten“ sind hier keine Verwaltungsvorschriften gemeint, sondern Regelungen, die mit Gesetzen vergleichbar sind.
[8] In einigen Ländern bedarf die Ausrufung des Notstandes einer Zustimmung des Parlamentes (z. B. in Argentinien, Brasilien, Mexiko, Paraguay und Uruguay), in anderen Ländern kann das Parlament die Ausrufung des Notstandes für nichtig erklären (z. B. in Ecuador und Venezuela). Siehe hierzu Abschnitt III.2.2.1.
[9] Krumwiede und Nolte untersuchten in ihrer 1998 erhobenen Studie zehn südamerikanische Länder und Mexiko. Folgende Verfassungen wurden herangezogen: Argentinien (1994), Bolivien (1967), Brasilien (1988), Chile (1980), Ekuador (1998), Kolumbien (1991), Mexiko (1916), Paraguay (1992), Peru (1993), Uruguay (1967) und Venezuela (1961).
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Erstausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2009
- ISBN (Paperback)
- 9783863410872
- ISBN (PDF)
- 9783863415877
- Dateigröße
- 673 KB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn
- Erscheinungsdatum
- 2015 (Februar)
- Note
- 1,3
- Schlagworte
- Präsidentialismus Lateinamerika Regierungssystem Demokratie 20. Jahrhundert
- Produktsicherheit
- BACHELOR + MASTER Publishing