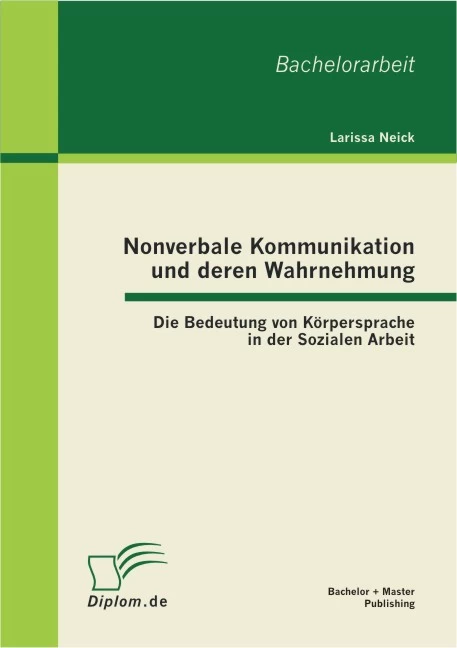Nonverbale Kommunikation und deren Wahrnehmung: Die Bedeutung von Körpersprache in der Sozialen Arbeit
Zusammenfassung
Dieses Buch möchte es dem Leser ermöglichen, sein Verständnis und sein Bewusstsein über körpersprachliche Signale in der Interaktion zu schärfen. Durch das Wissen um deren Auswirkungen im direkten Kontakt mit Menschen kann das Gegenüber anders wahrgenommen und so auch besser verstanden werden.
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
Danksagung
Einleitung
1. Kapitel – Förderung des (selbst) reflexiven Verständnisses und möglichen Auswirkungen in der Interaktion
1.0 Wie denkt der Mensch?
1.1 Die kognitive Denkentwicklung nach Jean Piaget
1.2 Sinnliche Erfahrungen
1.3 Die Wahrnehmung
1.3.1 Gesetze der Wahrnehmung
1.3.2 Sinne und Wahrnehmung
1.3.3 Das visuelle und auditive System und die Bedeutung der visuellen und auditiven Wahrnehmung/Perzeption
1.3.4 Erfahrungen, Erwartungen und Emotionen im Zusammenspiel mit der eigenen Wahrnehmung
1.4 Fazit des 1. Kapitels im Hinblick auf die Auswirkungen in der Interaktion
2. Kapitel – Kommunikations-, und Interaktionsprozesse unter Betrachtung verschiedener Gesichtspunkte
2.0 Verständnis und Hintergrund der Kommunikation nach Tomasello
2.0.1 Der Ausdruck des Körpers als Kommunikationsprozess
2.0.2 Die verbale Kommunikation
2.0.3 Die Bedeutung des gemeinsamen Hintergrundwissens für die Interaktion
2.1 Forschungsstand über Körpersprache/nonverbale Kommunikation
2.2 Die Körpersprache
2.2.1 Körpersignale als bewusste und unbewusste Teilelemente einer Kommunikation
2.2.2 Die ganzheitliche Wahrnehmung in der Körpersprache
2.2.3 Untersuchung verschiedener körperlicher Ausdrucksformen
2.2.4 Das Enkodieren und Dekodieren in der Körpersprache
2.3 Kulturelle Unterschiede in der Ausdrucksweise körperlicher Empfindungen
2.4 Körpersprache, nonverbale Kommunikation und Interaktion
2.5 Das Zusammenspiel zwischen Körpersprache und verbaler Kommunikation
3.0 Die Bedeutung des Wissens über die Körpersprache in der Sozialen Arbeit
4.0 Schlussbemerkung
Literaturverzeichnis
Anlage 1
Anlage 2
Danksagung
Mein Dank gilt an dieser Stelle zu erst einmal meinen Eltern, worunter ich auch meine Stiefmutter und meinen Stiefvater zähle. Denn diese Menschen haben es mir ermöglicht, da zu stehen, wo ich heute stehe. Ohne ihre großartige Unterstützung und Rückendeckung wäre mir dieser Werdegang so nicht möglich gewesen.
Des Weiteren gilt mein Dank meinen Korrekturleserinnen Ruth Echle und
Birgitt Reisenauer.
Auch meiner Bachelormutter Frau Professor Dr. Ute Koch möchte ich danken. Denn nur durch die Gespräche und Anreize ihrerseits steht nun die Bachelorarbeit so da, wie sie dastehen soll. Auch ihre Offenheit bezüglich meiner Themenwahl weiß ich sehr zu schätzen.
Meinen Studiengangsleiter Professor Paul-Stefan Ross möchte ich an dieser Stelle auch erwähnen und ihm danken. Er half mir, mein Thema einzugrenzen, um es mir so zu ermöglichen, mich in dem geforderten Rahmen zu bewegen und die Fragestellung dennoch bearbeiten zu können. Auch ihm danke ich für das Verständnis mit welchem er mir begegnete.
Ebenso danke ich meiner Vorgesetzten Frau Schwarz-Österreicher. Sie gab mir während der Praxisphase jeglichen Freiraum, den ich zur Erstellung dieser Thesis benötigte und hatte wertvolle Tipps, die mein Denken anregten und die Thematik bereicherten.
Abschließend gilt mein Dank vielen weiteren Freunden und Kommilitonen. War dies doch eine Zeit, in welcher wohl der Einzelne froh war, zu einem großen Ganzen zu gehören, das auffängt, wenn nötig, und das Mut und Motivation spendete.
Einleitung
Soziale Arbeit in ihrer Profession hat in der Regel mit Menschen zu tun. Menschen in verschiedensten Lebenslagen. Menschen unterschiedlichsten Alters und Herkunft. Zumeist sind diese Menschen auf fachliche Unterstützung des Sozialarbeiters angewiesen. Um für Adressaten und Adressatinnen angemessene Hilfen auszuwählen und sich dabei bestmöglichst an den individuell vorhandenen Ressourcen zu orientieren braucht der Sozialarbeiter ein hohes Spektrum an Wissen.
Und genau an dem Punkt möchte die nachfolgende Arbeit anknüpfen. Jeder zwischenmenschliche Kontakt läuft innerhalb einer Interaktion ab. Menschen kommunizieren miteinander auf die unterschiedlichste Weise. Ein Großteil dessen findet jedoch unbewusst über körperliche Signale statt.
Wenn also die Soziale Arbeit durch ihr Alltagshandeln mit vielen Menschen in Berührung kommt, warum wird dann genau diesem Punkt nicht mehr Aufmerksamkeit geschenkt?
„Das Bewusstsein des anderen beginnt in unserem eigenen Bewusstsein.“
(Otterstedt 2005, S. 22)
Aus diesen Gründen entstand die Motivation zur Bearbeitung des vorliegenden Themenkomplex. Die Autorin möchte mit dem ausgewählten Sachverhalt es dem Leser ermöglichen, sein Verständnis und sein Bewusstsein über körpersprachliche Signale in der Interaktion zu schärfen. Durch das Wissen um deren Auswirkungen im direkten Kontakt mit dem Menschen kann das Gegenüber anders wahrgenommen werden. Und so nach Ansicht der Autorin auch besser verstanden werden. Die Körpersprache ist in allen zwischenmenschlichen Bereichen vorhanden, weswegen ihr mehr Beachtung geschenkt werden sollte. In den vergangenen Jahrzehnten gab es eine Reihe an Forschungsprojekten, die sich allerdings hauptsächlich an den Bereichen der Wirtschaft, des Erreichens von Toppositionen oder an dem Erfolg im Beruf orientierten. Auch Soziologen, Sozialpsychologen oder Sprachwissenschaftler fanden Interesse an dem Thema und beleuchteten es von verschiedenen Seiten. Heute findet sich allerdings kaum noch Literatur in der sozial kommunikativen Forschung. Vorgezogen wurde die Erforschung von verbaler Kommunikation, Kommunikationsmodellen und Sprachbildern. Die Körpersprache kann jedoch auch nicht losgelöst von der verbalen Kommunikation betrachtet werden, wenn von einem Interaktionsprozess ausgegangen wird. Und da die Soziale Arbeit mit Klienten und Klientinnen immer in einem solchen Kontext statt findet, wird in nachfolgender Arbeit die Kommunikation unter beiden Gesichtspunkten betrachtet. Doch nicht nur das. Um einen Menschen in seiner Ganzheitlichkeit zu verstehen gilt es in erster Linie auch sich selbst zu verstehen. Denn die Interaktion ist immer eine wechselseitige Beeinflussung der Menschen untereinander. Nur durch das sich Bewusst werden über gewisse psychische Vorgänge kann ein Verständnis für die Interaktion und den darin ablaufenden Kommunikationsprozessen gewährleistet werden.
Aufgrund dessen ist der Themenkomplex in verschiedene Kapitel unterteilt. Diese sollen es dem Leser vereinfachen, einen Zugang zu dieser auf zwei Ebenen aufgebauten Arbeit zu erlangen.
Im ersten Kapitel geht es um die Förderung eines selbstreflexiven Verständnisses durch die Darstellung verschiedener intrapersonal ablaufender Prozesse. Dies soll dem Leser ermöglichen Auswirkungen auf die Interaktion zu erkennen und sein Bewusstsein für diese zu schärfen. Hierfür ist es notwendig zu wissen, wie die Denkprozesse des Menschen aufgebaut sind und sich diese im Lauf des Lebens erweitern. Deswegen erfolgt einführend ein Exkurs über die Funktionsfähigkeit des Gehirns um anschließend auf die kognitive Denkentwicklung und den Ausbau von Denkschema eingehen zu können. Eng hiermit verbunden sind die sinnlichen Erfahrungen über welche es dem Menschen möglich ist, sich seine Umwelt anzueignen. Dies erfolgt über die subjektive Wahrnehmung. Da die Wahrnehmung des Gegenübers in jeder Interaktion eine entscheidende Rolle spielt, wird der Ausschnitt näher betrachtet. Es geht nicht nur um die Verbindung zwischen sinnlichen Erfahrungen durch die Wahrnehmung, sondern auch darum, welchen gegebenenfalls trügerischen Faktoren die eigene Wahrnehmung unterliegen kann. Und da in der face-to-face Interaktion Informationen hauptsächlich über das Gespräch erfolgen und Eindrücke dadurch entstehen, wie man sein Gegenüber wahrnimmt, wird auch auf die Verbindung des visuellen und auditiven Systems mit der Wahrnehmung eingegangen werden. Denn Voraussetzung für jegliche Kommunikationsprozesse ist in erster Linie das sinnliche wahrnehmen des Interaktionspartners. Dass der Mensch andere Menschen jedoch nie losgelöst von seinen bisher gemachten Erfahrungen erleben kann, wird ebenso deutlich gemacht. Oftmals, gerade in der Sozialen Arbeit im Kontakt mit einer bestimmten Adressatengruppe, wird man mit Hypothesen von außen konfrontiert. Oder aber die Adressaten selbst kommen bereits mit einer vorgefertigten Meinung zum Sozialarbeiter. Und nicht zuletzt hat der Sozialarbeiter an sich eine bestimmte Erwartungshaltung an seine Klienten. Wodurch solche Mechanismen entstehen und was benötigt wird ,um diesen entgegen zu wirken und wie stark die Bildung solcher auch von der eigenen Wahrnehmung abhängt, wird am Ende des ersten Kapitels in der Hypothesentheorie erläutert. Abschließend hat die Autorin ein Fazit verfasst um für den Leser die komplexen Komponenten noch einmal in Verbindung zueinander zu bringen und aufeinander zu beziehen. Hierdurch soll die Bedeutung dieser Wissensbestände für den Interaktionsprozess kenntlich gemacht werden.
Im zweiten Kapitel werden unter verschiedenen Gesichtspunkten kommunikative Abläufe in der Interaktion betrachtet. Einführend erfolgt die Darstellung der Hintergründe und der Ursprünge der menschlichen Kommunikation unter Einbezug rein körperlicher und rein verbaler Ausdrucksformen. Doch auf was beruft sich eigentlich der Kommunikationsprozess? Können alle Menschen sich verständigen oder benötigen wir ein gemeinsames Hintergrundwissen um überhaupt miteinander in Kommunikation treten zu können? Diesen Fragestellungen wird im Anschluss in Verbindung mit der Interaktion nachgegangen werden. Eine Begriffsbestimmung und nähere Unterteilung in die verschiedenen Aspekte der Kommunikation erfolgen bei der Betrachtung des Forschungsstandes über Körpersprache und nonverbale Kommunikation. In diesem Abschnitt wird ebenfalls geklärt, seit wann die Menschen sich mit körperlichen Ausdrucksformen beschäftigen. Und da zwei Drittel jeglicher Kommunikationsabläufe über die Körpersprache statt finden, auch wenn viele dieser Signale nur unbewusst wahrgenommen werden, ist dieser Unterpunkt in der Interaktion von großer Bedeutung. Deswegen werden die bewussten und unbewussten Teilelemente sowie die ganzheitliche Wahrnehmung der Körpersprache näher dargestellt. In der Sozialen Arbeit geht es nicht zuletzt darum, den Anliegen des Klienten gerecht zu werden und seine Bedürfnisse zu erkennen. Ein Sozialarbeiter kann dieses Verständnis für den Adressaten fördern, indem er nicht nur auf das Gespräch sondern auch auf die Körpersprache achtet. Aufgrund dessen werden verschiedene körperliche Ausdrucksformen, wie die Beruhigungsgesten und die Augenstellung näher untersucht. Dies sind zwei wichtige Elemente, die während der Kommunikation erkannt werden können und dem Sozialarbeiter gegebenenfalls Aufschluss darüber geben wie sich der Klient in der Interaktion fühlt. Da im ersten Kapitel auf die Wahrnehmung eingegangen wird, soll nun eine Verbindung zur Körpersprache hergestellt werden. Dies zeigt sich im Unterpunkt des En- und Dekodierens. Nicht immer fällt es leicht, ankommende Signale auch so zu interpretieren wie sie vom Gegenüber gemeint waren. Vor allem, wenn die Körpersprache durch kulturelle Gegebenheiten unterschiedlich geprägt wurde. Emotionen werden nicht in allen Kulturen auf gleiche Weise geäußert. Da es jedoch genau das ist, worüber der Sozialarbeiter einen Zugang zu seinen Klienten findet, wird zum einen auf verschiedene Ausdrucksweisen von körpersprachlichen Signalen und zum anderen auf die Entstehung dieser Unterschiede eingegangen. Um aufgrund dessen Missverständnisse, welche sich unter Umständen auf die Interaktion auswirken können, zu vermeiden, stellt die Autorin für eine differenziertere Wahrnehmung des Lesers noch die Gründe dar, warum es zu einer Fehldekodierung dieser Signale kommen kann. In der Interaktion kann mit dem Wissen über diese Hintergründe auf Menschen mit Migrationshintergrund über ein differenzierteres Verständnis auf eine andere Weise eingegangen werden. Gegebenenfalls kann hierdurch der Zugang erleichtert werden. Des weiteren wird ein Modell dargestellt, welches die Komponenten der Körpersprache und der nonverbalen Kommunikation in der Interaktion miteinander verbindet. Doch läuft der zwischen-menschliche Kontakt zumeist nicht ohne das Gespräch ab, weswegen abschließend das Zusammenspiel von Körpersprache und verbaler Kommunikation betrachtet werden soll.
Zielsetzung ist es, durch die Kombination beider Kapitel eine aufschlussreiche Vermittlung von immer ablaufenden unbewussten Elementen in jedem Interaktionsprozess zu erlangen.
Im dritten Punkt der vorliegenden Arbeit möchte die Autorin auf die Bedeutung der Körpersprache in der Sozialen Arbeit eingehen und eruieren, inwieweit diese in das Alltagshandeln des Sozialarbeiters eingebunden ist. Es soll auch betrachtet werden, ob die Auswirkungen in der Kombination zwischen verbaler Kommunikation und körpersprachlichen Ausdruckserscheinungen in der Sozialen Arbeit bedacht wird. Denn wie eingangs erläutert, laufen zwei Drittel des Kommunikationsprozesses nonverbal ab. Da die Profession der Sozialen Arbeit aus der Hilfe für andere Menschen entstanden ist und aus diesem Kontext heraus der Kontakt mit Menschen offensichtlich ist, müssten demnach die körperlichen Ausdrucksformen des Klienten ein wesentlicher Bestandteil des Fachwissens sein.
In der Schlussbemerkung findet der Leser ein Fazit der gewonnenen Wissenssequenzen.
In vorliegender Arbeit werden nach Ansicht der Autorin einige der wichtigsten Themengebiete im Umgang mit anderen Menschen aufgegriffen. Diese können jedoch aufgrund des Umfangs nicht in ihrer ganzen Bandbreite dargestellt werden, sondern sollen dem Leser einen Einblick in die verschiedenen Teilbereiche der Kommunikation während der Interaktion ermöglichen.
1. Kapitel – Förderung des (selbst) reflexiven Verständnisses und möglichen Auswirkungen in der Interaktion
1.0 Wie denkt der Mensch?
Das Gehirn des Menschen ist ein komplexes Gebilde. Die körperinneren Signale, alle Vitalfunktionen wie Durst, Schlaf, Hunger und Sexualität sowie die von außen einströmenden Reize werden von der Steuerzentrale im Gehirn entziffert und geordnet. Ungefähr 100 Milliarden Nervenzellen tauschen ununterbrochen biochemische Signale aus und treten durch weitere 100 Billionen Synapsen miteinander in Kontakt. Würde man diesen Vorgang ausrechnen, so würde die Anzahl der Verbindungen im Gehirn die Gesamtzahl aller bisher bekannten Atome im Universum übersteigen (vgl. Wirth 2010, S. 28f.). Bereits in einem Fötus entstehen zu jeder Minute 250 000 neue Nervenzellen (vgl. Bahnsen 2009, S. 15). Die Entwicklung des zentralen Nervensystems und des Gehirns bilden das Fundament für die weitere Verhaltensentwicklung des Menschen. Ursprung allen Denkens, Wünschens, Erinnerns, der Gefühle und der Vorstellungskraft ist das Gehirn. Gerade dessen Ausbildung lässt den Mensch zu der Persönlichkeit werden, die er ist (vgl. Siegler/DeLoache/Eisenberg 2008, S.141). Auch wenn die Erkenntnisse des unbekannten Landarztes Marc Dax in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts über den Zusammenhang beider Gehirnhälften in Vergessenheit gerieten, so sind sie heute wieder brandaktuell. Die radikalen Untersuchungen von Roger Sperry´s (Nobelpreisträger für Medizin 1981, tätig am California Institute of Technology), der erstmals die rechte von der linken Gehirnhälfte trennte, ergaben aufschlussreiche Ergebnisse bezüglich der Funktionen beider Seiten. Jede Gehirnhälfte ist für verschiedene Denkvorgänge zuständig, jede besitzt ihre eigene Wahrnehmung, Vorstellung und sogar Gedanken. Jede scheint ihren eigenen Geist zu haben, so Sperry. Die linke Seite des menschlichen Gehirns ist für das digitale Denken wie das Sprechen, Schreiben und Lesen, das wissenschaftliche und mathematische und logische Denken, die Organisation, der Details sowie der Analyse zuständig und besitzt ein eigenes Gedächtnis für Sprache und Wörter. Die rechte Seite umfasst das analoge Denken. Dieses beinhaltet das Denken in Bildern und ganzheitliche Erfahrungen, Musisches wie Kunst, Tanz und Musik, Kreativität und Fantasie. Auch das Gedächtnis für Personen, Dinge und Erlebnisse fällt in den Aufgabenbereich der rechten Hemisphäre (vgl. Wirth 2010, S. 32f.).[1]
So lässt sich sagen, dass die linke Seite des menschlichen Gehirns für das Rationale (von “ratio“: lat. Vernunft, Verstand), also für das von der Vernunft geleitete im Menschen zuständig ist. Das heißt, der Schwerpunkt in der Arbeit dieser Seite liegt in der sachlich-logischen Erfassung der Welt, der eigenen Person und der Mitmenschen. Auch wird sie von Metaphern aktiviert, so dass beim Zuhörer eigene Vorstellungen, Bilder, Symbole und sogar Gerüche entstehen können (vgl. Psychologie-News 2008). Kausale Zusammenhänge dafür werden in der rechten Seite erfasst und geordnet. Demnach kommt die rechte Gehirnhälfte niemals zur Ruhe. Zusammenhänge zwischen Ursache einer Gegebenheit und deren Wirkung werden aus einem Sachverhalt heraus erfasst und am laufenden Band geordnet (vgl. Wirth 2010, S. 30-35).
In diesem Kontext findet man auch den Namen des französischen Philosophen und Mathematikern René Descartes. Unter anderem durch ihn wurde die Epoche der Aufklärung als Aufklärung oder auch als das Zeitalter der Vernunft bezeichnet. Seine Ansichten und Überlegungen stehen zu Beginn dieses Zeitalters. Sein wohl bekanntester Ausspruch damals war “cogito ergo sum – Ich denke, also bin ich“. Hieran anknüpfend folgten Emanuel Kant und Isaak Newton. Beide vertraten die Meinung, dass allem, was neben der Vernunft ent- und besteht, keine größere Bedeutung zugemessen werden kann. Das menschliche Denken wurde hierbei ausschließlich auf die Ratio reduziert. Das philosophische Verständnis bezüglich dem Irrationalen war zweigeteilt, zum einen als etwas mit dem Verstand nicht Fassbares, zum anderen wurde es vielerorts sogar als vernunftwidrig oder gar unvernünftig deklariert (vgl. ebd. 2010, S. 30-35). So erklärt Kant noch in seinem Schriftstück zur Beantwortung der Frage, was Aufklärung ist, diese ganz klar mit dem öffentlichen Gebrauch der eigenen Vernunft (vgl. Kant 1784, S. 55). Gedacht wird außerhalb der Sinnfrage. Digitales Denken ist gleichzusetzen mit kausalem Denken. Die Welt erscheint vorläufig als Chaos. Mittlerweile ist ebenso bekannt, dass die Leistungsfähigkeit des Gehirns gesteigert funktioniert, wenn beide Hälften gleichberechtigt genutzt werden. Irrationalität steht also nicht im Widerspruch zur Vernunft, wie zu früheren Zeiten gedacht, sondern sie steht gleichermaßen für eine ganzheitliche Wahrnehmung des Selbst, der Welt und seiner Mitmenschen, auf objektive sowie subjektive Weise. Denn erst über das irrationale Denken findet der Mensch einen Zugang zu sich selbst, seinen Wünschen, Hoffnungen, seiner Befindlichkeit und seinen Emotionen. Wenn dies gegeben ist, erfährt der Einzelne auch einen Zugang zu seiner Umwelt (vgl. Wirth 2010, S. 33-41).
Die Wissenschaft hat nun belegt, dass das Gehirn des Menschen nach dessen Geburt noch nicht gänzlich ausgereift ist. Es bestehen jedoch bereits hier die ungefähr hundert Milliarden Nervenzellen, die sich wiederum über mehr als hundert Billionen synaptischer Verbindungen zu einem Gesamtnervensystem zusammenschließen (vgl. Spektrum der Wissenschaft 2002, S. 65). Diese weiten sich jedoch rasch in den ersten vier Monaten nach der Geburt aus, weswegen diese Zeit eine entscheidende Rolle spielt. Hierfür vorteilhaft sind möglichst viele Reize von außen, damit sich spezielle Gänge und Windungen im Gehirn ausbilden können und ein größerer Erfahrungsradius verinnerlicht werden kann (vgl. Molcho 1992, S. 22). Demnach entwickelt sich das menschliche Denken durch ein Zusammenspiel zwischen Anlage und Umwelt. Das heißt, manche Aspekte der Entwicklungsprozesse hängen von den Genen, andere wiederum von den gemachten Erfahrungen ab. Der neuropsychologische Ansatz von Adele Diamond zeigt ebendies auf. Sie untersuchte und beobachtete Kinder und Affen, vor welchen sie ein begehrtes Objekt versteckte und sie anschließend danach suchen ließ.[2]Bereits nach einer kurzen Zwischenzeit waren beide Probandengruppen in der Lage, dieses Objekt wiederzufinden. Während eines weiteren Durchgangs wurde der gleiche Gegenstand erneut unter der Beobachtung des Kindes und des Affen an einem neuen Ort versteckt. Fälschlicherweise griffen beide zuerst in das vorherige Versteck, obwohl sie beobachtet hatten, dass der Gegenstand an einem anderen Ort versteckt worden war. Deswegen kam Diamond zu dem Entschluss, dass die Erfahrung bzw. die Erinnerung die primären, zuerst auslösenden Impulse zu einer Handlung in diesem Alter sind und noch nicht der eigentliche Denkprozess (vgl. Siegler/DeLoache/Eisenberg 2008, S. 145ff.).
Mit diesem Vorwissen wird nun überleitend auf die Theorie der kognitiven Denkentwicklung von Jean Piaget eingegangen, die erklären soll, wie Denkvorgänge im Menschen heranreifen, sich ausbauen und schlussendlich zu einer Handlung führen.
1.1 Die kognitive Denkentwicklung nach Jean Piaget
Die Erkenntnisse dieser Theorie zur Denkentwicklung entstammen der jahrelangen Beobachtung und Forschung Piagets an Säuglingen, Kindern sowie Jugendlichen aus westlichen Kulturen. Aus seinen Untersuchungen konnte sich eine gewisse Gesetzmäßigkeit in der Erkenntnistheorie ableiten lassen. Er fand heraus, dass immer die gleichen Etappen in der Denkentwicklung durchlaufen werden (vgl. Oesterdiekhoff/Rindermann 2008, S. 80f.). Piaget geht davon aus, dass der Mensch die angeborene Tendenz besitzt, einerseits den eigenen Organismus an die Erfordernisse und Gegebenheiten der Umwelt anzugleichen und andererseits ebendiese subjektiv erlebten Umwelteindrücke wiederum an den Organismus anzupassen. Diesen wechselseitigen Vorgang der Anpassung beschreibt er als Adaption. So hat jeder Mensch das ihm innewohnende Verlangen nach Organisation der äußeren Reize, um so das Erlebte zu strukturieren und zu systematisieren. Zudem versucht der Mensch, Ganzheiten zu bilden, um so Beziehungen zwischen einzelnen Teilgegenständen und -bereichen herstellen zu können. Ein Kind, das mithilfe eines Kartons Autofahren spielt, hat demnach die Gegebenheiten der Umwelt an seine eigenen Handlungsmöglichkeiten angepasst. Sieht jedoch beispielsweise eben dieses Kind zum ersten Mal einen Hund und kannte bislang aber nur Katzen, so muss es lernen, dass nicht alle Vierbeiner Katzen sind. Somit erfolgt hierbei eine Angleichung des Kindes an die Umwelterfordernisse (vgl. Hobmair u.a. 1997, S. 214f.). Dies geschieht nach Piaget anhand der sogenannten kognitiven Schemata. Hierunter versteht er Einrichtungen des Menschen beziehungsweise des Organismus, die es ermöglichen, Umwelteindrücke einzuordnen. Hierdurch ist der Einzelne befähigt, seine Erfahrungen zu systematisieren. Erst durch die Verbindung von verschiedenen Schemata gelingt ein für das Individuum befriedigender Austausch mit der Umwelt. Jedoch ist dies kein “allgemein anerkannter verbindlich ablaufender“ Prozess. Was für den Erwachsenen als einleuchtend erscheint, muss es für das Kind in keinster Weise sein (und umgekehrt) (vgl. Plassmann/Schmidt o.J.). So hat das Kind in oben genanntem Beispiel zuerst gelernt, dass ein kleines, flauschiges Tier mit langem Schwanz und vier Beinen immer eine Katze ist. Nun lernt es, dass ein vierbeiniges, flauschiges Tier mit langem Schwanz ein Hund ist, wenn es größer ist und eine andere Kopfform hat. Ein neues Klassifikationssystem wird anhand eines oder mehrerer neuer Kriterien aufgestellt, in unserem Beispiel dem Tier + größer + andere Kopfform (vgl. Universität Duisburg-Essen Publications online o.J., S. 6). Diesen organisierten Vorgang der Verbindung von Schemata bezeichnet Piaget als Strukturen. Mit nur einem einzelnen Schema könnte der Mensch ebenso wenig zustande bringen wie mit vielen miteinander unverbundener Schemata. Nur die organisierte Verbindung, also die Strukturen, ermöglichen einen befriedigenden Austausch zwischen dem Individuum und der Welt. Wie aufgezeigt passt sich das menschliche Denken den Erfordernissen der Umwelt an. Aufgrund der Ausweitung und den im Laufe der Zeit immer komplexer werdenden Strukturen ist es dem Einzelnen möglich, auch mit komplizierteren Umweltbedingungen zurecht zu kommen (vgl. Hobmair u.a. 1997, S. 214ff.).
Vorausgehend für jenen Prozess ist ein Streben des Menschen nach einem Gleichgewichtszustand zwischen ihm und der Umwelt. Dieses Streben setzt immer dann ein, wenn die Anforderungen oder auch Bedingungen der äußeren Welt sich verändern oder nicht mehr mit den bereits bestehenden kognitiven Schemata übereinstimmen und demnach die Bewältigung schwer fällt. Eine Anpassung geschieht nach Piaget anhand zweier gegenläufigen Teilprozesse. Die Assimilation steht hierbei für den Prozess der Anpassung bzw. Integration der Umwelt an bereits bestehende kognitive Schemata oder Strukturen (zum Beispiel wird der Hund zuerst als Katze bezeichnet, da das Kind dieses Tier als erstes kannte). Das allein ist jedoch nicht ausreichend, da der Organismus laufend auf Gegebenheiten der Umwelt gestoßen wird, für welche seine bereits aufgebauten Schemata nicht genügen. Deswegen, und um Fehlanpassungen zu vermeiden, überprüft der Mensch seine kognitiven Schemata und ändert sie ab, differenziert und erweitert sie. Dieser Vorgang nennt sich Akkommodation und ermöglicht eine bessere Abstimmung und Koordination der Denkprozesse (Beispiel Erweiterung der Schemata, Erkennung des Hundes als Hund). Jeder Schritt in der kognitiven Entwicklung stellt einen Zusammenschluss zwischen diesen assimilativen und akkommodativen Prozessen dar. Der aktuelle Gleichgewichtszustand ist nie an alle Gegebenheiten angepasst und ist deshalb immer als fließend zu verstehen (vgl. ebd. 1997, S. 215ff.). Piaget nennt das den Prozess der Kontinuität. Assimilation, Akkommodation und die Herstellung eines Gleichgewichts zwischen diesen beiden ist der Prozess der Äquilibration. Nur durch dieses kann das Verständnis für die Welt und das Selbst im Menschen geschaffen werden. Hierzu gehören drei Phasen: das Akzeptieren des eigenen Verständnisses eines Phänomens (Äquilibrium: es besteht keine Diskrepanz zwischen den eigenen Erfahrungen und den eigenen Verständnisstrukturen). Im zweiten Schritt wird jedoch bemerkt, dass das eigene Verständnis des Phänomens unzureichend ist und noch keine kognitive Alternative vorhanden ist, um ein besseres Verständnis zu ermöglichen. Dies nennt man den Zustand des Disäquilibriums. In der 3. Phase werden die Unzulänglichkeiten der bisherigen Verständnisstrukturen nicht nur unbewusst “erfühlt“, sondern auch erkannt und durch ein differenziertes Verständnis und den Aufbau weiterer Schemata überwunden (vgl. Siegler/DeLoache/Eisenberg 2008, S.180-183). Mit dem Ausbau von Denkprozessen wird dieser Zustand stabiler und differenzierter.
Piaget führt seine Theorie noch weiter aus und benennt vier Stadien der kognitiven Entwicklung, welche hier nur zur Vollständigkeit erwähnt werden, jedoch im weiteren Verlauf bei der Thematisierung “Körpersprache und verbale Kommunikation“ nur eine untergeordnete Rolle spielen. Das erste Stadium, die sensomotorische Intelligenz, reicht von der Geburt bis ins zweite Lebensjahr. Hier verfügt der Säugling über eine Art von Handlungswissen ähnlich wie in Diamonds Beobachtungen beschrieben. Durch sensorische und motorische Handlungen eignet sich der Säugling bzw. das Kind Wissen über seine Umwelt an und lernt, diese zu begreifen. Im Übergang zum zweiten Stadium, dem präoperativen Denken, steht die Ausbildung der internen Repräsentation von Objekten und der Umwelt. Dadurch entsteht ein stabiler Objektbegriff. Auch die Nachahmung beobachtbarer Handlungen fällt in diese Zeitspanne, die bis zum Schuleintritt anhält. Wichtig hierbei zu erwähnen ist, dass in diesem Stadium die Sprache übernommen und angeeignet wird.[3]Das dritte Stadium der Denkentwicklung ist die konkret-operatorische Phase. Diese durchläuft das Kind zumeist im Alter zwischen sechs und 12 Jahren. Logische Regeln und ein System miteinander zusammenhängender und verinnerlichter Handlungen, von Piaget als Operationen bezeichnet, bestimmen diesen Entwicklungsschritt. Aufgrund der Fähigkeit des operatorischen Denkens erhält der Mensch mehr und mehr sehr viel stabilere und flexiblere Umwelterkenntnisse. Bis ins Erwachsenenalter steht die kognitive Entwicklung in der Phase der formallogischen Operationen, was heißen soll, dass der Mensch nun fähig ist, reflexiv und in Hypothesen zu denken. Das Denken wird hier bestimmt durch einen hypothetisch-deduktiven Charakter, sprich: dem Denken über real in der Umwelt vorgefundene Gegebenheiten hinaus. Abschließend anzumerken gilt bei diesen vier Stadien, dass die Altersangaben nur Richtwert und nicht als festgelegte Maxime zu verstehen sind (vgl. Arbinger 2005, S. 1-7).
Piagets Theorie bietet einen Erklärungsversuch, wie der Mensch sich von Beginn an in ständigen Denkprozessen mit seiner Umwelt auseinandersetzt und sich diese aneignet, um somit auch Teil von ihr zu werden.[4]
Es wurde aufgezeigt, wie der Mensch von gewissen Schemata durch intrapersonale Denkprozesse zu einem System von Weltwissen gelangt, indem er sich die Umwelt aneignet. Denn Wissen entsteht zum einen durch Handeln und Erinnern, wie in Diamonds neuropsychologischem Ansatz erörtert wurde, und zum anderen durch das Wahrnehmen ebendieser Handlung. Die Begriffsbildung als Symbol oder Wort verfestigt sich anschließend im menschlichen Gedächtnis, wenn sich das Handlungsschema innerlich in einer gewissen Transparenz abspielt und anschließend durch die sprachliche Benennung objektiviert wird. So entsteht aus dem Schema des Handelns und Operierens, wie bei Piaget erläutert, und der Begriffsbildung ein System, durch das die Welt dem Einzelnen erklärbar und verständlich erscheint (vgl. Aebli 1994, S. 195ff.).
Doch bevor dies hier näher ausgeführt wird, gilt es, die Sinneswahrnehmung des Menschen ebenso zu betrachten, um schlussendlich zu einem ganzheitlichen Verständnis der hier einzeln dargestellten Teilaspekte zu gelangen.
1.2 Sinnliche Erfahrungen
Die Sinne sind gleichzusetzen mit Antennen, über die der Mensch fähig ist, seine Umwelt wahrzunehmen, mit ihr in Kontakt zu treten und sie so in sich aufzunehmen. Sie sind der Zugang zur Welt und zur eigenen Erfahrung. Nur durch diese kann die Welt auch wieder neu aufgebaut und verstanden werden. Die sinnliche Wahrnehmung stellt einen aktiven Prozess dar, der jeden Menschen dazu befähigt, sich seine Umwelt anzueignen und sich mit deren Gegebenheiten auseinander zu setzen (vgl. Zimmer 2005, S.16).
Nur durch die Sinne ist der Prozess der Entwicklung kognitiver Schemata, wie von Piaget beschrieben, möglich. Durch die Sinne können Umwelteindrücke erst aufgenommen und während der vier Stadien Piagets ausgebaut bzw. zur Klarheit des Denkens und zum Verständnis der eigenen Umwelt ausgebildet werden.
Bevor sich ein Kind sprachlich mitteilen kann, erfährt es durch das Greifen nach einem Objekt auch ein Begreifen, und durch das Anfassen ein Erfassen des Objektes. Somit, und anhand der gemachten Erfahrungen über räumliche Beziehungen, erlangt das Kind Wissen. Nur durch den konkreten Umgang mit Dingen kann ein Kind innere Bilder aufbauen. Die Wirklichkeit muss im Kindesalter erst im wahrsten Sinne des Wortes gespürt werden, damit in der weiteren Entwicklung des Denkens die Zusammenhänge begriffen werden können. Das kann nur gelingen, wenn das Kind möglichst früh viele Erfahrungen sammeln kann, die zu einem späteren Zeitpunkt und mit fortschreitenden Denkprozessen wiederum zu Erkenntnissen werden (vgl. Zimmer 2005, S. 17). Auch die Koordination verschiedener Sinne erfolgt bereits ab dem 4. Lebensmonat, wie durch Untersuchungen mithilfe der visuellen Präferenz festgestellt werden konnte. So kann ein Kleinkind bereits in diesem Alter eine weibliche Stimme auch einem weiblichen Gesicht und eine männliche Stimme einem männlichen Gesicht zuordnen. Auch die Stimme der Eltern wird wiedererkannt. Selbst die Stimmlage und darin widergespiegelte Emotionen lösen bei dem Kind bereits Koordinationsleistungen der aufnehmenden Sinne aus und haben bestimmte Reaktionen zur Folge (vgl. Arbinger 2005, S. 52). Unterschwellig sensible Reize werden durch die Sinnesorgane des Menschen aufnehmbar. Diese Informationen gelangen durch afferente (aufsteigende oder zuleitende) Bahnen ins zentrale Nervensystem und unterscheiden sich je nach Reiz. Hier entsteht eine subjektive Wahrnehmung, die über die motorischen Nervenbahnen eine Reaktion in den Effektorganen, sprich den Muskeln, auslöst. Dieser Vorgang wird als Reiz-Reaktions-Kette bezeichnet (vgl. spomedial e.V. 2009). Jedoch werden aus der Vielzahl der Einzelerregungen nur solche beachtet, die einen gewissen Schwellenreiz übersteigen. Demnach werden die durch die Sinnesorgane aufgenommene Reize selektiert. Zellen, die Reize aufnehmen können, werden Rezeptoren genannt. Diese sind auf bestimmte Reize spezialisiert, wie zum Beispiel die Geschmacksrezeptoren der Zunge oder die Lichtrezeptoren auf der Netzhaut des Auges. Ähnliche Sinneseindrücke wie das Hören, Tasten oder Sehen, die durch dasselbe Organ aufgenommen werden, nennt man Modalitäten. Diese Sinnesmodalitäten meinen sowohl Eindrücke, die von außen auf den Menschen treffen, als auch Zustände, die den eigenen Körper betreffen, wie die Wahrnehmung der Gliedmaßen oder des Spannungszustandes der eigenen Muskulatur. Die Intensität des Sinneseindruckes, also die Stärke des Reizes, bezeichnet man als Quantität (vgl. Zimmer 2005, S.40ff.).
Es ist an dieser Stelle zu erwähnen, dass trotz der neurophysiologischen und der wahrnehmungspsychologischen Gegebenheiten ein Mensch hinter allen Sinneserfahrungen steht. Denn das Wahrnehmen, welches anschließend ein gewisses Verhaltenssystem zur Folge hat, hängt auch von vielen anderen Aktivitäten und Gegebenheiten des menschlichen Körpers ab (vgl. Aebli 1994, S. 304f.). Somit kann nicht davon ausgegangen werden, dass es sich bei der Beschreibung von Sinnessystemen nur um rein physiologische Vorgänge handelt. Subjektive Gefühle beeinträchtigen die Sinneswahrnehmung. Auch eine strikte Trennung der unterschiedlichen Sinnessysteme erfolgt nicht, da sie zusammenarbeiten und die Informationen der Umwelt meistens über mehrere Sinne gleichzeitig gewonnen werden (vgl. Zimmer 2005, S. 59ff.). Das ist wiederum auf die Lernprozesse, die unter anderem durch die kognitive Entwicklung ermöglicht werden, zurückzuführen (vgl. Schönhammer 2009, S. 231).
Wie bereits erwähnt spielt hierbei die eigene Wahrnehmung des erlebten Reizes eine wichtige Rolle und schließt den Kreis zur Kognitionspsychologie. Deswegen soll im Folgenden der Prozess der Wahrnehmung erläutert werden, um im späteren Verlauf das Zusammenspiel zwischen der Wahrnehmung und den Sinneseindrücken näher zu betrachten.[5]Denn schon John Locke meinte in seinem Buch mit dem Titel „Versuch über den menschlichen Verstand“ dass nichts in eben diesem sein kann, das nicht vorher schon seinen Platz in den Sinnen gefunden hätte (vgl. Wirth 2010, S. 67).
1.3 Die Wahrnehmung
Wie bereits zuvor beschrieben besteht eine der wichtigsten Aufgaben des Gehirns darin, die einströmenden Reize zu kanalisieren und zu sortieren. Diese können im Anschluss mit den bereits vorhandenen Informationen verglichen werden, was wiederum eine angemessene Reaktion herbeiführt (vgl. Zimmer 2005, S.43). Um diesen Prozess auszulösen, müssen die Reize wahrgenommen werden weswegen auch nur subjektiv wahrgenommen werden kann. Denn menschliche Wahrnehmung ist immer zugleich auch die eigene Interpretation der Außenwelt (vgl. Wirth 2010, S. 67). Aus der Flut von Eindrücken, die auf die Sinnesorgane treffen, wird nur ein Bruchteil ausgewählt. Welche der Organismus aufnimmt, hängt von verschiedenen Faktoren ab, zum Beispiel von der Beschaffenheit der Sinnesorgane. Die Psychologie versteht unter Wahrnehmung einen Prozess der Informationsgewinnung sowie der anschließenden Verarbeitung dieser Reize aus dem Körperinneren oder der Umwelt. Reize aus der Umwelt können die Wahrnehmung von Tieren, Mitmenschen oder Objekten sein (=Umweltreiz). Reize aus dem Körperinneren sind zumeist die Wahrnehmung von Schmerzen oder Gefühlen (=Körperreiz). Die Reizverarbeitung findet im Gehirn statt. Reize werden aufgenommen, ausgewertet, verarbeitet und teilweise gespeichert. Dieser Prozess ermöglicht so eine Antwort auf die Reize, eine Reaktion des Erlebens oder eine Reaktion die sich in einem bestimmten Verhalten ausdrückt (vgl. Hobmair u.a. 1997, S.82f.).
Hierbei wird in der Kognitionspsychologie der behavioristischen Schule dasS-O-R-K-C-Modell von Kanfer und Phillipps zur Erklärung der Entstehung eines Verhaltens auf diesem Weg angewandt. DasSsteht für einenStimulus, also den eingehenden Reiz. Obezeichnet die Vorgänge imOrganismus (z.B. individuelle Faktoren wie Stimmung), die dann wiederumR,eine gewisseReaktion, auslösen. Kist dasKontingenzverhältnis, das heißt die Wahrscheinlichkeit der Häufigkeit des Auftretens dieser Reaktion mit der darauffolgenden Verstärkung der Verbindung zwischen der Reaktion und den darauf folgendenConsequences (=Konsequenzen) (vgl. Studt/Petzold 1999, S. 49ff.).[6]
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 1: Das S-O-R-C-K-Modell (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Abb. 05_125)
Die Fortschritte in den Erkenntnissen über die Wahrnehmung und die frühen Empfindungen bekräftigen, dass bereits die Sinnessysteme von Neugeborenen bis zu einem gewissen Grad funktionsfähig sind. Die darauffolgende Weiterentwicklung dieser geschieht enorm schnell. Damit zusammenhängend sind auch die auf einen wahrgenommen Reiz folgenden Empfindungen. Die Informationen aus der äußeren Welt, sprich Umweltreize, durch Rezeptoren in den Sinnesorganen ins Gehirn weitergeleitet und dort von Neuronen verarbeitet (vgl. Siegler/DeLoache/Eisenberg 2008, S. 241f.).[7]
Empfindungen entstehen unter anderem durch individuelle und soziale Faktoren der Wahrnehmung. Sie können jedoch ebenso Ursache für eine verzerrte oder verfälschte Wahrnehmung sein. Individuelle Faktoren äußern sich anhand der Persönlichkeitsmerkmale des Menschen.
Beispiele für die Veränderung der Wahrnehmung durch individuelle Faktoren:
- Gefühle: ist der Mensch verliebt, so nimmt er seine Umwelt anders wahr als in unglücklichem Zustand. Vor der Bescherung an Weihnachten malt ein Kind den Weihnachtsmann größer als nach der Bescherung, da es aufgeregt ist.
- Erfahrungen: trifft der Mensch zufällig in seinem Bekanntenkreis auf einen Menschen, der ihm als Politikerin/Politiker vorgestellt wird, so fließen alle Erfahrungen, die er bisher mit Politikern gemacht hat, in die Wahrnehmung dieses Menschen mit ein.
- Stimmungen: Menschen mit guter Laune deuten uneindeutige Gesichtsausdrücke anderer eher als positiv. Schlecht gelaunte nehmen diese eher als negativ wahr.
- Bedürfnisse & Triebe: Mit leerem Magen kauft der Einzelne im Supermarkt mehr ein als wenn er gerade gegessen hat.
Wie bereits erwähnt spielen auch soziale Faktoren in der Subjektivität der Wahrnehmung eine Rolle. Das sind die Wert- und Normvorstellungen der Gesellschaft, in der das Individuum lebt, sowie deren Einstellungen und Vorurteile (vgl. Hobmair u.a. 1997, S.87ff.). Die Psychologen Bruner und Goodmann beobachteten dazu in einem Experiment zwei Gruppen zehnjähriger Kinder, von denen eine Gruppe eine reiche, die andere eine arme Herkunft hatten. Beide Gruppen erhielten verschiedene Geldmünzen, deren Wert sie schätzen sollten. Alle Kinder überschätzten den Wert der Münzen, größere wurden als wertvoller eingestuft. Die Kinder mit einer ärmeren Herkunft überschätzten den Wert anhand der Größe der Münzen jedoch deutlich (vgl. Rierdan/Wapner 1974). Damit wurde aufgezeigt, dass bei Menschen, die keine finanzielle Not kennen, eine andere Einstellung zu Geld vorzufinden ist als bei Menschen, die es gewohnt sind, sparen zu müssen. Diese Verfälschungen der Wahrnehmung können zur Bestätigung von Stereotypen oder gar Vorurteilen beitragen (vgl. Hobmair u.a. 1997, S. 90). Das kann, so Conradi, auch anhand der Wahrnehmung des körperlichen Erscheinungsbildes und nicht des Organismus als biologische Tatsache, bis in gesellschaftliche Diskriminierung münden (vgl. Conradi 2008, S. 45). Der Begriff Wahrnehmung beinhaltet auch das Wort „wahr“. Die Wahrheit und der Ausdruck der Wirklichkeit liegen im deutschen Sprachgebrauch sehr nah beieinander. Doch wie anhand der individuellen und sozialen Faktoren verdeutlicht wurde, nimmt jedes Individuum die Welt gebrochen und damit subjektiv wahr (vgl. Wirth 2010, S. 66).[8]
Diese Erkenntnis stellt den ersten Schritt im Verständnis von Körpersprache und verbaler Kommunikation dar: alle Sinneseindrücke, die einem Individuum vermittelt werden, sei es durch die Beobachtung anderer oder durch Worte, hängen von unendlich vielen Faktoren ab, die zur subjektiven Interpretation und der damit einhergehenden Reaktion führen und nicht zuletzt auch Missverständnisse entstehen lassen. Deswegen wird im folgenden Kapitel auf die Gesetze der Wahrnehmung eingegangen, um die Entstehung von Verfälschungen der eigenen Wahrnehmung aufzuzeigen und die hierdurch entstehenden möglichen Auswirkungen zu beleuchten.
1.3.1 Gesetze der Wahrnehmung
In der Gestaltpsychologie wurden Gesetze der Wahrnehmung gefunden, nach denen der Mensch seine Realität konstruiert. Grundprinzip hierbei ist, dass das Wahrgenommene dem Einzelnen sinnvoll und geordnet erscheint. Das wird durch einen schöpferischen Prozess erreicht (vgl. Beck o.J., S. 24f.). Es wird davon ausgegangen, dass der Mensch gar nicht anders kann, als diesen Gestaltgesetzen zu unterliegen, da die Reize der Umwelt immer in einen Gesamtzusammenhang eingebettet werden müssen. Das Gesetz der Ähnlichkeit, bei dem ähnliche Reize als zusammengehörend interpretiert werden, kann hierfür als Beispiel aufgeführt werden.
A N A N A N A N A N
A N A N A N A N A N
A N A N A N A N A N
A N A N A N A N A N
In dieser Anordnung werden die Spalten gesehen und nicht nur die Zeilen. Es wird also nicht mehr der alleinstehende Buchstabe wahrgenommen, sondern der gesamte Buchstabenblock. Das Gesetz der Ähnlichkeit kann auch in der Gesellschaft, beispielsweise auf Schichten, Homosexuelle, Menschen mit Migrationshintergrund sowie ganze Nationen angewandt werden. Dabei wird nicht das einzelne Individuum betrachtet, sondern der gesamten Gruppe bestimmte Eigenschaften zugeschrieben (vgl. Hobmair u.a. 1997, S. 96f.).
Ein weiteres Gesetz der Wahrnehmung ist das Gesetz der Nähe. Betrachtet man nun den Buchstabenblock, unter diesem Gestaltgesetz:
AN AN AN AN AN AN
AN AN AN AN AN AN
AN AN AN AN AN AN
AN AN AN AN AN AN
So fällt auf, dass Reize, die eng beieinander liegen, ebenso als zusammengehörig wahrgenommen werden. Die Buchstaben N und A als verbunden zu betrachten gelingt dem Organismus weniger gut, da A und N sich viel näher stehen. Diese Gesetzmäßigkeit findet sich auch im Alltag wieder. Werden zum Beispiel zwei Personen des öfteren zusammen gesehen, wird automatisch angenommen, dass sie wohl befreundet oder sogar ein Paar sind. Eigentlich wurde jedoch nur gesehen, dass sie in engem räumlichen Kontakt stehen. Alles weitere ist Interpretation.
Das Gesetz der Geschlossenheit ist eine Gesetzmäßigkeit, durch die unvollendete Reize als vollendet wahrgenommen werden. Dazu ein Beispiel aus dem Straßenverkehr: An einer Kreuzung steht ein rundes Schild mit rotem Rand und weißem Kreis in der Mitte. Der aktiv am Straßenverkehr teilnehmende Mensch bildet sich aus diesen Einzelelementen ein Bild, das er zu deuten weiß.
Das Gesetz der Kontinuität besagt, dass Reize, die die Fortführung eines vorangegangenen Reizes zu sein scheinen, mit diesem als zusammengehörig wahrgenommen werden (vgl. ebd. 1997, S. 95f.).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb 2: Gesetz der Kontinuität (agentur/IRRTUM o.J.)
[...]
[1] Wie sich diese Erkenntnisse im Bezug auf Körpersprache auswirken, wird in Kapitel 2.2.3, der Analyse der Augenstellung, weiter ausgeführt.
[2] Alter der Kinder wird nicht genannt.
[3] Auf diesen Prozess wird während der Schilderung des auditiven Systems und der auditiven Wahrnehmung in Kapitel 1.3.3 abermals eingegangen.
[4] Welche Auswirkungen die Phase der formallogischen Operationen, zur Folge haben kann wird in Kapitel 1.3.4 anhand der Hypothesentheorie der sozialen Wahrnehmung weiter beschrieben.
[5] Ebenso für den Kontext der Körpersprache und der verbalen Kommunikation, ist das Wissen und das Verständnis über (die eigenen und die der anderen) Wahrnehmungsprozesse unabdingbar, da sie in jedem zwischenmenschlichen Kontakt maßgeblich beeinflussen.
[6] Dies soll als kurzer Einschub in die Thematik verstanden werden, der die Relevanz und die Abfolge der bislang aufgegriffenen Gliederungspunkte (vom Denken über die Sinne und die Wahrnehmung bis hin zum Handeln) nochmals unterstreicht.
[7] Da in weiterem Verlauf auch auf Emotionen eingegangen wird ist es wichtig, den Unterschied zu Empfindungen hervor zu heben. Eine Empfindung ist die Folge einer inneren oder äußeren Reizeinwirkung auf ein Sinnesorgan (vgl. Lexikographisches Institut 1990, S.1327). Unter Emotionen versteht man hingegen eine Gemütsbewegung oder eine gefühlsmäßig betonte Erregung (vgl. ebd. 1990, S. 1326).
[8] Folglich gibt es keine Objektivität bei dem, was der Einzelne unter seiner eigenen Wahrheit und somit auch Wirklichkeit versteht.
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Erstausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2011
- ISBN (Paperback)
- 9783863411657
- ISBN (PDF)
- 9783863416652
- Dateigröße
- 3.1 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Duale Hochschule Baden-Württemberg, Stuttgart, früher: Berufsakademie Stuttgart
- Erscheinungsdatum
- 2013 (Juli)
- Note
- 1,8
- Schlagworte
- Kommunikation nonverbale Signale Soziale Arbeit Interaktion Körpersprache
- Produktsicherheit
- BACHELOR + MASTER Publishing