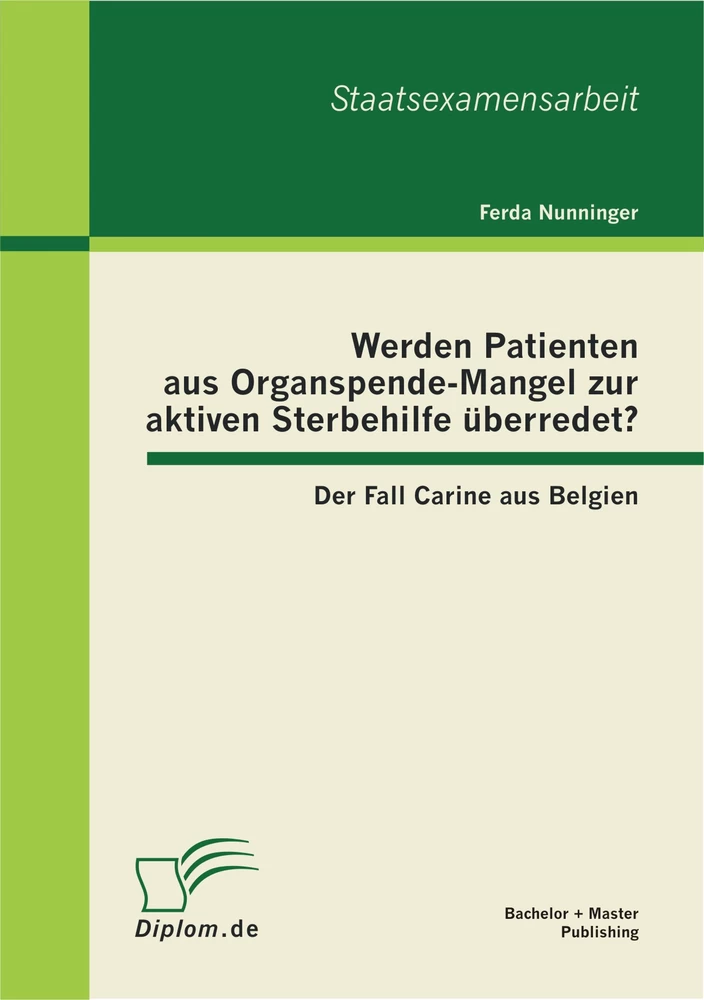Werden Patienten aus Organspende-Mangel zur aktiven Sterbehilfe überredet? Der Fall Carine aus Belgien
Zusammenfassung
Warum ist die Sterbehilfedebatte überhaupt ethisch relevant? Welche Aspekte werden gegeneinander aufgewogen? Und welche Gefahren entstehen, wenn Patienten auf Wunsch durch die Giftspritze getötet werden dürfen? Wie verändert sich die Sicht, wenn Patienten getötet werden, um Organspender zu werden. Auf wessen Wunsch werden die Patienten dann getötet: Patienten, Ärzte oder sogar Organhändler?
Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, die verschiedenen Sterbehilfeformen strafrechtlich und ethisch abzuhandeln, um die Gefahr der Verknüpfung von aktiver Sterbehilfe, im Zuge der Legalisierung, mit einer Organtransplantation aufzuzeigen.
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
2. Formen der Sterbehilfe
Als Sterbehilfe wird ein Handeln aufgefasst, das einen erleichterten und schmerzgelinderten Tod eines schwerkranken Menschen ermöglicht.[1] Dabei werden üblicherweise vier verschiedene Formen der Sterbehilfe unterschieden: die direkte aktive, indirekte aktive und passive Sterbehilfe, sowie die Beihilfe zum Suizid. Im Folgenden sollen die einzelnen Sterbehilfeformen unter dem Aspekt der strafrechtlichen und ethischen Diskussion dargestellt werden. Die Wichtigkeit einer der obigen Definition entsprechenden fünften Sterbehilfeform, nämlich die Palliativmedizin[2], soll anschließend hervorgehoben werden.
2.1 Aktive Sterbehilfe
Nur bei der aktiven Sterbehilfe steht die Intention, einen Menschen zu töten bzw. den Sterbeprozess einzuleiten, im Vordergrund. Durch die Verabreichung lebensverkürzender Substanzen wird der Tod des Patienten bewirkt. Dies kann aufgrund des Willens des Patienten selbstbestimmt zu sterben geschehen, aber auch ohne dessen Willen ausgeführt werden. In jedem Fall ist die aktive Sterbehilfe strafbar. Es entsteht ein Konflikt zwischen der Autonomie des Patienten, den Tod und den Zeitpunkt des Todes selbst zu bestimmen und dem unmoralischen Akt des Tötens, welcher den Aufgaben des Arztes widerspricht.
2.1.1 Strafrechtliche Aspekte der aktiven Sterbehilfe
Beim Leben handelt es sich um ein indisponibles Rechtsgut, das der Verfügungsgewalt seines Inhabers in letzter Konsequenz entzogen ist. Also anders wie bei den disponiblen Individualrechtsgütern, wie etwa Eigentum, Vermögen oder Freiheit. Das rechtswirksame Verzichten auf das eigene Leben ist damit dem Einzelnen untersagt.[3] In Deutschland ist aktive Sterbehilfe strafbar. Um das Töten auf Verlangen[4] gegenüber Mord oder Totschlag abzugrenzen, muss hervorgehoben werden, dass der Täter zu der Tötung durch das "ausdrückliche und ernstliche Verlangen"[5] des Opfers bestimmt wird. Handelt der Täter etwa aus anderen Motiven wie Habgier, so ist auf § 211 und § 212 des StGB zurückzuweisen. Ausdrücklich ist dieses Verlangen, wenn es mit Willensfestigkeit und Zielstrebigkeit in eindeutiger Weise und zweifelsfrei in Ausdruck gebracht wird. Ernstlich ist ein Verlangen, wenn der Verlangende imstande ist, die Tragweite seiner Entscheidung zu erfassen und dass er sie frei von Zwang und anderen wesentlichen Willensmängeln trifft. Dadurch werden insbesondere von depressiven Stimmungslagen getragene Augenblicksregungen und vorübergehende Launen, wie sie sich gerade im Verlauf schwerer Erkrankungen zeigen, ausgeschlossen. Zum besseren Verständnis, werden in einer Tabelle die Unterschiede der verschiedenen Paragraphen des StGB ausgeführt:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
2.1.2 Ethische Aspekte der aktiven Sterbehilfe
Aktiv ist diese Form der Sterbehilfe insofern, dass der Tod anders als bei der passiven Sterbehilfe von außen verursacht wird und direkt deshalb, da der Tod unmittelbar beabsichtigt wird. Es kristallisieren sich in der Diskussion zwei Fragestellungen, die hier erörtert werden sollen:
1. Ist es angemessen und ethisch zulässig zu verlangen von einem anderen Menschen getötet zu werden, um selbstbestimmt und schmerzfrei zu sterben?
2. Wenn dieses Verlangen angemessen und ethisch zulässig ist, ist es wiederum ethisch zulässig, diesem Verlangen zu entsprechen?[6]
Jeder Mensch hat ethische Pflichten gegenüber sich selbst und gegenüber seinen Mitmenschen. Von einem anderen Menschen zu verlangen, jemanden zu töten, auch wenn es in einem medizinischen Rahmen und es der eigene Tod ist, verstößt gegen diese Pflichten. Ob der Wunsch des Patienten angemessen ist, ist dabei oft schwer zu beurteilen, denn der Tod ist nicht das Ziel des Patientenwillen, sondern nur ein notwendiges Mittel um den qualvollen Schmerzen verbunden mit den Gefühlen der Angst, Einsamkeit und Nutzlosigkeit zu entfliehen. Werden sterbenskranken Patienten diese Ängste genommen und die Schmerzen angemessen behandelt, erlischt oftmals der Wunsch nach dem Tod.[7] In einem schmerzbelasteten Zustand und in verschiedenen Phasen des Sterbeprozesses, die mit gravierenden Stimmungsschwankungen einhergehen, ist der Patient oft gar nicht entscheidungsfähig. Dabei ist die Zurechnungsfähigkeit für die Zulässigkeit der Sterbehilfe ausschlaggebend. Aber dieses Problem ergibt sich auch bei anderen Sterbehilfeformen, wie zum Beispiel bei der passiven oder indirekten Sterbehilfe. Die Einstellungen des Patienten und die Krankheitsphase sind dieselben und an der Entscheidungsunfähigkeit ändert sich auch in einer solchen Situation, wenn andere legale Sterbehilfeformen praktiziert werden, nichts. Somit ist das Verlangen nach Sterbehilfe oftmals der Wunsch nach einer umfassenden Sterbebegleitung, die dafür sorgt, dass Schmerzen auf das Minimalste reduziert und die Versorgung auf das Maximalste gesteigert wird.[8] Allerdings spricht dagegen, dass eben nicht alle Schmerzen lahmgelegt werden können und die maximale palliativmedizinische Versorgung oftmals bedingt durch knappe Ressourcen nicht immer gewährsleistet werden kann. Es ist in Krankenhäusern kein seltener Fall, dass Patienten auf normalen Stationen in der Warteschlange versterben, weil die Palliativ-Stationen überfüllt sind. Es kann also durchaus Situationen geben, in denen der Ausweg in der aktiven direkten Sterbehilfe erhofft wird. Darf man diesem ethisch zulässigen und angemessenen Verlangen dann in einer solchen Alternativlosigkeit entsprechen? Auch wenn die Tötung auf Verlangen legitim und angemessen erscheint, ist sie eine "ethisch unzulässige Verfügung über Leben und Tod eines anderen Menschen und ein Verstoß gegen die Würde dieses Menschen".[9] Da im Gegenzug die passive oder indirekte Sterbehilfe in manchen Fällen nicht nur ethisch zulässig, sondern auch geboten ist, wird für die Argumentation erneut der Unterschied zwischen diesen beiden Polen der Sterbehilfeformen herangezogen. Der eine Pol ist die aktive direkte Sterbehilfe, der andere die passive und indirekte Form der Sterbehilfe. Während bei der passiven Sterbehilfe ein Unterlassen der lebensverlängernden Maßnahmen und ein "Geschehenlassen" des Sterbens im Vordergrund stehen, ist zwar die indirekte Sterbehilfe ein aktives Tun, aber nicht im Sinne eines Eingriffes in die körperliche Unversehrtheit des Sterbenden, sondern im Sinne eines Beendens einen solchen Eingriffs. Bei der aktiven direkten Sterbehilfe wird hingegen der Tod durch einen solchen Eingriff in die körperliche Unversehrtheit des Patienten erst bewirkt. Nun muss die Frage gestellt werden, welche der beiden Pole vorzuziehen ist: die aktive Sterbehilfe, bei welcher der Tod sofort nach Ausführung eintritt oder der andere Pol mit passiver und indirekter Strebehilfe, bei welcher der Tod lediglich mit Wahrscheinlichkeit und wenn meistens mit einer zeitlichen Verzögerung eintritt.[10]
2.2 Indirekte Sterbehilfe
Diese Form der Sterbehilfe hat die Leidenslinderung des Patienten im Vordergrund. Es wird in Kauf genommen, dass der Patient – solange es seinem Willen entspricht – durch die Nebenwirkungen der verabreichten Schmerzmittel einen früheren Tod erfährt, ohne die er in seinem Leiden belassen werden würde. Die Intention des Arztes sollte also die Schmerzlinderung sein, aufgrund derer der frühere Tod des Patienten hingenommen werden darf. Es wird dabei eine Grundhaltung vertreten, dass der Patient nicht in seinem unerträglichen Zustand gelassen wird, um eine minimale Verlängerung seiner Lebenszeit zu erreichen, sondern die Lebensverkürzung wird in Kauf genommen, um seinen Zustand erträglicher zu machen.[11]
2.2.1 Strafrechtliche Aspekte der Indirekten Sterbehilfe
Erfolgt der Tod des Patienten aufgrund einer medizinisch indizierten ärztlichen Medikation zur Linderung von Schmerzen, und war diese Todesfolge nicht die Intention des Arztes, so bleibt die Tat straflos.[12] Indirekte Sterbehilfe ist also in Deutschland straflos und wird in allen Krankenhäusern praktiziert. Doch die Intention ist und bleibt eine innere Einstellung und kann von außen nicht mit Sicherheit beurteilt werden. Aber sobald als Intention über die Schmerzlinderung hinaus das absichtliche Töten des Patienten festzustellen ist, treten die Gesetze §211 ff des StGB in Kraft. In der Vorsatzfrage geht es darum, ob der Arzt die durch die Schmerzmedikation bewirkte Lebensverkürzung des Patienten für möglich hält und billigend in Kauf nimmt oder mit sicherer Gewissheit die lebensverkürzende Wirkung der Medikation kennt. Im letzteren Fall wäre die Grenze zur Strafbarkeit überschritten. Da diese Grauzone sehr schmal ist, streiten sich Rechtswissenschaftler darum, ob die im Rahmen einer Schmerzbehandlung sicher im Vorfeld gewusste Lebensverkürzung zur straflosen indirekten Sterbehilfe gezählt werden soll oder zur strafbaren aktiven Sterbehilfe.[13] Die Abgrenzung dieser beiden Positionen ist in der Praxis jedoch undurchführbar. Es gibt keine Maßstäbe, die zur Objektivierung herangezogen werden können. Die Dosierung der Schmerzmittel ist von Mensch zu Mensch und von Schmerz zu Schmerz unterschiedlich. Es kann sein, dass ein Mensch mit sehr starken Schmerzen durch ebenfalls starke Schmerzmittel nur eine Linderung erhält, während die Wirkung dieser gleichen Dosis der Schmerzmittelgabe das Leben eines anderen Menschen mit geringeren Schmerzen verkürzen würde.
Darüber hinaus stellt sich auch hier die Frage der Humanität: Soll man einem Sterbenden die unerträglichen Schmerzen lassen, nur weil die Schmerzmittelgabe sein Leben sicher verkürzt? Der Begriff "Sterbende" setzt die zeitliche Begrenzung voraus, sodass indirekte Sterbehilfe geleistet werden kann, da der Todeseintritt in kurzer Zeit zu erwarten ist.[14] Nun ist die Frage, ob Todkranken, bei denen eine Heilung ausgeschlossen ist, die unter starken Schmerzen leiden, jedoch nicht für eine absehbare Zeit, sondern in einem Wochen, Monate oder sogar Jahre dauernden Prozess, die indirekte Sterbehilfe verwehrt werden soll. Verletzt der Arzt nicht seine Pflicht, Schmerzen zu lindern, wenn er dies unterlässt, weil der Tod nicht unmittelbar bevorsteht? Laut § 223 StGB würde sich der Arzt bei einer Unterlassung der Schmerzmedikation wegen Körperverletzung strafbar machen.[15] Es sind auch nicht nur Schmerzen, die auf dem letzten Lebensweg die Lebensqualität beeinträchtigen, sondern auch andere Leiden wie Atemnot, Erstickungsangst, unaufhörliche Übelkeit etc. Diese Leiden sollten nach der Bundesärztekammer ebenfalls durch indirekte Sterbehilfe gelindert werden, auch wenn der Tod billigend in Kauf genommen wird.[16]
Die Straflosigkeit der indirekten Sterbehilfe wird von den meisten Rechtswissenschaftlern über die Rechtsfigur des rechtfertigenden Notstands (§ 34 StGB) begründet. Dabei wird eine Güterabwägung zwischen einem Sterben in Würde und einer Erhaltung des Lebens um jeden Preis, das Überwiegen des Schmerzlinderungsinteresses gegenüber der Lebensverkürzung vorgenommen. Diese Abwägung ist an den (mutmaßlichen) Willen des Patienten gekoppelt. Und sein Wille ist immer das Entscheidende in der Sterbehilfedebatte.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten[17] [18]
2.2.2 Ethische Aspekte der indirekten Sterbehilfe
Es ist nicht in Frage zu stellen, ob eine Schmerzlinderung am Lebensende medikamentös erreicht werden soll oder nicht, auch wenn die Gefahr einer Lebensverkürzung besteht. Aber es entsteht eine Grauzone, wenn die Strafbarkeit aufgrund der Intention des Arztes entschieden wird.
Indirekte Sterbehilfe ist insofern aktiv, dass der Tod, anders wie bei der passiven Sterbehilfe, durch eine äußere Ursache bewirkt wird. Indirekt ist sie insofern, als dass der Tod nicht erstrebt wird, sondern in Kauf genommen wird aufgrund einer Schmerzlinderung.[19] Es gelten fünf Bedingungen, die erfüllt sein müssen, damit die indirekte aktive Sterbehilfe zulässig ist:
1. Der Patient muss im Sterben liegen.
2. Der Patient muss schwerwiegende Schmerzen haben.
3. Diese Schmerzen können nicht mit anderen weniger lebensverkürzenden Medikamenten gelindert werden.
4. Der Patient muss über die lebensverkürzende Wirkung aufgeklärt worden sein und der Medikamentengabe zustimmen.
5. Die lebensverkürzende Wirkung darf nur in Kauf genommen nicht aber intendiert werden.
Werden diese Bedingungen erfüllt, ist die indirekte Sterbehilfe sowohl in verschiedenen Gremien als auch in der deutschen Rechtsprechung zulässig. Allerdings besteht Uneinigkeit darüber, ob man die Absicht des Arztes, Schmerzen zu lindern oder den Tod des Patienten herbeizuführen, objektiv feststellen kann.[20]
Für die ethische Zulässigkeit dieser Sterbehilfeform werden zwei Konzepte vorgebracht: Das Güterabwägungskonzept und das Doppelwirkungskonzept. In dem Ersteren werden die Güter Freiheit von Schmerz und Leben gegeneinander gewogen. Überwiegt der Wunsch des Patienten einen schmerzfreien aber kürzeren Sterbeprozess zu führen als unter schwerwiegenden Schmerzen den Sterbeprozess zu verlängern und damit länger am Leben erhalten zu werden, dann ist die Schmerzmittelgabe unter Inkaufnahme einer Lebensverkürzung ethisch zulässig.[21] In dem Doppelwirkungskonzept ist eine ethisch schlechte Wirkung dann in Kauf zu nehmen, wenn eine ethisch gute Wirkung beabsichtigt wird. Dabei ist eben wichtig, dass die ethisch gute Wirkung beabsichtigt wird, und nicht die schlechte. Lebensverkürzung wird also nicht beabsichtigt, sondern aufgrund des Wunsches der Schmerzfreiheit in Kauf genommen.[22] Aber wie kann die tatsächliche Intention des Arztes objektiviert werden? Man kann ja nicht in den Kopf des Arztes schauen, um seine wirkliche Intention zu erkennen. Die Objektivierung der Absicht wird von Skeptikern in Frage gestellt. Durch Forschungen in der Palliativmedizin können Wirkungen auf bestimmte Dosierungen von Schmerzmitteln berechnet werden. So kann man mit Blick in die protokollierte Krankenakte anhand der Dosierung feststellen, ob ein Tod intendiert wurde oder nur die Schmerzfreiheit. Jedoch wissen die Ärzte sehr wohl, wo ihre Grenzen sind. Dementsprechend kann die Absicht der Tod sein, aber die Grenzen der Dosierung können so eingehalten werden, dass es so scheint, als wäre nur eine Schmerzlinderung intendiert. Zumal einige Patienten unter starken Schmerzen einfach mehr Schmerzmittel brauchen. Und diese subjektiven Schmerzen im Nachhinein objektiv zu beurteilen ist eine Sache der Unmöglichkeit. So bleibt es auch ein Stück weit dem Arzt und seinem Gewissen überlassen, mit welcher Absicht er die Schmerzmittel verabreicht. Es bleibt eine Grauzone, da viele indirekte Sterbehilfefälle nicht gemeldet werden. Viele Ärzte sprechen von Schmerzlinderung, meinen aber die Indizierung des Sterbeprozesses.
2.3 Passive Sterbehilfe
Unter "passiver Sterbehilfe" ist das Sterbenlassen schwerkranker, leidender oder irreversibel komatöser Menschen durch Verzicht auf lebensverlängernde Maßnahmen zu verstehen. Wenn "passive Sterbehilfe" bei Patienten, die eine fortschreitende und nicht mehr zu heilende Krankheit haben, angewandt wird, ist die Therapie auf Wunsch des Patienten dahingehend zu ändern, dass auf lebensverlängernde Maßnahmen verzichtet wird. Es ist nicht mehr die kurative Therapie im Vordergrund, die auf ein Heilen der Krankheit abzielt, sondern eine palliative. D.h. die Linderung von Beschwerden Schwerstkranker wird zum Ziel. Dabei kann man die passive Sterbehilfe wiederum in drei Formen[23] einteilen:
1) Therapieverzicht: Verzicht z.B. auf Reanimation, Dialysebehandlung oder Antibiotikagabe.
2) Therapieabbruch: Bei dieser Form der passiven Sterbehilfe wird bspw. ein Beatmungsgerät abgeschaltet oder eine Behandlung mit künstlicher Ernährung abgebrochen.
3) Therapiereduktion: Kreislaufunterstützende Maßnahmen werden reduziert.
Die Intention der passiven Sterbehilfe ist es, dem Sterben nicht mehr im Wege zu stehen, sondern das Sterbenlassen und das Akzeptieren der Endlichkeit der Menschen.
Auch hier entsteht eine Problematik, die die Grenze zwischen strafbarer aktiver Sterbehilfe und strafloser passiver Sterbehilfe hauchdünn hält. Es wird darüber diskutiert, wie ein aktives Tun, z.B. das Abstellen eines Beatmungsgerätes, passiv sein kann. Es muss unterschieden werden ob der Schwerpunkt beim aktiven Tun oder passiven Unterlassen liegt. Auch ist der Gesichtspunkt der Humanität entscheidend: Kann es humaner sein, den Patienten langsam verhungern oder verdursten zu lassen oder ihm eine den Tod schneller herbeiführende Spritze zu verabreichen? Das Ergebnis sowohl der passiven als auch der aktiven Sterbehilfe ist das gleiche: Der Tod des Patienten. Ist also der Zeitpunkt des Todeseintrittes entscheidend, ob eine Handlung strafbar ist oder straflos bleibt? Und noch weiter: Darf der Mensch überhaupt den Todeszeitpunkt aktiv beeinflussen?
2.3.1 Strafrechtliche Aspekte der passiven Sterbehilfe
2.3.1.1 Rechtslage: Selbstbestimmungsrecht des Patienten
Die Rechtmäßigkeit der passiven Sterbehilfe gründet auf dem Selbstbestimmungsrecht des Patienten. Die Unterlassung lebensverlängernder Maßnahmen muss also auf dem (mutmaßlichen) Willen beruhen. Wird eine Unterlassung entgegen den Willen ausgeführt, handelt es sich dabei um Tötung. Dabei fokussiert sich die Diskussion auf die Grundrechte, die jeder Mensch hat, in besonderer Weise auf folgende Artikel des deutschen Grundgesetzes:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten[24]
Jeder Mensch hat das Recht auf eine körperliche Unversehrtheit und besitzt ein allgemeines Selbstbestimmungsrecht. Diese Verbindung ermöglicht es dem Patienten eine Behandlung zu verweigern oder abzubrechen. Denn jede medizinische Behandlung ist ein Eingriff in die körperliche und gegebenenfalls psychische Integrität des Patienten. Und so ist jede Behandlung an die Einwilligung des Patienten gekoppelt. Handelt der Arzt gegen diese Einwilligung, macht er sich laut §223, 224 StGB strafbar.[25] Bei einem Notfall kann ganz klar auf diese Zustimmung verzichtet werden, sofern keine sicheren Daten vorliegen, dass der Patient seine Zustimmung verweigern würde. Entscheidend ist dabei, ob der Patient im Zeitpunkt der Entscheidung in der Lage ist, über die Folgen des Behandlungsabbruchs ernstlich, freiverantwortlich und einsichtig zu urteilen. Dieses Selbstbestimmungsrecht reicht, um auch aus objektiver Sicht unvernünftiges oder unverantwortliches Verlangen des Patienten zu verantworten. Denn jeder Eingriff, auch wenn der Patient dadurch länger leben könnte, ist ein Eingriff in die Freiheit und Würde der menschlichen Persönlichkeit.
2.3.1.2 Rechtslage bei Abbruch einer technisch unterstützenden Heilbehandlung
Bisher war die Rede von Behandlungsabbrüchen, die nicht unmittelbar zum Tod führen. Das Sterben soll nicht aufgehalten und das Leben nicht unnötig verlängert werden. Bei einem Abbruch einer technisch unterstützenden Behandlung verlagert sich die Problematik aber erheblich ins aktive Tun, nämlich das Abschalten eines Gerätes, z.B. eines Beatmungsgerätes, so dass die Grauzone zwischen passiver Sterbehilfe zum Töten auf Verlangen immer dünner wird. Die Rechtsprechung unterscheidet zwischen dem aktiven Tun oder dem Unterlassen, je nachdem wo der Schwerpunkt des strafrechtlich relevanten Verhaltens liegt. So ist der Abbruch einer technisch unterstützenden Heilbehandlung seinem Schwerpunkt nach ein Unterlassen der weiteren Behandlung und somit als straflose passive Sterbehilfe zu bewerten. Das Abschalten des Gerätes sei gleichzusetzen mit einer Beendigung der manuellen Herzmassage. Da im Letzteren ebenfalls von einer Unterlassung und nicht von einem aktiven Tun gesprochen wird, sei das Abschalten des Gerätes eine passive Sterbehilfe.[26]
Einen besonderen Fall stellt der Abbruch der künstlichen Ernährung dar, da durch diesen Abbruch nicht die Krankheit des Patienten den Tod bewirkt, sondern der Nahrungsentzug. Die Rechtsprechung sieht diesen Fall, genauso wie das Abschalten des Beatmungsgerätes, nicht als strafbare aktive, sondern als straflose passive Sterbehilfe an, denn aufgrund seiner Krankheit kann der Patient ja sich nicht mehr ernähren. Zumal der Patient jederzeit eigenverantwortlich entscheiden darf, ob er weiterhin ernährt werden möchte oder nicht. Nahrung und Atemluft gehören zu den Grundbedürfnissen des Menschen und sollten beim Abbruch der künstlichen Nahrung sowie der künstlichen Beatmung vom Stellenwert her gleichbehandelt werden.[27]
2.3.1.3 Rechtslage der passiven Sterbehilfe bei aktuell nicht entscheidungsfähigen Patienten
Nun wurde das Selbstbestimmungsrecht des Patienten als Bedingung für die Entscheidung über einen Behandlungsabbruch genommen. Es gibt aber Situationen, in denen der Patient nicht mehr entscheiden kann. Wie sind diese Fälle zu beurteilen? Hier werden zwei Zeitpunkte unterschieden und zwar der Moment, während eines Sterbeprozesses und der vor Beginn des Sterbeprozesses. Wenn der Sterbeprozess einsetzt, ist es dem Arzt möglich auf Grundlage einer antizipierten Willenserklärung lebensverlängernde Maßnahmen zu beenden. Während der Sterbephase ist das Ziel der Therapie nicht auf Heilung gerichtet, sondern auf eine palliative Versorgung des Sterbenden. Wird oder ist der Patient vor Beginn der Sterbephase nicht entscheidungsfähig, so muss anhand früherer mündlicher oder schriftlicher Äußerungen, religiöser Überzeugungen oder andere Wertvorstellungen der mutmaßliche Wille des Patienten ermittelt werden. Gelangt man zu keinem eindeutigen Ergebnis, so darf auf allgemeine überindividuelle Wertvorstellungen zurückgegriffen werden. Dabei ist zu erwägen, ob bei einem Zustand mit irreversiblem vollständigem Bewusstseinsverlust, eine Therapie dem Patienten zugemutet werden darf. Dabei gilt, dass "je weniger die Widerherstellung eines nach allgemeinen Vorstellungen menschenwürdigem Lebens zu erwarten ist und je kürzer der Tod bevorsteht, umso eher wird ein Behandlungsabbruch vertretbar erscheinen".[28]
[...]
[1] Psychrembel, "Sterbehilfe", in: Pschyrembel – Klinisches Wörterbuch, S. 1584.
[2] Eine From des medizinisch begleiteten Sterbens; siehe weitere Ausführungen: Kapitel 2.5. Palliativmedizin.
[3] Grimm, Hillebrand, "Sterbehilfe", S.60.
[4] § 216 des Deutschen Strafgesetzbuches.
[5] Siehe § 216 Tötung auf Verlangen des Deutschen Strafgesetzbuches.
[6] Grimm, Hillebrand, "Sterbehilfe", S.107.
[7] Grimm, Hillebrand, "Sterbehilfe", S.108f.
[8] Grimm, Hillebrand, "Sterbehilfe", S.107.
[9] Grimm, Hillebrand, "Sterbehilfe", S.111.
[10] Grimm, Hillebrand, "Sterbehilfe", S.113f.
[11] Grimm, Hillebrand, "Sterbehilfe", S.99f.
[12] Grimm, Hillebrand, "Sterbehilfe", S.34f.
[13] Grimm, Hillebrand, "Sterbehilfe", S.35f.
[14] Grimm, Hillebrand, "Sterbehilfe", S.39.
[15] Grimm, Hillebrand, "Sterbehilfe", S.40.
[16] Grimm, Hillebrand, "Sterbehilfe", S.40.
[17] Deutsches Strafgesetzbuch.
[18] Deutsches Strafgesetzbuch.
[19] Grimm, Hillebrand, "Sterbehilfe", S.100.
[20] Grimm, Hillebrand, "Sterbehilfe", S.100f.
[21] Grimm, Hillebrand, "Sterbehilfe", S.101f.
[22] Grimm, Hillebrand, "Sterbehilfe", S.101.
[23] Junginger, T., u.a., Grenzsituationen in der Intensivmedizin: Entscheidungsgrundlagen, Berlin, Heidelberg 2008, S. 74f.
[24] Deutscher Bundestag (Hrsg.), Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, Berlin 2001, S.14.
[25] Grimm, Hillebrand, "Sterbehilfe", S.47.
[26] Grimm, Hillebrand, "Sterbehilfe", S.54f.
[27] Grimm, Hillebrand, "Sterbehilfe", S.57.
[28] Grimm, Hillebrand, "Sterbehilfe", S.60.
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Erstausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2011
- ISBN (Paperback)
- 9783863412258
- ISBN (PDF)
- 9783863417253
- Dateigröße
- 470 KB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
- Erscheinungsdatum
- 2013 (Juli)
- Note
- 1,5
- Schlagworte
- passive Sterbehilfe aktive Sterbehilfe Beihilfe zum Suizid indirekte Sterbehilfe Ländervergleich Sterbehilfe Euthanasie
- Produktsicherheit
- BACHELOR + MASTER Publishing