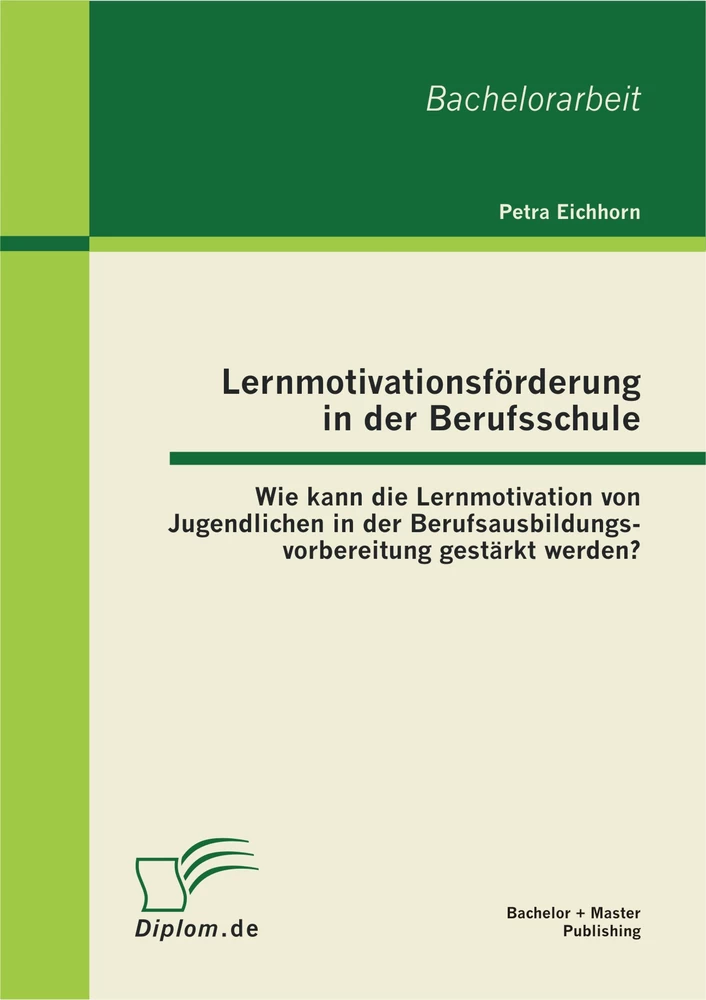Lernmotivationsförderung in der Berufsschule: Wie kann die Lernmotivation von Jugendlichen in der Berufsausbildungsvorbereitung gestärkt werden?
Zusammenfassung
Zunächst wird ein kurzer Überblick über das System der Berufsausbildungsvorbereitung gegeben, woraufhin dann die verschiedenen Faktoren erläutert werden, die die Lernmotivation bei Schülern in der Berufsausbildungsvorbereitung beeinflussen. Dazu gehören die Lernumwelt, motivationsrelevante Charakteristiken von Jugendlichen in der Berufsausbildungsvorbereitung sowie die Rolle der Lehrkraft im Berufsschulunterricht.
Dabei wird unter anderem erklärt, wie die Lehrkraft auf die Lernmotivation der Jugendlichen einwirken kann. Anschließend werden theoretische Ansätze in der Motivationstheorie erörtert. Die Arbeit liefert theoretische Hintergründe zur Selbstbestimmungstheorie von Deci und Ryan sowie zur Pädagogischen Interessentheorie von Prenzel. Anhand dieser wird eine Übersicht zu den möglichen Varianten von Lernmotivation und den Bedingungen für motivationsförderliches Lernen erarbeitet.
Des Weiteren geht die Arbeit auf die Phasen des Lernprozesses von Schmitz ein, in denen positiv auf die Lernmotivation Einfluss genommen werden kann.
Zum Schluss werden konkrete Handlungsempfehlungen für die Gestaltung eines motivationsförderlichen Unterrichts durch handlungsorientierte und selbstregulierende Elemente in der Berufsschule gegeben und die Projektarbeit als Lehrtechnik zur Förderung der Lernmotivation bei Jugendlichen in der Berufsausbildungsvorbereitung vorgestellt.
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
3 Faktoren zur Beeinflussung der Lernmotivation bei Schülern in der Berufsausbildungsvorbereitung
3.1 Umweltfaktoren
Die Faktoren, die auf die Lernmotivation der Schüler in der Berufsausbildungsvorbereitung einwirken, sind umfangreich und beeinflussen sich gegenseitig. Dazu gehören der Ausbildungs- und Arbeitsmarkt und die damit verbundenen Chancen auf einen Ausbildungsplatz, die bildungspolitischen Rahmenbedingungen sowie das soziale Umfeld, zudem sowohl Familie und Freunde, wie auch die Lehrer der Jugendlichen gehören. Auf den Einfluss der Lehrkräfte wird in dieser Arbeit unter dem Gliederungspunkt 3.3 im Hinblick auf die Motivation gesondert eingegangen.
3.1.1 Ausbildungs- und Arbeitsmarkt
„Ein wesentliches Merkmal, welches mit Benachteiligungen Hand in Hand geht, ist das der Ausbildungslosigkeit“ (Molzberger et al., 2009, S. 15). Der Mangel an Ausbildungsplätzen und die hohe Arbeitslosigkeit sind weitgehend auf die Globalisierung zurück zu führen, da viele Arbeiten ins Ausland verlagert werden. So konnten die Unternehmen seit den neunziger Jahren, aus einem Überangebot an Bewerbern, diejenigen mit den vermeintlich besten Kompetenzen auslesen (Wolf, 2009, S. 70-72). Des Weiteren achten die Betriebe längst nicht mehr nur auf eine fachliche Qualifikation der Jugendlichen für eine Ausbildung, sondern setzen darüber hinaus gewisse Schlüsselqualifikationen[1] voraus, die bereits vorhanden sein sollten, bevor die betriebliche Ausbildung angetreten wird (Büchner, 2002, S. 150).
Die Tendenz ist weg von der dualen Berufsausbildung, hin zu der Hochschulausbildung und anderen weiterführenden Schulformen, wie zum Beispiel der Fachoberschule, welche ebenfalls in einer speziellen Fachrichtung ausbilden. Dies hat zur Folge, dass sich ein Wettbewerb auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt entwickelt hat, in dem die putativ höher qualifizierten Bewerber den übrigen Ausbildungswilligen vorgezogen und die Letzteren zu Marktbenachteiligten gemacht werden. So ist ein zeitlich unbestimmter Aufenthalt in der Berufsausbildungsvorbereitung oder die drohende Langzeitarbeitslosigkeit vorprogrammiert. Eine „‚Normalität‘ beim Übergang in die Systeme ist für diese Jugendlichen nicht mehr erkennbar“ (Wolf, 2009, S. 70-72).
Zum ersten Mal seit dem Jahr 2000 sind die Zahlen der Neuzugänge ins Übergangssystem mit 397.000 Schülern nach jüngsten Statistiken deutlich regressiv. Trotzdem beträgt der Anteil der Berufsausbildungsvorbereitung an den Neuzugängen zur beruflichen Bildung immer noch 34 %, womit die Lage der Jugendlichen, die maximal einen Hauptschulabschluss vorweisen können, auch künftig problematisch bleibt (BMBF, 2010a, S. 7-9).
Von Entwarnung kann also keine Rede sein - vor allem wenn man die Nachfrage der Altbewerber nach Ausbildungsplätzen mit einbezieht, die im Übergangssystem verweilen - dann ist von einer beträchtlichen Angebotsunterdeckung bezüglich der Ausbildungsstellen auszugehen. Das Bestreben um eine Integration der Altnachfrager ist unerlässlich, wenn ein „beträchtliche[r] Verlust an Humankapital“ vermieden werden soll (ebenda, S. 116). Denn um die Nachfrage an gelernten Fachkräften in Zukunft zu befriedigen, muss auch denjenigen Jugendlichen eine betriebliche Ausbildung vermittelt werden können, die mindere schulische Leistungen vorweisen. Zur Bewältigung dieser Integration ist eine verstärkte Unterstützung der Betriebe insofern nötig, dass diese auch Jugendlichen mit geringerer Ausbildungsreife eine Chance geben. Nur so kann die Dimension der Berufsausbildungsvorbereitung begrenzt werden (BMBF, 2010b, S. 63).
Trotz des drohenden Fachkräftemangels und der demografischen Entwicklung sind die Ansprüche der Betriebe allerdings noch nicht gesunken. Diese geben, Umfragen zufolge, als Hauptgrund für unbesetzte Lehrstellen, „das mangelnde Leistungsvermögen und […] unzureichende schulische[…] Qualifikationen der Bewerber und Bewerberinnen“ an (ebenda, S. 25). Doch die Auswahlmöglichkeiten der Betriebe werden sich zunehmend schmälern (ebenda).
Obwohl die Anzahl der Neuzugänge in der Berufsausbildungsvorbereitung rückläufig ist und sich der Ausbildungsmarkt etwas entspannt hat, gestaltet sich die Vermittlung der Altbewerber weiterhin schwierig. Zudem bleibt die Frage offen, ob die Forderungen der Betriebe zu hoch oder die Qualifikationen der Jugendlichen, die ins Berufsleben einsteigen möchten, tatsächlich zu gering sind.
3.1.2 Bildungspolitische Rahmenbedingungen
Ein Blick auf das allgemeinbildende Schulsystem zeigt, dass fraglich ist, ob die Schulen tatsächlich fähig sind, ihren Bildungs- und Erziehungsauftrag bei den Schülern zu verwirklichen. Die PISA-Studie enthüllte, „dass Schule nicht dazu beiträgt, durch eine gezielte Förderung die Chancen von benachteiligten Kindern und Jugendlichen und die soziale Integration junger Menschen mit Migrationshintergrund zu verbessern, sondern dass sie eher die Unterschiedlichkeiten festschreibt und eine Auslese fördert“ (BMBF, 2005, S. 13).
Der häufig problematische Übergang von der Schule in den Beruf deutet darauf hin, dass die Jugendlichen an der Schule keine hinreichende Vorbereitung auf die Berufswelt erfahren. Vielen Jugendlichen mangelt es an den Grundrechenarten sowie der schriftlichen und mündlichen Kommunikation. Eine Beschreibung von Vorgängen sowie die Schilderung simpler Sachverhalte, fallen ihnen schwer. Doch die Entstehung einer Wissens- und Dienstleistungsgesellschaft fordert den Individuen „das Vermögen [ab], komplexe Zusammenhänge zu erfassen, sie wiederzugeben und Probleme […] lösen“ zu können (ebenda, S. 13-14).
PISA zufolge beenden knapp zwanzig Prozent der Jugendlichen die Schule „ohne das erforderliche Rüstzeug für Ausbildung“ (BMBF, 2010b, S. 57). Wenn Jugendliche diese gefragten Schlüsselqualifikationen nicht von der allgemeinbildenden Schule mitbringen, bedarf es einer speziellen Förderung in der Berufsausbildungsvorbereitung. Sowohl die gestiegenen Anforderungen der ausbildenden Unternehmen als auch das wachsende Bestreben der Jugendlichen nach einer höheren Bildung, haben dazu beigetragen, dass der Hauptschule und deren Abschluss eine zunehmend geringere Bedeutung zugeschrieben wird (BMBF, 2005, S. 12-15).
Auf der ordnungspolitischen Ebene ist zum einen fraglich, ob ein Bedarf nach Berufen mit knapperen Theorieanteilen wahrnehmbar ist. Damit sind zum Beispiel Tätigkeiten in der Metall- und Elektrobranche gemeint, die nur eine zweijährige Ausbildungszeit voraussetzen. Diese stoßen auf dem Arbeitsmarkt kaum auf Nachfrage, wodurch verdeutlich wird: „Für einfache Tätigkeiten gibt es keinen Zukunftsmarkt“ (Allespach et al., 2005, S. 19).
Zum anderen ist die Spaltung von Theorie und Praxis nicht zukunftsorientiert. Sie resultiert daraus, dass schlechte Noten in der Schule als strukturelle Lernschwäche gedeutet werden, wodurch Schüler in der Berufsausbildungsvorbereitung automatisch als praktisch begabt eingestuft werden. Diese Erklärung kann der heterogenen Zielgruppe im Übergangssystem jedoch nicht gerecht werden und ist wissenschaftlich keinesfalls belegbar. Denn gerade für Lektionen, die keinen Praxisbezug aufweisen und lediglich theoretisch abgehandelt werden, können weder Schüler mit guten noch mit schlechten Noten motiviert werden (ebenda, S. 19-20).
„Das Auseinanderfallen von Lern- und Anwendungskontexten ist heute schon ein Problem der Berufsbildungspraxis. [...] Notwendig ist daher die Schaffung einer lernförderlichen Ausbildung in Schule und Beruf. [...] Die Verbindung zwischen dergestalt organisierten Lernprozessen und der Festlegung junger Menschen als ausschließlich praktisch, und damit eben nur eingeschränkt begabt, ist kurz und offensichtlich. Diesen Jugendlichen wird zudem jede Entwicklungsfähigkeit abgesprochen.“ (ebenda, S. 20)
So wird vielen ehemaligen Hauptschülern keine Chance gegeben, sich während einer betrieblichen Ausbildung zu entwickeln und neue Fähigkeiten zu erwerben. Meist wird vorausgesetzt, dass gewisse berufliche Qualifikationen bereits in der Schule erlernt werden und vorhanden sind, wenn man sich um eine Ausbildungsstelle bewirbt.
Der Wechsel von der Schule in die Arbeitswelt gestaltet sich für zahlreiche Jugendliche als ein „überkomplexe[r] und intransparente[r] Förderdschungel“ (BMBF, 2010b, S. 59), dessen Maßnahmen oft verschult sind und sich als Sackgassen oder Warteschleifen herausstellen. (Allespach et al. 2005, S. 18). Allespach et al. (ebenda) erklären dies wie folgt:
„Die Jugendlichen, die aufgrund sozialer Benachteiligung, psychischer Belastung oder kognitiver Schwächen bereits Probleme in der allgemeinbildenden Schule hatten, werden weiter mit schulischem Lernen traktiert. Häufig führt die Teilnahme an solchen Maßnahmen zu einer weiteren Stigmatisierung und die Wirksamkeit […] einer Berufsvorbereitung bleibt sehr beschränkt.“
Zudem fehlt es an einer Kooperation zwischen den zahlreichen Trägerstrukturen und Finanzierungsströmen, wodurch die Maßnahmen nur bedingt auf eine Akzeptanz auf dem Arbeitsmarkt stoßen. Infolgedessen werden die Jugendlichen weiterhin in diskriminierender Weise verurteilt, was deren Erfolgsaussichten auf eine Ausbildungsstelle schwinden lässt (BMBF, 2010b, S. 59).
Sowohl Wirtschaft wie auch Bundesregierung sind der Meinung, dass eine effizientere Gestaltung der Berufsausbildungsvorbereitung unumgänglich ist.
So wird seitens der Wirtschaft angenommen, dass die undurchsichtige Landschaft des Fördersystems noch weiter ausgedehnt wird. Stattdessen sollte besser untersucht werden, wie man das Übergangssystem einschränken kann, sodass „erfolgreiche Beispiele nachhaltig in die Fläche getragen werden können“ (ebenda, S. 57). Betrachtet man das Fördersystem genauer, so stellt man fest, dass den Jugendlichen der Beginn einer Ausbildung am leichtesten fällt, wenn dieser eine betriebsnahe Berufsausbildungsvorbereitung vorangegangen ist. Insbesondere Einstiegsqualifizierungen[2] sind aussichtsreich, da zwei von drei Jugendlichen danach geradewegs in eine duale Ausbildung münden (ebenda, S. 56-59).
Der Regierung zufolge ist eine Verringerung der Jugendlichen ohne Schulabschluss nötig, um auch die Zahl der Jugendlichen in der Berufsausbildungsvorbereitung senken zu können. Die Qualifizierungsinitiative sieht in diesem Zusammenhang vor, die Anzahl der Schulabgänger ohne Hauptschulabschluss bis zum Jahr 2015 zu halbieren. Damit würde ebenfalls die Zahl der Altbewerber im Übergangssystem erheblich verringert werden. Auch die Verbesserung der Berufsorientierung in allgemeinbildenden Schulen könnte die Quoten der Jugendlichen in der Berufsausbildungsvorbereitung senken (ebenda, S. 56-59). Denn,
„[n]ur wer sich frühzeitig mit der Frage seiner beruflichen Zukunft und seinen individuellen Möglichkeiten auseinandersetzt, Erfahrungen sammelt und die Berufswelt erlebt, kann überhaupt eine Wahl treffen. Eine gute Orientierung muss rechtzeitig in der Schule beginnen und integraler Bestandteil des Lehrplans sein. Sie schafft Bewusstsein eigener Stärken und Schwächen, die Formulierung eigener Ziele und die Kenntnis realistischer Möglichkeiten auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt.“ (ebenda, S. 59)
Neben einer Verbesserung des allgemeinbildenden Schulsystems im Hinblick auf die Vermittlung notwendiger Kenntnisse und Fähigkeiten, ist also auch eine effizientere Struktur der Förderlandschaft angebracht, um die Jugendlichen besser auf eine Berufsausbildung vorbereiten zu können.
3.1.3 Soziale Faktoren
Laut Wolf (2009, S. 75) deutet die sozial bedingte Benachteiligung hauptsächlich auf die persönliche Lebenssituation der Jugendlichen hin und besteht indessen aus einem Netz einzelner Faktoren im sozialen Umfeld. Selbstverständlich lassen sich die Faktoren der Benachteiligung im sozialen Bereich ebenso wenig pauschalisieren, wie die auf der persönlichen Ebene. Jedoch kann man einige Variablen aus dem sozialen Umfeld ableiten, die sich auf die Lernbereitschaft und die Motivation der Jugendlichen auswirken können.
So zeigte sich zum Beispiel, dass bestimmte Einflüsse der Familie als Ursachen für Lernschwierigkeiten angesehen werden. Dabei wirken folgende Determinanten negativ auf die Jugendlichen ein: ein autoritärer Erziehungsstil, eine erhebliche Strenge und ein Mangel an Förderung sowie ein dürftiges Interesse der Eltern für die schulische Laufbahn ihrer Sprösslinge oder andere Probleme in der Erziehung (Zielinski, 1998, S. 94).
„Als vielfach belegt gilt die Tatsache, dass Kinder aus der Unterschicht häufiger Lernschwierigkeiten haben als Kinder aus der Mittel- oder Oberschicht“ (ebenda, S. 156). Jugendliche in der Berufsausbildungsvorbereitung oder solche, die eine Berufsausbildung abgebrochen haben, stammen besonders häufig aus Familien, in denen bereits die Eltern eine „unterdurchschnittliche […] berufliche[…] Stellung“ aufweisen. Eine weitere Ursache stellt sich dar, wenn traditionelle Erwerbsbiographien in der Familie nicht mehr fortgesetzt werden können, da zum Beispiel der landwirtschaftliche Betrieb der Eltern nicht mehr weitergeführt werden kann. Die Arbeits- und/oder Orientierungslosigkeit der Eltern wirkt sich quasi hemmend auf die Entscheidungen der Kinder aus, da diese von den Eltern keine hinreichende Hilfe bei der Berufswahl erfahren. (BMBF, 2005, S. 14-15).
Schmidt & Ĉreslovnik (2010) fanden heraus, dass gerade Schüler mit besonderem Förderbedarf stark sozial abhängig sind. Wegen der geringen Selbstwahrnehmung ihrer eigenen Leistungsfähigkeit sowie ihrem mangelnden Selbstbewusstsein über die eigenen Fähigkeiten, sind sie vornehmlich auf eine Unterstützung aus ihrem sozialen Umfeld angewiesen. Ihre Abhängigkeit von anderen, wie Eltern und Lehrern, ist damit überdurchschnittlich, weshalb sie einer speziellen Förderung seitens ihres sozialen Umfeldes bedürfen. Kann das soziale Umfeld diese Unterstützung nicht leisten, so ist vorprogrammiert, dass sich der mögliche „Status des Ungelernt-Seins […] vererbt“ (BMBF, 2005, S. 15).
Dementsprechend hat das soziale Umfeld auch einen entscheidenden Einfluss auf die Motivation der Jugendlichen. Siebert und Jäger (2006, S. 103) erläutern dies folgendermaßen:
„Lernmotive entwickeln sich in sozialen und ökologischen Kontexten. Menschen interessieren sich für das, wofür sich ihre Bezugspersonen interessieren. Auch thematische Interessen sind ‚personenabhängig‘: Eltern, Freunde, Lehrer wecken ein Interesse an einer Thematik oder an einer Tätigkeit.“
So ist festzuhalten, dass das soziale Umfeld den schulischen Leistungen der Jugendlichen Beachtung schenken und ihnen bei Bedarf jederzeit Unterstützung anbieten sollte. Nur so kann ein höherer Bildungsstand erreicht und die Motivation der Schüler gesteigert werden.
3.2 Motivationsrelevante Charakteristiken der Jugendlichen
Bestimmte Charakteristiken der Jugendlichen beeinflussen deren Motivation in der Maßnahme zur Berufsausbildungsvorbereitung. Um einen positiven Einfluss darauf nehmen zu können, ist die Kenntnis über motivationsrelevante Persönlichkeitsfaktoren der Zielgruppe von Nöten. Dazu gehört das Selbstkonzept, wobei auch die Erfahrungen von Misserfolg eine Rolle spielen. Des Weiteren lenken Wunschvorstellungen und die Identitätsentwicklung sowie Selbstregulationskompetenzen und motivationale Handlungskonflikte die Lernmotivation der Heranwachsenden. Zudem können Lernbeeinträchtigungen auf das Interesse der Schüler einwirken.
3.2.1 Selbstkonzept und Erfahrung von Misserfolg
Klar ist, dass sich ein beeinträchtigtes Selbstkonzept negativ auf die Lernmotivation der Schüler auswirkt. Jeder Schüler sieht sich aus verschiedenen Blickwinkeln. So betrachtet er sich einerseits selbst und fragt sich: „,Wie bin ich?‘“. Zudem misst er sich mit seinem materiellen und sozialen Umfeld, wobei er feststellt: „,So bin ich.‘“ (Eck, 1988, S. 45).
„Teils bewusst, teils unbewusst entwickelt sich dergestalt in jedem Menschen ein Selbstkonzept. Die Person nimmt wahr, wie sie wirklich ist (=Realselbst), andererseits baut sie sich ein Wunschbild auf, wie sie gerne wäre (=Idealselbst), und nach diesem Ideal strebt sie.“ (ebenda)
Besonders motiviert ist ein Schüler, wenn ein mittlerer Unterschied zwischen dem Realselbst und dem Idealselbst vorhanden ist. Besteht eine zu große Diskrepanz zwischen den beiden Sichtweisen, so hat dies keine positive Wirkung auf die Selbstbekräftigung, die von einem realistischen Anspruchsniveau sowie von einer realistischen Anstrengungskalkulation abhängig ist. Das dabei entstehende positive Selbstkonzept über die eigene Kompetenz ist also ausschlaggebend für die Motivation, zu lernen (ebenda).
Im Unterricht wirkt sich dies folgendermaßen aus: Der Jugendliche entscheidet sich weder für zu einfache Aufgaben, noch setzt er sich zu hohe Ziele, die er mit seinen zur Verfügung stehenden Fähigkeiten nicht erreichen kann. Somit schafft er sich selbst die besten Lernvoraussetzungen. Infolgedessen zeigt er nicht nur seine Wissbegierde im Unterricht, sondern ist auch dauerhaft dazu geneigt, sich zu bemühen und bei Problemen nicht sofort zu kapitulieren (Wilbert, 2010, S. 70).
Anders gestaltet sich dies nach Schmidt et al. (2010) bei Schülern mit einem verfälschten Selbstkonzept:
“In the area of motivation, students with special needs […] perceive their own efficiency negatively; they do not trust their own abilities and find the reasons for their lack of success in learning outside themselves. Their assessments of their abilities are unrealistic and overly optimistic.”
Daraus lässt sich schließen, dass Komplikationen im Lernprozess und Störungen im Selbstkonzept Hand in Hand gehen, welche noch intensiviert werden, wenn das soziale Milieu, wie Eltern, Lehrer und Mitschüler, den Schwächen der betroffenen Jugendlichen nur mit Unverständnis und negativem Feedback begegnen. „So können zusätzliche negative Fremdbewertungen von Versagenserlebnissen noch erheblich zu Lern- und Leistungsstörungen beitragen“ (Masendorf & Walter, 1981).
Lehrer interpretieren Lernschwierigkeiten des Schülers fälschlicherweise oft als Faulheit. Der Jugendliche empfindet jedoch seine Möglichkeiten eine bestimmte Aufgabe im Unterricht zu bewältigen, aus Erfahrung mit dem Fach oder der Lehrkraft, als unerreichbar. So scheut er jede Anstrengung. Auch wenn er das Erreichen eines Lernziels als zugänglich ansehen würde, könnte es an der Eigenaktivität des Schülers mangeln, wenn keine „positiven Ergebnisfolgen antizipiert oder als nicht attraktiv genug bewertet würden“ (Zielinski, 1998, S. 37). Werden Misserfolge dann fälschlicherweise Mängeln in der eigenen Kompetenz zugeschrieben, leidet auch die künftige Anstrengungsbereitschaft des Jugendlichen erheblich darunter. Durch diese Misserfolgserfahrungen scheint für den Schüler jeder Kampf mit dem Stoff vergebens. Würden im Gegensatz dazu, Misserfolge der unzureichenden Anstrengung beigemessen werden, so würde sich beim Schüler die Bereitschaft zeigen, in Zukunft fleißiger zu sein (ebenda, S. 36-37).
„Fasst man das schulleistungsbezogene Selbstkonzept als Summe schulischer Erfahrungen von Schülern über sich selbst im Leistungsbereich auf, so lässt sich zeigen, dass die Entwicklungen des schulischen Selbstkonzepts mit kumulierten Erfolgs- und Misserfolgserfahrungen zusammenhängt“ (Masendorf et al., 1981). Diese Misserfolgserfahrungen bringen ein fehlendes Selbstvertrauen der Jugendlichen mit sich, welches oft Grund für das Fernbleiben von der Schule ist. Wegen der hoffnungslosen Ausbildungs- und Arbeitsmarktsituation ist ihnen der „sinnstiftende […] Beitrag der Schule“ (Wolf, 2009, S. 72) nicht mehr bewusst. Darüber hinaus fällt es ihnen schwer, Erwartungen in eine berufliche Zukunft zu setzen (ebenda).
Scheitern die Lerner, können sie Gefühle der Verzweiflung und der Besorgnis erfahren, welche die Kooperation im Lernprozess beeinträchtigen können. Schüler mit Misserfolgserfahrungen nehmen ihr eigenes Versagen häufig im Vergleich wahr, wenn sie sich mit ihren Mitschülern messen. Dadurch werden Minderwertigkeitsgefühle bei den Jugendlichen hervorgerufen (Schmidt et al., 2010). Auf diese Weise wird ein erfolgreiches Lernen immens beeinträchtigt. Gerade für diese Jugendlichen ist es deshalb entscheidend, dass sie in ihrem Selbstvertrauen gestärkt werden und zu einer optimistischeren Einstellung im Bezug auf ihre Erfolgsmöglichkeiten gelangen (Schmiel, 1988, S. 61).
3.2.2 Identitätsentwicklung und Wunschvorstellungen
Befragt man jugendliche Hauptschüler, die kurz vor dem Übergang von der Schule in den Beruf, beziehungsweise in die Berufsausbildungsvorbereitung stehen, nach ihren Erwartungen von einem Beruf, so stößt man oft auf utopische Wünsche, wie ‚Ich werde sowieso einmal Fußballprofi‘ oder ‚Warum sollte ich lernen? Ich bin doch hübsch!‘. Diesen Illusionen muss spätestens in der Berufsausbildungsvorbereitung Einhalt geboten werden. Den Heranwachsenden sollte auf schonende Weise beigebracht werden, wie die Realität aussieht, „ohne dass die durch Enttäuschung hervorgerufene Bitternis in destruktive Denk- und Verhaltensmuster umschlägt“ (Büchner, 2002, S. 149). Dies ist unentbehrlich, weil schulische Leistungen stark davon abhängen, ob sie auf ein sinnvolles Motiv ausgerichtet sind, welches sich an der Wirklichkeit orientieren sollte (ebenda, S. 149-152).
Während der Pubertät ändern sich die Interessen der Jugendlichen meist völlig. Die Heranwachsenden stellen bisherige Vorlieben kritisch in Frage und entwickeln neue, dem eigenen Selbstbild entsprechende Interessen. Dies haben Studien zur Entfaltung des Berufsinteresses belegt. Viele Jugendliche wechseln somit häufig ihren Berufswunsch (Krapp, 1992, S. 22-23).
Um einen positiven Einfluss auf die Motivation der Jugendlichen nehmen zu können, müssen diese eine individuelle Weltanschauung entwickeln, in der sie ihre wirkliche Stellung in der Gesellschaft sowie im Berufsleben wahrnehmen. In dieser Phase der Identitätsentwicklung, müssen sie besonders gefördert werden. Diese Unterstützung der Jugendlichen auf der Suche nach dem eigenen Selbst, könnte im Rahmen einer Berufsorientierung erfolgen. Zudem muss sich das Übergangssystem im Unterricht besser nach der reellen Umwelt der Jugendlichen sowie an deren beruflichen Perspektiven richten. Sie sollen zwar auf ein lebenslanges Lernen vorbereitet werden, müssen aber auch für ein mögliches Leben am Rand der Gesellschaft gerüstet werden. „Hierzu gehört die Vermittlung von Wissen und Fähigkeiten, die beim Überleben helfen [...] und eines Selbstbildes, das nicht allein von der beruflichen Identität abhängig ist“ (Büchner, 2002, S. 152). Daneben gilt es, die Jugendlichen zu selbständigen Menschen zu erziehen, die auch Eigeninitiative zeigen können, was in der heutigen individualistischen, pluralistischen und sich ständig wandelnden Welt existentiell ist (ebenda, S. 149-152).
Die Lernmotivation kann also durch eine Unterstützung in der Persönlichkeitsentwicklung der Jugendlichen stark positiv beeinflusst werden, da durch die Entfaltung der Persönlichkeit gewisse Motivationsenergien hervorgerufen werden (Decker, 1985, S. 90-91). „Eine solche Erkenntnis macht deutlich, dass berufliche [Aus- und] Weiterbildung verstärkt pädagogisch, berufs- bzw. sozialpädagogisch orientiert werden muss, um die Motiv- und Persönlichkeitsbildung zu fördern“ (ebenda, S. 91).
3.2.3 Selbstregulationskompetenzen und motivationale Handlungskonflikte
Intelligenz bezieht sich sowohl auf die Informationsaufnahmefähigkeit, -auswahl und –speicherung als auch auf die Verknüpfung der verfügbaren Ansammlung an Information und Wissen sowie unter Umständen deren Anwendung. Denn die kognitiven Fähigkeiten, die Intelligenz ausmachen, umfassen außerdem die Kompetenz, den Wissenserwerb und dessen Anwendung „überwachen, kontrollieren und bei Zielabweichung gegebenenfalls korrigieren zu können“ (Straßer, 2008, S. 18-19). Dabei muss zweifelsohne von zu erreichenden Zielen ausgegangen werden. Ist man dazu in der Lage, verfügt man über sogenannte Selbstregulationskompetenzen. Demzufolge ist davon auszugehen, dass Lernbeeinträchtigungen häufig auf eine zu geringe Förderung dieser Kompetenzen zurückzuführen sind. So weisen Jugendliche, die in ihrem Lernen beeinträchtigt sind, oft eine „wenig stark ausgeprägte, strukturierte Wissensbasis und ein geringeres Wissensbewusstsein“ (ebenda, S. 19) auf. Sie können nicht unterscheiden, ob sie über das nötige Wissen verfügen, das benötigt wird, um ein Lernziel zu erreichen, oder nicht. Dies kann sich schlecht auf deren Lernmotivation auswirken. Infolgedessen setzen sie ihr Vorwissen im Unterricht nicht gezielt ein und kontrollieren die Erweiterung vorhandenen Wissens oft nur temporär. Diese Jugendlichen nehmen die Effektivität des eigenen Lernens nicht bewusst wahr und schreiben ihre Leistungen externen Faktoren zu, auf die sie keinen Einfluss haben (ebenda, S. 18-20). Sie befinden sich laut Straßer (ebenda, S. 19-20) in einem verhängnisvollen Teufelskreis:
„Wer nicht weiß, was er schon weiß, und wer Lernen als nicht beeinflussbaren Vorgang betrachtet, wird sich in vielen Lernsituationen passiv, ziellos und unmotiviert verhalten. [...] Es zeichnet sich ein komplexer Kreislauf ab zwischen fehlendem Wissen, unbewusstem ineffektiven Lernverhalten und der Schwierigkeit, den Wissensaufbau und die Wissensanwendung bewusst zu planen, zu überwachen und gegebenenfalls zu regulieren, um dadurch Wissens- und Handlungslücken abzubauen.“
Auch bei motivationalen Handlungskonflikten spielt die Ausprägung der Selbstregulationskompetenzen eine Rolle. So kann es zu einer motivationalen Interferenz kommen, wenn die Heranwachsenden mehrere Interessen parallel im Blick haben. Die Jugendlichen müssen ständig zwischen Hobbies, familiären und schulischen Aktivitäten abwägen und zu jeder Zeit Prioritäten setzen. Eine große Anzahl von Lern- und Freizeitmöglichkeiten muss allerdings nicht unbedingt zu einem motivationalen Konflikt führen. Verfügt ein Jugendlicher über eine ersichtliche Selbstregulationskompetenz, so fällt die Entscheidung des Schülers bei konkurrierenden Handlungsmöglichkeiten zum Beispiel auf die Hausaufgaben, obwohl draußen die Sonne scheint und er zahlreiche andere Optionen hätte, seine Freizeit zu gestalten (Dietz, 2006, S. 72-73).
„Je besser seine Abschirmungsmechanismen, desto leichter sollte es ihm fallen, sich ausschließlich auf die aktuelle Aufgabe zu konzentrieren und keine weiteren Gedanken an die verpasste Freizeitalternative zu verschwenden“ (ebenda, S. 73). Da die Fähigkeit der Selbstregulation meist erst im Jugendalter entwickelt wird, kann darauf in der Berufsausbildungsvorbereitung noch mit speziellen Maßnahmen, wie sie in Kapitel 5.2 erläutert werden, entsprechend Einfluss genommen werden (ebenda, S. 72-73).
3.2.4 Lernbeeinträchtigungen
Als Lernbeeinträchtigung sind laut Wolf (2009, S. 73) „sämtliche Schwierigkeiten in der Erfüllung schulische[r] Anforderungen“ anzusehen, die sich negativ auf die Informationsverarbeitung und die Lernaktivität auswirken. Klassifiziert man Beeinträchtigungen im Lernen, so lassen sich zwei verschiedene Ausprägungen diagnostizieren: die Lernstörung und die Lernbehinderung. Dabei weisen Schüler mit Lernstörungen einen geringeren Beeinträchtigungsgrad auf, als solche mit Lernbehinderungen. Lernbehinderungen sind langfristige, vielumfassende Lern- und Leistungsmängel, die sich gravierend auf die schulische Leistung auswirken. Sie sind in ihrem „Ausmaß für die Regelschule nicht mehr tolerabel […] und [begründen und spezifizieren] den sonderpädagogischen Förderbedarf der Betroffenen“ (ebenda, S. 74). Unter Lernstörungen dagegen versteht man zeitweilige, geringfügige Defizite im Lern- und Leistungsverhalten, die oft nur partiell auftreten. So ist es möglich, dass ein Schüler vorübergehend keinen Zugang zum Stoff in einem bestimmten Fach finden kann, wodurch sein Lernen beeinträchtigt wird. Diese Störung kann sowohl auf intrapersonelle Faktoren, wie der Überforderung des Schülers, zurückzuführen sein, als auch auf exogene Variablen, wie ineffektive Unterrichtsmethoden des Lehrers. Unter anderem sind auch Entwicklungsstörungen als Ursache für Lernstörungen anzusehen (ebenda, S. 73-74).
Ferner zeigen Studien, dass sich Lernbeeinträchtigungen auch derart bei Jugendlichen äußern können, als dass sie nicht zwischen relevanten und irrelevanten Lerninhalten unterscheiden können und deshalb beim Lernen falsche Schwerpunkte setzen. Sie können Probleme haben, den Stoff zu verstehen und wichtige Informationen aus einer Menge an Lerninhalten herauszufiltern. Die Schüler können außerdem anfällig für ein dürftiges Kurzzeitgedächtnis sein, Schwierigkeiten bei der Lösung eines Problems aufweisen und ein unsystematisches, impulsives Verhalten zeigen (Schmidt et al., 2010).
Vorurteile können ebenfalls Grund einer fehlenden Lernmotivation sein und damit zu Lernbeeinträchtigungen führen. Diese können sich einerseits gegen das Lernen und die Schule im Allgemeinen richten. Andererseits können sie sich in einem geringen Selbstwertgefühl äußern, wenn sich ein Schüler beispielsweise nicht zutraut, den Stoff jemals verstehen zu können. Auch gegenüber bestimmten Lerninhalten können Vorurteile entstehen, wenn der Schüler möglicherweise das Gefühl hat, die gelernte Theorie in der Praxis nicht anwenden zu können. So „beruhen [Vorurteile] einerseits auf aggressiven, intoleranten Haltungen gegenüber anderen, andererseits sind sie Ausdruck von Unsicherheit und des Bedürfnisses nach Selbstschutz“ (Siebert et al., 2006, S. 139). Diese Vorurteile haben jedoch eine Gemeinsamkeit: Sie beeinträchtigen den Schüler beim Lernen.
Junge Menschen in der Berufsausbildungsvorbereitung werden insbesondere als weniger effizient eingeschätzt und haben häufiger Schwierigkeiten, Lern- und Arbeitsaufträge zu bewältigen. Die Schüler sind oft nicht mit effektiven Lernmethoden vertraut, was Frustration und Hilflosigkeit hervor ruft, wenn eine Aufgabe nicht gelöst werden kann (Schmidt et al., 2010).
“[…] students with special needs develop feelings of incompetence, distrust and inadequacy when confronting their own limitations and difficulties in the learning process; they therefore resort to passivity and self-isolation [...].” (ebenda)
Demzufolge ist es Aufgabe des Übergangssystems, die Schüler mit erfolgsversprechenden Lernstrategien bekannt zu machen, ihnen die Praxisnähe des Lernstoffes zu kommunizieren und ihr Selbstvertrauen zu stärken.
Offensichtlich kann das Selbstkonzept der Jugendlichen dadurch verbessert werden, indem man diese in ihrem Selbstvertrauen stärkt und sie so eine zuversichtlichere, aber dennoch realistische Einstellung gegenüber ihrer Zukunft einnehmen können. Zur Identitätsentwicklung trägt maßgeblich eine Berufsorientierung bei. Auch die Persönlichkeitsentwicklung der Jugendlichen steht hier an erster Stelle. Eine Förderung der Selbstregulationskompetenzen ist ebenfalls unerlässlich. Hier ist die Kenntnis der Jugendlichen über deren Einfluss auf ihren Lernerfolg entscheidend. Die Aufklärung über effektive Lernstrategien und eine Vermittlung der Praxisnähe im Unterricht helfen darüber hinaus, Lernbeeinträchtigungen zu überwinden.
3.3 Bedeutung der Lehrkraft
“Unless there is a physical disability that hinders their progress, all children will learn to walk, and to talk. They will be born with an urge to explore and learn about their environment. Unfortunately, as they grow, and social factors impact upon their development, this innate capacity for learning may become inhibited or directed towards activities that are not in tune with their inner drive towards selfactualization. […] [Y]oung people have many learning skills they already have. Having this belief means we can encourage young people to recognize the resources they have, and to overcome the barriers to learning they may have developed through their life experiences.” (Turnbull, 2009, S. 50)
Die Frage ist: Welche Rolle spielt der Lehrer dabei, die Motivation der Schüler zu beeinflussen? Kann er überhaupt positiv auf die Schüler einwirken oder wird die Lernmotivation der Heranwachsenden von anderen Faktoren geleitet?
Laut Decker (1985, S. 54-55) können Individuen nur dann motiviert sein, wenn auch das Umfeld des Schülers, wie zum Beispiel der Unterricht, antreibend wirkt. So sind „die Motivkräfte, die Motivationsfähigkeit ebenso wie vorhandene Anlagen“ (ebenda, S. 55) verantwortlich für das Vorwärtskommen der Jugendlichen. Diese werden durch das schulische, das familiäre sowie das gesellschaftliche Umfeld beeinflusst (ebenda, S. 54-55).
Neben Freunden und Eltern, die die Motivation des Schülers sowohl positiv wie auch negativ beeinflussen können, kann die Lehrkraft als Teil dieser Umwelt zur Lernmotivation beitragen. Herauszufinden, für welchen Stoff sich die Jugendlichen interessieren und diesen wenn möglich in den Unterricht einzubauen, genügt dazu allerdings nicht. Damit wird nur die bereits vorhandene Motivation der Jugendlichen aktiviert. Vielmehr muss die Motivation als ein Netzwerk angesehen werden, welches sich aus dem Verständnis, den Fähigkeiten, den Werten und der Veranlagung des Schülers zusammensetzt und ihm ermöglicht, sich für das Lernen zu begeistern. Dazu muss sowohl die Absicht vorhanden sein, Ziele erreichen zu wollen, als auch die Kenntnis über gewisse Lernstrategien. Demzufolge sollte der Lehrer die Lernmotivation der Schüler in jeder Lernsituation anregen, sodass das Wissen oder die Fähigkeit, welche durch die Aufgabe erlernt werden soll, vermittelt werden kann. Wenn dies der Lehrende täglich anstrebt, wird man kumulative Erfolge bei der Lernmotivation der Schüler sehen können, die nicht nur kurzzeitig andauert (Brophy, 2010, S. 14-15).
„Aufgabe des Lehrers ist es, Lernmotivierung zu leisten und damit Motive zur Förderung der Lernaktivität an den Schüler heranzubringen und den Motivationsprozeß [!] einzuleiten.“ (Buthig, 1979, S. 12). Motive werden zwar als relativ beständige, unwandelbare Persönlichkeitsfaktoren angesehen (Eck, 1988, S. 49), was folgende Aussage von Schiefele (1963, S. 138) verdeutlicht:
„Der Mensch ist nicht manipulierbar, nicht machbar. Was also kann der Lehrer tun? Was nützt ihn die Kenntnis einer Motivationslehre, wenn ihm doch in der Autonomie der Motivaktivierung des Schülers Grenzen gesetzt sind? Was die Motivationslehre nicht leistet, ist offenbar. Sie gibt keinerlei Möglichkeit und enthält keine Anweisung, in die Persönlichkeit des Kindes einzubrechen. Sie ist keine Sammlung von Rezepten, wie man den Schüler mit List und Täuschung zu seinem eigenen Besten übervorteilt.“
Dennoch können bestimmte Lernbedingungen und Methoden, die die Lehrkraft im Unterricht einsetzt, positiv auf die Motivation der Schüler einwirken. Diese können das Leistungsmotiv der Jugendlichen gezielt beeinflussen und die Lernmotivation begünstigen. Motivationsfördernd ist es zum Beispiel, den Schülern die Möglichkeit zu geben, Aufgaben eigenständig zu initiieren und diese selbstverantwortlich zu lösen. So wird den Jugendlichen in der Berufsausbildungsvorbereitung ein Verursachererleben ermöglicht, welches die Erfahrung, einen entscheidenden Einfluss auf die Umwelt nehmen zu können, mit sich bringt und das Gefühl mindert, dieser hilflos ausgesetzt zu sein. Dabei ist die Eigenverantwortlichkeit für die Zielerreichung von besonderer Bedeutung. Ebenso wichtig ist die Setzung der Lernziele, die sowohl anspruchsvoll, als auch erreichbar sein sollen und damit zu Erfolgserlebnissen verhelfen. Durch die anschließende Beurteilung der Leistungen seitens der Lehrkraft, kann eine realistische Zielauswahl der Schüler geschult werden. So wird der Schüler auf seine persönliche Entwicklung aufmerksam, wenn er seine Ergebnisse im Vergleich mit den Leistungen seiner Klassenkameraden sieht. Aufgabe des Lehrers ist es hier, mit den Erfolgen der Schüler eine positive Selbstbekräftigung bei den Jugendlichen hervorzurufen (Eck, 1988, S. 49).
Umstritten ist, ob die Lehrkraft Misserfolge der Jugendlichen stets deren unzureichendem Eifer beimessen sollte. Damit gelten Niederlagen zwar als korrigierbar und können den Schüler dazu veranlassen, weiter an sich zu arbeiten. Jedoch sollten Schüler, „die an die Grenze ihrer Leistungsfähigkeit stoßen, […] nicht fälschlicherweise dazu gebracht werden, Misserfolge mangelnder Anstrengung zuzuschreiben, um dann bei einer erfolglosen Steigerung der Anstrengung umso frustrierter zu werden“ (ebenda). Deshalb sollte die Ursachenzuschreibung differenziert betrachtet und jeder Schüler seitens des Lehrers entsprechend gefördert werden. Während es manchen Schülern helfen kann, wenn sie sich ihre Fehler selbst zuschreiben, ist es bei anderen wichtig, dass sie die Schwierigkeit der Aufgabe und andere Gegebenheiten in ihre Beurteilung mit einbeziehen und so Misserfolge nicht unmittelbar auf die eigene Unfähigkeit zurückführen (ebenda).
Besonders diejenigen Schüler, die schlechte Lernerfahrungen machen mussten und durch Unsicherheit und Angst geprägt sind, sind hier auf eine Lehrkraft angewiesen, die sie wertschätzt und ihnen Mut zuspricht. Daher muss ein Vertrauensverhältnis zwischen Lehrer und Schüler geschafft werden, in dem Verständnis und Geduld gezeigt wird, aber auch die Autorität der Lehrkraft nicht zu kurz kommt (Decker 1985, S. 125-126).
All diese Maßnahmen sollen die Jugendlichen zum Lernen motivieren, indem ihnen stets der Weg zu Erfolgserlebnissen geebnet wird (Eck, 1988, S. 49).
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Lehrer neben dem familiären Umkreis und den Freunden der Jugendlichen, sehr wohl einen Einfluss auf die Lernmotivation seiner Schüler nehmen kann, welche sich sogar kumulativ und anhaltend steigern lässt. Interpretiert er die Ursachen mangelnder Lernmotivation allerdings falsch, so kann dies auch negative Folgen für die Lernmotivation der Schüler haben.
[...]
[1] Zu Schlüsselqualifikationen gehören „Kritik-, Konflikt- und Dialogfähigkeit als Sozialkompetenz , […] Lern- und Arbeitstechniken, […] Problemlösungsfähigkeit, […] [die] Fähigkeit, Informationen zu beschaffen und zu verarbeiten, als Methodenkompetenz im Sinne des lebenslangen Lernens und schließlich […] Subjektkompetenzen , das sind die Fähigkeiten zu einer selbstbestimmten Lebensführung in einer individualisierten Gesellschaft“ (BMBF, 2005, S. 107).
[2] „Die betriebliche Einstiegsqualifizierung (EQ) wurde im Rahmen des Ausbildungspaktes entwickelt, um Bewerbern mit eingeschränkter Vermittlungsperspektive als Brücke in die Berufsausbildung zu dienen. Als betriebliches Langzeitpraktikum von mindestens 6 bis maximal 12 Monaten bietet sie Bewerbern die Möglichkeit zu zeigen, was in ihnen steckt, und den Betrieben die Chance, den potentiellen Fachkräftenachwuchs näher kennen zu lernen und mehr zu sehen als Schulzeugnisse aussagen“ (Zentralverband des Deutschen Handwerks e.V [ZDH], 2011).
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Erstausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2011
- ISBN (Paperback)
- 9783863412401
- ISBN (PDF)
- 9783863417406
- Dateigröße
- 508 KB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
- Erscheinungsdatum
- 2013 (Juli)
- Note
- 1
- Schlagworte
- Motivationsförderung Benachteiligtenförderung Berufsvorbereitungsjahr Berufsgrundbildungsjahr Projektarbeit Jugendlicher Berufsschulunterricht
- Produktsicherheit
- BACHELOR + MASTER Publishing