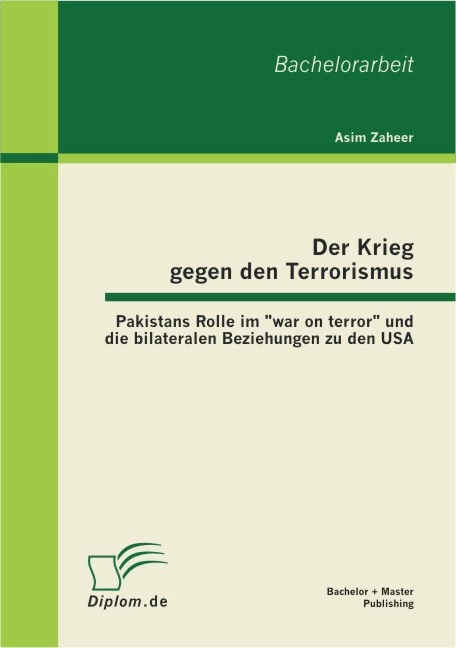Der Krieg gegen den Terrorismus: Pakistans Rolle im "war on terror" und die bilateralen Beziehungen zu den USA
Zusammenfassung
Für die Perspektiven pakistanisch-amerikanischer Beziehungen erwartet der Autor eine Normalisierung der Beziehungen in den nächsten Jahren. Der Abzug der NATO-ISAF aus Afghanistan in 2014 und die Beziehungen Pakistans zu anderen Staaten machen eine Reaktivierung der pakistanisch-amerikanischen Beziehungen dringend Notwendig. Die amerikanische Vorherrschaft in Asien wird zwar noch einige Jahre aufrechtzuerhalten sein, jedoch mit enormen Kosten für die USA. Für die ‚post-USA’-Ära in Afghanistan hat Pakistan bisher keine neue Strategie verkündet. Es kann davon ausgegangen werden, dass Pakistan wie in den 1990er Afghanistan als seine Einflusszone ansieht und versuchen wird dem […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1 Forschungsprogramme der Internationalen Beziehungen
Im Folgenden werden aufgrund der Fragestellung und des Forschungsgegenstands aus den für die Analyse ausgewählten Forschungsprogrammen der IB, dem Realismus und Konstruktivismus, die relevanten Begriffe und Konzepte hergeleitet. Beide Forschungsprogramme werden als kombinatorischer Ansatz auf die Analyse angewandt. Über die Anzahl und Abgrenzung der Forschungsprogramme der IB kann weiterhin gestritten werden, nach List (2006) können jedoch vier Forschungsprogramme unterschieden werden; Idealismus/Institutionalismus, Realismus, gesellschaftskritische Ansätze und Konstruktivismus. Bei der Auswahl der beiden Forschungsprogramme Realismus und Konstruktivismus für die Analyse handelt es sich nicht um eine bloße ad-hoc Erklärung, vielmehr sollen sie dazu dienen, die Fragestellung auf der individuellen, nationalen und internationalen Ebene zu verfeinern bzw. den Forschungsrahmen mit ihren spezifischen Annahmen und Erklärungsmustern vorgeben.
1.1 Realistische Denkschule
Der Realismus oder die realistische Denkschule der Internationalen Beziehungen geht davon aus, dass erst Macht im Weberschen Sinne das Politische konstituiert. Macht ist demnach die Durchsetzungsfähigkeit eines Akteurs seine Umgebung nach seiner Vorstellung zu beeinflussen. Realisten sind jedoch keine Apologeten, sie betonen auch die Ethik des Möglichen. Antike Realisten wie Thukydides, Kautilya und Sun Tzu kannten die Folgen des Machtmissbrauchs und warnten vor ungezügelter Machtanhäufung, wie der berühmte Melier-Dialog des Thukydides beweist (vgl. Thukydides & Vretska 2005). Realisten der früheren Neuzeit wie Niccolo Machiavelli und Thomas Hobbes mussten die negativen Folgen einer Machtkonzentration selbst miterleben und waren daher einem „kritischen Ansatz“ zugeneigt und rieten zum vorsichtigen Umgang mit der Macht, insbesondere militärischer Macht. Der Realismus geht aufgrund seiner Anthropologie von einem „war of every man, against every man“ (Hobbes & Gaskin 2008: 84) als den wahrscheinlichsten Zustand zwischen Menschen aus, wobei eine formale Anarchie (im Sinne von Heterarchie) und die Gleichheit unter ihnen als Naturzustand vorausgesetzt wird, welches unweigerlich zu einem Sicherheitsdilemma führt. Aus dieser Perspektive erscheint die Selbsthilfe als das einzige Mittel zur Interessenwahrung und das Streben nach Macht zur Notwendigkeit. Der Kampf um Überleben und Ressourcen steht im Zentrum des politischen Handelns, für Ethik und Moral ist in der autonomen politischen Sphäre nur wenig Raum, nur wo es dem höheren machtpolitischen Interessen dient ist sie als „nützlich“ anzusehen. Um Macht zu erlangen und zu stabilisieren, ist nach Machiavelli virtù (Tüchtigkeit), fortuna (Glück) und occasione (Gelegenheit) erforderlich (vgl. Machiavelli & von Oppeln-Bronikowski 2001).
Der historische Hintergrund, die Bildung des Westfälischen Staatensystems 1648 und der Wiener Kongress 1815, sind für die zentrale Rolle der Staatsräson und der Machtbalance in den realistischen Ansätzen maßgeblich. Erst die Entstehung des modernen Staates und die Befunde der Staatswissenschaft führten zu einer Ent-Personifizierung der Politik. Der als Klassischer Realismus bezeichnete Ansatz wurde in den 1930er von Hans Morgenthau (1993) in den USA als Kritik an den gescheiterten Idealismus der Wilson-Ära mit Rekurs auf die „klassischen Denker“ entwickelt. Wie bei früheren Realisten ist auch bei ihm die Macht als die Antriebskraft jeglichen menschlichen Handelns anzusehen, diese wird anthropologisch begründet und auf Staaten projiziert. Macht bedeutet hier die Überwindung des Status quo. Die Ontologie ist materiell, wobei jeder Staat, je nach seinen geopolitischen Bedingungen und seiner Fähigkeit die internationalen Beziehungen zu beeinflussen, das Ziel der Machtbewahrung, Machterweiterung oder der Machtdemonstration verfolgt. Jedoch orientieren sich die Staaten unter der Rationalitätsannahme nicht an absoluten Gewinnen, sondern sind an relative Gewinne interessiert, womit ein Mächtegleichgewicht (balance of power) hergestellt werden kann, der die imperialen Absichten eines Staates zu kontrollieren versucht und Allianzen in bestimmten Politikfeldern erlaubt (vgl. Morgenthau & Thompson 1993).
Auf den klassischen Realismus beruhend, entwickelte Kenneth Waltz (1979) den als Struktureller Realismus oder Neorealismus bezeichneten Ansatz. Sein Ansatz stellt eine Verengung der Annahmen klassischer Realisten dar. Im Unterschied zu Morgenthau begründet er das Machtstreben der Staaten nicht anthropologisch, sondern führt dies auf die anarchische Struktur des internationalen Systems zurück. Für Waltz ist die materielle Struktur des internationalen Systems ein geschlossenes System relativer Machtpositionen der Staaten, wobei Staaten nicht als die einzigen, aber als die „major actors“ der internationalen Politik verstanden werden (Waltz 1979: 93). Seine Struktur des internationalen Systems ist durch drei Elemente definiert, „[…] first, according to the principle by which it is ordered; second, by specification of the functions of formally differentiated units; and third, by the distribution of capabilities across those units“ (Waltz 1979: 82). Als monozentrische Entscheidungssysteme handeln Staaten wie Individuen rational, womit klare Aussagen über die Verhaltensweisen der Akteure möglich sind. Sein Ansatz beruht auf mikroökonomische Überlegungen und zeichnet sich durch seine Sparsamkeit aus. Dass dabei wichtige Faktoren wie Wahrnehmung, Werte und Absichten der Akteure vernachlässigt werden, wird bewusst in Kauf genommen. Bei genauer Betrachtung stellt man jedoch fest, dass Waltz die materiellen Bedingungen zwar als kausal aber nicht als hinreichend für eine Theorie der Internationalen Beziehungen ansieht. Eine rein materialistische Erklärung der internationalen Politik macht auch für ihn keinen Sinn, daher fordert er auch die Außenpolitik individueller Akteure bei der Formulierung einer Theorie der Internationalen Beziehungen einzubeziehen (vgl. Waltz [2000] 2008). Bei der Frage, ob die anarchische Struktur des internationalen Systems eher permissiv im Bezug auf ihr Handeln im System ist oder normativ gezügelt wird, entstanden zwei Strömungen des Neorealismus. Während Stephen Walt (1990) im defensiven Neorealismus die Selbsteinschränkung und Allianzbildung als grundlegendes Interesse eines jeden Akteurs ausarbeitete, legte John Mearsheimer (2001) in seiner Arbeit den Grundstein für den offensiven Neorealismus, bei dem eine freiwillige Selbstverpflichtung des Akteurs keinen Nutzen bringt und gar schädlich sein kann (vgl. Walt 1990, Mearsheimer 2001).
In der anarchischen Struktur des internationalen Systems versuchen alle Staaten ihre Macht zu erhalten bzw. zu erweitern. Dies führt unweigerlich zu Interessenskonflikten zwischen den Staaten. Aufgrund ihrer Macht und ihren Einflussmöglichkeiten verhalten sich Staaten sehr unterschiedlich auf der internationalen Ebene. „States tray various strategies for survival. Balancing is one of them; bandwagoning is another“ (Waltz 2008a: 222). Während starke Staaten nach Hegemonie streben, verfolgen schwache Staaten lediglich den Machterhalt an. „States having a surplus power are tempted to use it, and weaker states fear their doing so“ (Waltz 2008a: 203). Hegemonie eines starken Staats kann je nach der Polarisation uni,- bi- oder multipolar und die Machtverteilung zwischen den Staaten im System zum unterschiedlichen Verhalten der Staaten führen. „Whether political actors balance each other or climb on the bandwagon depends on the system’ structure“ (Waltz 1979: 125). Das internationale System sollte jedoch nicht als statisch angesehen werden, es ist ganz im Gegenteil hoch dynamisch. „The expectation is not that balance, once achieved, will be maintained, but that a balance, once disrupted, will be restored in one way or another” (Waltz 1979: 128). Im bipolaren System, wie im Kalten Krieg, ist ein Gleichgewicht der Mächte stabilisierend und aufgrund der Machtkonzentration einfacher zu realisieren.
“Competition in multipolar system is more complicated than competition in bipolar ones because uncertainties about the comparative capabilities of states multiply as numbers grow, and because estimates of cohesiveness and strength of coalition are hard to make.” (Waltz 2008a: 197)
Staaten haben auch die Möglichkeit einer Allianzbildung (bandwagoning) um externen Bedrohungen zu begegnen. Da sie jedoch nie sicher sein können doch nicht von ihrem Bündnispartner hintergangen zu werden, ist „balancing“ die attraktivste der beiden Möglichkeiten (vgl. Mearsheimer 2001). Walt (1990) argumentiert, dass Staaten nicht hauptsächlich auf ungleiche Verteilung der Macht (imbalance of power) zwischen ihnen reagieren, sondern versuchen die von ihnen wahrgenommene Bedrohung auszugleichen (balance of threat). Die Bedrohungswahrnehmung der Staaten ist bei ihm ein Produkt der tatsächlichen Macht, der geografischen Lage und seiner offensiven Kapazitäten. Interne Faktoren der Bedrohungswahrnehmung werden hier nur unzureichend berücksichtigt. Schwache Staaten können demnach aus zwei Gründen sich für eine „bandwagoning“ Strategie entscheiden. Erstens defensiv, um durch Kooperation mit einem aggressiven Hegemon der Bestrafung zu entgehen, was als Appeasement-Politik bekannt ist. Oder zweitens offensiv als opportunistisches Kalkül, um in der Allianz Profit zu erzielen. In beiden Fällen wird jedoch den Staaten ein Status-Quo orientiertes Verhalten unterstellt (vgl. Walt 1990, Mearsheimer 2001). Revisionistische Staaten, welche zwar ihre relativen Gewinne sichern wollen, jedoch die Machtzuwächse anderer Staaten im System kritisch ansehen, werden hier nur am Rande behandelt.
Die Synthese des Neorealismus mit dem klassischen Realismus gepaart mit liberalen und konstruktivistischen Ansätzen wird als Neoklassischer Realismus bezeichnet. Darin unterscheidet Schweller (1994), ähnlich wie einst Machiavelli im Fürsten, in Metaphern zwischen zwei revisionistischen Staaten, dem Wolf- und dem Schakal-Staat. „Just as the lion attracts jackals, a powerful revisionists state or coalition attracts opportunist powers“ und weiter “The goal of ‘jackal bandwagoning’ is profit” (Schweller 1994: 23). Während der Wolf-Staat höhere Risiken in Kauf nimmt, um seine Interessen durchzusetzen und die revisionistischen Staaten anführt, versucht der Schakal-Staat sowohl gegenüber dem Löwen wie auch gegenüber dem Wolf eine „bandwagoning“ Strategie. Dabei spielt der Zeitpunkt der Kooperation eine wichtige Rolle. Ein kooperatives Verhalten gegenüber einem dominanten, Status-Quo orientierten Staat ohne unmittelbare Bedrohung und eine durch Zwang erreichte Kooperation eines revisionistischen Staates stellen zwei verschiedene Arten des „bandwagoning“ dar. Wie verhalten sich Staaten, wenn ihr Primärinteresse „Sicherheit“ gewährleistet ist? „Unthreatened revisionist states (those overlooked by Walt and Waltzian neorealists) often bandwagon with the stronger revisionist state or coalition for opportunistic reasons” (Schweller 1997). Nicht die Bedrohung (balance of threat), sondern die Interessen (balance of interest) stehen hierbei im Vordergrund. Neben „balancing“ und „bandwagoning“ sieht er auch „underbalancing“ als eine Möglichkeit (vgl. ebd.).
„When a state underbalances it either misperceives the intentions of the rising power as more benign than they in fact are or, if it correctly perceives the threat, does not adopt prudent policies to protect itself for reasons of domestic politics.” (Schweller 2006: 10 f.)
Er betont innerstaatliche Faktoren wie “elite consensus, elite cohesion, social cohesion” und die Regimestabilität in den Staaten als intervenierende Variablen für das außenpolitische Verhalten eines Staates (ebd.).
Die Englische Schule der IB, die die Ideen des Funktionalismus mit dem Realismus zu verbinden versucht, entstand unabhängig von Morgenthau ebenfalls in den 1930er in England. Darin wird angenommen, dass die als Staatengemeinschaft verstandene Umwelt weitaus mehr ist als das internationale System im Realismus. Staaten handeln demnach nicht mechanisch wie in der „balance of power“ Theorie suggeriert, sondern haben immer auch gemeinsame Interessen, Werte und Identitäten. Dies führt zur Zusammenarbeit der Staaten in internationalen Institutionen (vgl. Buzan, Jones & Little 1993). Als Kritik an Waltz Struktur des internationalen Systems, die ein Systemwandel bzw. Transition nicht oder unzureichend erklärt, versuchen Anhänger der Englischen Schule die internen Faktoren des Systemwandels mit dem Structure-Agency (Struktur-Handeln) Ansatz des Konstruktivismus zu erklären. Sie sehen das Ordnungsprinzip des Realismus nicht als zwangsläufig gegeben an, sondern betonen die Interaktionen zwischen Staat und Struktur als systemisch. „Structure is therefore only one component of a more complex systemic equation. There is not one logic of anarchy but many” (Buzan, Jones & Little 1993: 133).
Wie oben gezeigt ist der Realismus nicht als eine einheitliche Theorie zu verstehen, es existieren verschiedene Strömung des Realismus, die in Bezug auf ihrem typischen Vorverständnis, der Fragestellung und der Methode unter der Bezeichnung Realismus zusammengefasst werden können. Die Einbeziehung konstruktivistischer Befunde als Ergänzung zu realistischen Ansätzen, wie oben am Beispiel des Neoklassischen Realismus und der Englischen Schule gezeigt, wird als fruchtbar angesehen. Dies wird mit dem Ende des Kalten Krieges und dem Bedeutungszuwachs nichtstaatlicher Akteure im Bereich der internationalen Politik sowie der Globalisierungstendenzen begründet.
1.2 Konstruktivistische Denkschule
Als Kritik an den rationalistisch-materialistischen Annahmen des Realismus wurde der als struktureller Konstruktivismus bezeichnete Ansatz in den 1990er, nach dem Zusammenbruch des bipolaren Systems, sehr aktiv und liefert seitdem interessante Theoriedebatten mit dem Realismus, Institutionalismus und Liberalismus (vgl. List 2006). Konstruktivismus ist jedoch kein eigenständiges Forschungsprogramm, dass sich epistemologisch oder methodologisch von anderen unterscheidet, sondern bedarf immer einer Handlungstheorie anderer Ansätze. Die Außenpolitik wird dabei als Lernprozess und nicht als Anpassungsprozess charakterisiert. Bereits nach der Kuba-Krise 1962/63 wurde die Kritik am Realismus in den Debatten der IB deutlich und eine Brücke zwischen Realismus und Liberalismus gefordert. Konstruktivismus nimmt damit die Impulse aus der Soziologie auf und löst das für den Realismus sehr problematische Sicherheitsdilemma der internationalen Anarchie auf. Die Realität wird sozial konstruiert und aus der gesellschaftlichen Konstruktion der Wirklichkeit folgt dann durch Internalisierung eine wechselseitige Konstituiertheit von Struktur und Akteur (vgl. Wendt 1999). Wendts knappe Erklärung lautet: „Anarchy is what the states make of it“ (Wendt 1992). Beobachtet wird nicht auf der Struktur, sondern aus der Perspektive des Akteurs. Durch Deutung und Interpretation gelangt man zu einem genaueren Verständnis der physischen Realität. Dem rational operierenden Akteur im Realismus steht damit ein „homo sociologicus“ entgegen, der nicht nach der Logik der Konsequenz sondern nach der Logik der Angemessenheit handelt. Angemessenheit bedeutet hier, im Rahmen „moralischer“, gesellschaftlicher und sozialer Regeln und Erwartungen zu Handeln (vgl. Wendt 1999). Durch intersubjektiv geteilte Werte, Erwartungen und Ideen handeln Akteure demnach norm- und regelgeleitet. „The effects of anarchy are contingent on the desires and beliefs states have and the policies they pursue. There simply is no ‘logic of anarchy’” (Wendt 1999: 146). Die Anarchie im Realismus wird von Wendt als Hobbes’sche Kultur der Anarchie verstanden, in der ein Krieg aller gegen alle befürchtet werden muss. Daneben existieren noch die Locke’sche, in der die Bedrohung nicht allgegenwärtig jedoch Rivalität latent vorhanden ist und die Kantianische Kultur der Anarchie. Die letztgenannte betont die Kooperation und führt drei Ebenen zur Internalisierung der Freundschaft auf. Auf der ersten ist die Kooperation erzwungen, auf der zweiten aus Eigennutzen angestrebt und auf der dritten als Anerkennung gegenseitiger Identifikation verstanden. Kooperationshindernisse aus Mangel an gemeinsamen Zielen und Problemlösungs-strategien führen zu einer negativen Rückkopplung, während eine positive Rückkopplung die Kooperation fördert (vgl. Wendt 1999, Wendt 1992). Damit werden die Beziehungen zwischen Staaten nicht als feindlich sondern vielfältig angesehen. Im Gegensatz zum Realismus ist das Untersuchungsfeld des Konstruktivismus nicht die (militärische) Sicherheit sondern die Akteur-Struktur-Beziehung, in der Identitäten, Ideen und Normen eine große Rolle spielen. „[…] the daily life of international politics is an on-going process of states taking identities in relation to Others, casting them into corresponding counter-identities, and playing out the results” (Wendt 1999: 21). Nach Wendt erhält die Sprache ihre (Be)-Deutung nur im Kontext der Situation und des Akteurs (Sprechers) und darf bei der Analyse der internationalen Beziehungen nicht vernachlässigt werden. Die Struktur des internationalen Systems hat für ihn primäre Relevanz, womit seine Nähe zu realistischen Ansätzen deutlich wird. Dies ist insofern für die vorliegende Arbeit interessant, da sich der Konstruktivismus nach Wendt hier einen Berührungspunkt mit dem Realismus aufweist und somit einen kombinatorischen Ansatz ermöglicht.
2 Geopolitik auf dem „Eurasischen Schachbrett“
Heartland-Theory
Der Geograph der Royal Geographical Society in London, Sir Halford Mackinder veröffentlichte 1904 in der Zeitschrift „The Geographical Journal” einen Aufsatz mit dem Titel „The geopolitical pivot of history“, in dem er einen Wandel der klassischen Geografie von einer lediglich auf Entdeckungen ausgerichteten Disziplin zu einer für die politische Beratung nutzbaren, erklärenden Wissenschaft forderte (vgl. Mackinder 1904). Die von ihm erstellte Weltkarte besteht aus der „world island“ (Europa, Asien und Afrika), „inner crescent“ (Eurasische Küstenregion, Kontinentaleuropa) und der „outer crescent“ (Britannien, amerikanischer Kontinent, Australien und Japan). Die Region um den geopolitischen Mittelpunkt Eurasiens bezeichnet er als „Heartland“ und schreibt dazu: „whoever rules East Europe commands the Heartland; whoever rules the heartland commands the World-Island; whoever rules the World-Island commands the World” (Mackinder 1904). Sein Herzland umfasste das heutige Iran, Zentralasien, Russland, Osteuropa und China. Dies ist genau die Region, die für das „Empire“ als Seemacht Anfang des 20. Jahrhunderts sehr schwierig zu erreichen war. Das „Great Game“ (Rashid 2010b: 6), ein Interessenkonflikt um die Vorherrschaft in Zentralasien zwischen Britannien und Russland, endete zwischen den beiden Weltkriegen als die Pax Britannica zunehmend in sich zusammenbrach und nach dem zweiten Weltkrieg endgültig durch die Pax Americana abgelöst wurde. Das Herzland blieb während des Ost-West-Konflikts (OWK) unter sowjetischer Kontrolle und gewann erst in den 1990er in den USA unter veränderten geopolitischen Bedingungen wieder an Bedeutung. Die als Kern des Herzlands angesehenen Sowjetrepubliken Kasachstan, Turkmenistan, Tadschikistan, Georgien und Ukraine waren nun unabhängig. Hinzu kamen der technische Fortschritt in der Erkundung der Bodenschätze und der unstillbare Hunger der Weltwirtschaft nach fossilen Energieträgern. So werden ca. 75% der vorhandenen Welterdölvorkommen und 70% der Welterdgasvorkommen in Zentralasien und am Persischen Golf vermutet (vgl. Gresh, Radvaniya & Rekacewicz et al. 2009).
Das Eurasische Schachbrett
Der aus der Ukraine stammende Sicherheitsberater des US-Präsidenten Jimmy Carter Zbignew Brzezinzki (1997) entwickelte wie zuvor Mackinder eine geopolitische Karte der Welt. In seiner Abhandlung sieht er Eurasien als das Schachbrett auf dem der Kampf um die Vorherrschaft der USA ausgetragen wird und teilt Eurasien in vier Räume (space) auf. Dabei entspricht „middle space“ Russland, „western space“ Europa, „eastern space“ Ost- und Südostasien und schließlich „south space“ Süd- und Zentralasien sowie der Mittlere Osten und schreibt:
“Eurasia, however, retains its geopolitical importance. Not only is its western periphery – Europe– still the location of much of the world’s political economic power, but its eastern region – Asia – has lately become a vital centre of economic growth and rising political influence.” (Brzezinski 1997: 1)
Und weiter: “Eurasia is thus the chessboard on which the struggle for global primacy continues to be played, and that struggle involves geostrategy – the strategic management of geopolitical interests” (Brzezinski 1997: 2). Während des OWK stand die Eindämmungspolitik (containment policy) im Mittelpunkt der amerikanischen Außenpolitik, so wurde in zweifacher Weise versucht den Einfluss der Sowjetunion in Asien Einzudämmen.
“The Soviet invasion of Afghanistan precipitated a two-pronged American response: direct U.S. assistance to the native resistance in Afghanistan in order to bog down the Soviet army; and a large-scale buildup of the U.S. military presence in the Persian Gulf as a deterrent to any further southward projection of Soviet political or military power.” (Brzezinski 1997: 7)
Nach dem Ende des OWK gewannen die USA die Vorherrschaft auf dem Eurasischen Kontinent und errichteten mit Europa, Südost- und Ostasien und am Persischen Golf strategische Brückenköpfe. Ihre Strategie war jedoch immer noch vom Kalten Krieg geprägt und „As a result, America increasingly finds itself with a unipolar mind-set and a bipolar toolbox in a multipolar world“ (Hulsman & Mitchell 2009: 9). Aufgrund des Fehlens revisionistischer Großmächte wurde die Vorherrschaft der USA in Eurasien kaum in Frage gestellt. Russland lag militärisch, politisch wie auch wirtschaftlich am Boden, China und Indien zu sehr auf Ökonomie bedacht und die Islamische Welt verharrte weiter in Lethargie. “Now a non-Eurasian power is pre-eminent in Eurasia – and America’s global primacy is directly dependent on how long and how effectively its preponderance on the Eurasia continent is sustained” (Brzezinski 1997: 30). Die Region, die Brzezinski durch eine strategische Ellipse darstellt, hat eine verblüffende Ähnlichkeit mit dem Herzland Mackinders. Die strategische Ellipse ist jedoch wesentlich kleiner und fasst im Kern die energiereiche Region Zentralasien und den Persischen Golf zusammen. Die heterogene Bevölkerungsstruktur und ein relativ hohes Konfliktpotential an ethnischen, religiösen und politischen Konflikten in dieser Region veranlassten Brzezinski auch von einem „Eurasischen-Balkan“ zu sprechen (vgl. Brzezinski 1997: 215). Pakistan liegt am östlichen Rand der „Strategischen Ellipse“ und ist daher aus geopolitischen Gründen von besonderer Bedeutung für die USA. Der kostengünstige Transport von Erdöl und Erdgas aus Zentralasien ist nur über Iran oder Pakistan zum Persischen Golf oder zum Arabischen Meer kostengünstig möglich. Das amerikanische Energieunternehmen Union Oil Company of California (UNOCAL)[1] plante bereits in den 1990er eine Gaspipeline von Daulatabad (Turkmenistan) über Afghanistan zum pakistanischen Seehafen Gwadar. Auch mit dem Taliban-Regime in Afghanistan wurde Ende der 1990er über das Projekt beraten (vgl. Rashid 2010b: 143 ff.).
New Great Game
Im amerikanischen Kongress wurde 1999 und 2006 auch über eine neue Zentralasien-Strategie der USA debattiert und eine Gesetzesvorlage mit der Bezeichnung „Silkroad Strategy Act“ eingebracht (vgl. – 1999, - 2006). Beide Gesetzesvorlagen konnten jedoch aufgrund fehlender Mehrheiten im Senat nicht verabschiedet werden. Die USA haben jedoch vitale Interessen in Zentralasien, die unweigerlich mit den Interessen anderer Großmächte wie Russland, China und Indien konfligieren. Daher empfiehlt Walt: “[…] the United States would maintain a significant military presence in Asia (primarily air and naval forces) and continue to build cooperative security partnership with its current Asian allies” (Walt 2006: 241). Dieser Interessenkonflikt in Zentralasien und am Persischen Golf um die Ausbeutung fossiler Energieträger und der Einrichtung von Luft- und Marinebasen wird als „New Great Game“ bezeichnet (Rashid 2010b: 6). “The struggle for bases, oil, and gas among the United States, Russia, China, and India in Central Asia appeared likely to intensify” (Lind 2006: 146). In Pakistan haben die USA einen Partner, der nicht nur geografisch unweit der strategisch wichtigen Straße von Hormus liegt, sondern auch Luftstützpunkte für die US-Luftwaffe zur Verfügung stellt und den Nachschub für die NATO-ISAF Truppen in Afghanistan sicherstellt. Wie Lind jedoch argumentiert, ist die Hegemonie-Strategie der USA in Asien mit dem amerikanischen „way of life“ nicht zu vereinbaren.
“A U.S. foreign policy based on attempt to discourage the self-reliance of other great powers in favour of their perpetual dependence on the U.S. military is too expensive to be sustained without damage to the American way of life. What the United States needs is a strategy that prevents any hostile power from dominating Asia, the Middle East, or Europe, without requiring the United States itself perpetually to dominate all three regions on its own.” (Lind 2006: 148)
Was Lind hier beschreibt, ist “offshore balancing”, denn die USA sind historisch betrachtet kein Imperium und langfristige Besatzungen werden als „unamerikanisch“ angesehen (vgl. Walt 2006). Mit „offshore balancing“ ist nicht Isolationismus gemeint, sondern eine wohlüberlegte Strategie mit geringst möglichen Kosten für die USA.
“But the hegemony strategy, in which the United States alone bears the burden of deterring or defeating a hostile great power, is far more expensive than the offshore-balancer strategy, in which the burden of deterring or defeating a hostile great power is shared among the members of a great power alliance to which the United States belongs.” (Lind 2006: 173 f.)
Ein Schwachpunkt dabei ist jedoch, dass “It likewise relies heavily on the indirect exercise of influence on dependent foreign elites, while drawing much benefit from the appeal of its democratic principles and institutions” (Brzezinski 1997: 25). Der Grundgedanke hinter dieser Strategie ist “[…] reducing the overall ‘footprint’ of U.S. military power and beginning to play ‘hard to get’ when dealing with various regional powers” (Walt 2006: 240). Pakistan ist für Brzezinski kein geostrategischer Akteur „Erster Klasse“ wie Russland oder China, sondern ein geopolitischer Dreh- und Angelpunkt. Pakistan ist demnach aufgrund seiner prekären geographischen Lage und weniger durch seine Macht und Motivation für die USA in der Region wichtig (vgl. Brzezinski 1997: 66 f.). Aus pakistanischer Sicht argumentiert Lodhi, dass “Its much-celebrated geo-strategic location has been more of a challenge than asset” (Lodhi 2011a: 46). Die „offshore“ Strategie erfordert auch eine starke Einbindung der Eliten in den Staaten dieser Region, was in Pakistan zu erheblichen innerstaatlichen Problemen führt. Die Methoden bei „offshore balancing“ sind altbekannt: „carrots and sticks“. Im Gegensatz zu Anhängern der Realpolitik befürworten Realisten mit „carrots“ zu beginnen, weisen aber daraufhin, dass „[…] a foreign policy, of merely using carrots suffices only in a world dominated by rabbits“ (Hulsman & Mitchell 2009: 66). Ein besonderes Merkmal der amerikanischen Hegemonie ist wie Walt (2005) aufführt: „[…] Because its power is ample and diverse, and because it is not very dependent on any allies at present, it can play a strategy of ‘divide and conquer’ whenever a countervailing coalition threatens to emerge” (Walt 2006: 126).
Im nächsten Kapitel wird die Relevanz der hier dargestellten Konzepte der Geopolitik auf die pakistanisch-amerikanischen Beziehungen reflektiert und eine Verlaufslinie anhand historischer Ereignisse aus pakistanischer Perspektive nachgezeichnet.
3 Historische Verlaufslinie pakistanisch-amerikanischer Beziehungen bis 9/11
Die diplomatischen Beziehungen zwischen Pakistan und USA wurden im Oktober 1947 bereits zwei Monate nach der Unabhängigkeit Pakistans am 14. August aufgenommen. Die Beziehungen beruhten primär auf militärische und wirtschaftliche Unterstützung Pakistans durch die USA und der grundsätzlichen Orientierung Pakistans an den Westen. Beide Staaten hatten sehr unterschiedliche Interessen für die Aufnahme der diplomatischen Beziehungen (vgl. Ali 2008, Kazimi 2009).
„Pakistan needed help against India which had withheld its military assets, while the war had broken out in Kashmir; the US wanted Pakistan’s assistance in encircling the communist states of the USSR and China.” (Kazimi 2009: 292)
Im ersten indisch-pakistanischen Krieg (Kaschmirkrieg 1947/48) erkannte das pakistanische Militär seine strategische Schwäche und suchte präferiert nach internationaler Unterstützung gegen Indien. „When Pakistan was young, we were one of their closest allies, and they relied on us for security“ (Brzezinski & Scowcroft 2008: 105). Die USA unterstützten Pakistan bei den Vereinten Nationen, hielten sich jedoch aufgrund der vorherrschenden Unklarheit über den Kriegshintergrund bei Waffenlieferungen zurück. Der Kriegshintergrund ist bis heute ungeklärt, Indien und Pakistan haben jeweils ihre eigenen Versionen des Geschehens.
Sicher ist jedoch, dass nach der Verabschiedung des Indian Independence Act 1947 am 15. Juli 1947 durch das britische Parlament auf dem indischen Subkontinent zwei souveräne Staaten (dominions) entstehen sollten. Wo genau die Grenze zwischen den beiden Staaten verlaufen sollte, wurde erst am 17. August 1947 zwei Tage nach der Unabhängigkeit von Sir Cyril Redcliffe bekannt gegeben (vgl. Kazimi 2009, Lieven 2011). Die unter britischer Verwaltung stehenden Gebietskörperschaften wurden nach der Bevölkerungsmehrheit als Hindu (Indien) oder Muslim (Pakistan) aufgeteilt. Den unabhängigen Fürstentümern, die ca. 40% des Subkontinents ausmachten, wurde die Wahl überlassen sich für einen der beiden Staaten zu entscheiden. Der Maharadscha vom unabhängigen Kaschmir Hari Singh war Hindu, ca. 70% der Bevölkerung jedoch Muslim. Hari Singh blieb bis zuletzt unentschlossen welchem Staat er sein Fürstentum angliedern sollte. Es kam zu einem Guerillakrieg zwischen pakhtunischen Stammeskriegern aus dem Gebiet Pakistans und den indischen Sicherheitskräften, die der Maharadscha zu seinem eigenen Schutz angefordert hatte. Streitpunkt im Kaschmirkonflikt ist bis heute, ob die pakhtunischen Stammeskrieger oder die indischen Sicherheitskräfte die Grenze zum Fürstentum Kaschmir als erste überschritten. Beide Seiten geben unterschiedliche Versionen der Ereignisse wieder (vgl. Kazimi 2009, Shafqat 2007, Lieven 2011, Paul 2005b).
So wurde der Kaschmirkonflikt bereits beim ersten Staatsbesuch des pakistanischen Premierministers Liaquat Ali Khan in Washington angesprochen und die USA sahen „ [...] Pakistan sympathetically and supported its position on Kashmir in the UN“ (Kazimi 2009: 292). Die Bemühungen der USA bei den Vereinten Nationen mündeten in der Verabschiedung der vier[2] UN-Resolutionen im Sicherheitsrat im laufe des Jahres 1948. In der UNSC-Resolution 47 wurde Indien aufgefordert ein Plebiszit zur Frage der Angliederung Kaschmirs an Pakistan oder Indien abzuhalten (vgl. Kazimi 2009). Die Resolution ließ die dritte Option die Unabhängigkeit Kaschmirs offen, die jedoch von Indien und Pakistan als unrealistisch angesehen wurde. Die genannte UN-Resolution wurde bis heute nicht umgesetzt, 1949 wurde unter UN-Beobachtung lediglich eine Waffenstillstandslinie vereinbart, die ab 1971 als Line of Control (LOC) bezeichnet wird. Damit ist die Grenzfrage im Osten (Indien) sowie im Westen (Afghanistan) auch nach über 60 Jahren nicht eindeutig geklärt. 1949 wurde von der afghanischen Regierung die 1893 mit Britisch-Indien vereinbarte Durrand-Linie zwischen Pakistan und Afghanistan für unrechtmäßig erklärt (Lieven 2011).
Bereits in jungen Jahren wurde Pakistan als Gegenmacht zum sozialistisch geprägten Indien unter Jawaharlal Nehru verstanden und von den USA und vielen islamischen Staaten militärisch aufgebaut. In den 1950er war Pakistan „most allied ally“ (Wirsing 2007: 354) der USA und bei seinem Staatsbesuch in Pakistan unterzeichnete Präsident Dwight D. Eisenhower 1959 die Mutual Defence Treaty, die den Rüstungstransfer stark erhöhte. In 1954 wurde Pakistan auf Druck der USA Mitglied in der Southeast Asia Treaty Organization (SEATO), einer internationalen Organisation unter der Führung der USA, die das Ziel verfolgte, die Ausbreitung des Kommunismus in Südostasien zu verhindern. Der Vietnamkrieg zeigte, dass diese Organisation die Erwartung der USA nicht erfüllte, denn die meisten Mitglieder sprachen sich gegen eine Intervention der USA in Indochina aus. Der in 1955 erfolgte Beitritt Pakistans zum Central Treaty Organization (CENTO), einem reinen Verteidigungsbündnis, verstärkte die militärische Zusammenarbeit Pakistans und der USA. Die USA hatten in der CENTO lediglich Beobachterstatus, da sie aber gleichzeitig auch bilaterale Abkommen mit der Türkei, Iran und Pakistan hatten, waren sie de facto Mitglied der Organisation. Das politische Ziel der CENTO war die Eindämmung des Einfluss der Sowjetunion in der Region.
Die pakistanisch-amerikanischen Beziehungen erreichten in den 1950er und Anfang der 1960er ihren Höhepunkt. So erklärte Präsident Muhammad Ayub Khan am 12. Juli 1960 dem amerikanischen Kongress, dass „[…] the US could land its troops in Pakistan whenever it wished.“ (vgl. Kazimi 2009: 293). Amerikanische Bodentruppen wurden zwar nicht in Pakistan stationiert, jedoch brachte ein über dem sowjetischen Luftraum abgeschossenes U2-Spionageflugzeug der USA die pakistanische Regierung in Bedrängnis. Die Sowjets hatten nicht nur die U2 abgeschossen, sondern auch den Piloten gefangengenommen und als Abflugort Badaber in Pakistan identifiziert, woraufhin Nikita S. Chruschtschow Pakistan die Verantwortung anlastete und im Gegenzug die Indo-Sowjet-Kooperation vorantrieb. Pakistans wachsende Beziehungen zu China in den 1960er wurden von den USA scharf kritisiert und als über den „acceptable limits“ angesehen (vgl. Ali 2008). „Pakistan’s friendship with China became the first cause of friction between the US and Pakistan.” (Kazimi 2009: 297). Als Reaktion darauf begannen die USA auch Indien mit Rüstungsgütern zu versorgen. Der zweite indisch-pakistanische Krieg vom 1965 brachte die abgekühlten pakistanisch-amerikanischen Beziehungen endgültig zum Stillstand. Der Überfall Indiens in Kargil 1965 wurde genau wie die militärische Übernahme Siachins 1985 von den USA erst gar nicht angesprochen. „The US imposed an arms and aid embargo on both India and Pakistan, but harmed only the latter, as India had an alternate source of supply in the USSR” (Kazimi 2009: 293). Dies stellt den ersten Bruch in den pakistanisch-amerikanischen Beziehungen seit der Aufnahme der diplomatischen Beziehungen dar. Die Enttäuschung hat sich bis heute in das kollektive Gedächtnis der Pakistaner eingeprägt und trägt zu den weitverbreiteten Dolchstoßlegenden bei.
Im Laufe des Jahres 1970 gaben die USA ihre Anti-China-Politik auf und drängten Pakistan in eine Vermittlerrolle zwischen Peking und Washington, die Pakistan bereitwillig annahm (vg. Ali 2008). Die zuvor von den USA scharf kritisierten Beziehungen Pakistans zu der Volksrepublik China waren nun sehr willkommen und die USA entlohnten Pakistan für seine Vermittlerrolle mit Schuldenerlass und einer Normalisierung der bilateralen Beziehungen. Diese hielten jedoch nicht sehr lange, im dritten indisch-pakistanischen Krieg 1971/72, der zur Teilung Pakistans und zur Gründung des Staates Bangladesch führte, distanzierten sich die USA von Pakistan. Die Bemühungen des US-Präsidenten Richard M. Nixon um eine Teilung Pakistans zu verhindern, wurden vom Kongress und dem State Department mit Verweis auf die Kriegsverbrechen in der „Operation Searchlight“ des pakistanischen Militärs in Ost-Pakistan (Bangladesch) torpediert (Haqqani 2005: 71). Dass die USA Pakistan im Kampf gegen indische Streitkräfte in Ost-Pakistan die Unterstützung verweigerten, während die Sowjetunion Indien mit Waffenlieferungen unterstützte und Pakistan aufgrund dessen in zwei Teile zerbrach, wird als die zweite große Enttäuschung in den pakistanisch-amerikanischen Beziehungen angesehen (vgl. Haqqani 2005).
Nach dem ersten indischen Atombombentest 1974 (Smiling Buddah) übten die USA auf Pakistan Druck aus, um das Land von einem eigenen Nuklearprogramm abzubringen. Für den Verzicht auf Urananreicherung und den Beitritt Pakistans zur Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT) wurden finanzielle Anreize in Aussicht gestellt. Pakistan hatte sich jedoch bereits auf ein defensives Nuklearprogramm festgelegt. Der damalige Premierminister Zulfikar Ali Bhutto sagte 1974: „Wir werden vielleicht tausend Jahre lang Gras essen, aber wir werden die Bombe herstellen“ (Zulfikar Ali Bhutto zit. in Ali 2008: 134). Der bei einer öffentlichen Veranstaltung geäußerte Satz des Premierministers wird zusammen mit dem im August 1976 geführten Gespräch mit US-Außenminister Henry Kissinger in Islamabad von den meisten Pakistaner als ein amerikanisches „Todesurteil“ gegen Bhutto angesehen. Kissinger kam nach Pakistan, um Präsident Gerald Fords Besorgnis über das pakistanische Nuklearprogramm mitzuteilen und vor den fatalen Konsequenzen für die pakistanisch-amerikanischen Beziehungen zu warnen (vgl. Haqqani 2005). Die Antwort Bhuttos stellte die bilateralen Beziehungen auf eine harte Probe: „Pakistan kann auch ohne den US-Präsidenten leben. Jetzt wird Ihr Volk sich einen anderen Verbündeten in dieser Region suchen müssen“ (Zulfikar Ali Bhutto zit. in Ali 2008: 136). Dies wird von Bhutto-Anhängern als der eigentliche Grund für den Militärputsch durch Zia-ul-Haq 1977 und der Hinrichtung Zulfikar Ali Bhuttos 1978 angesehen. Zia-ul-Haq, der in Fort Leavenworth (Kansas) ausgebildet wurde, war im US-Kongress und mit dem US-Militär gut vernetzt. Das pakistanische Kernwaffenprogramm in Kahota wurde nun unter militärischer Kontrolle gestellt und Zia konnte die USA mit verbalen Zusagen bis 1979 ausweichen, die Beziehungen blieben jedoch auf ein Minimum begrenzt. Ebenfalls 1979 wurde das Symington Amendment von 1976/77 zum Foreign Assistance Act of 1961, der die US-Hilfen an Staaten, die für die USA „riskante Technologien“ (Nuklearwaffen) entwickelten, untersagt, durch die Jimmy Carter-Administration auf Pakistan angewandt (vgl. Haqqani 2005, Lodhi 2011a). Dadurch wurden nun wiederholt alle amerikanischen Leistungen an Pakistan gesetzlich untersagt. Dies stellt den dritten Tiefpunkt in den pakistanisch-amerikanischen Beziehungen dar.
Die sowjetische Invasion in Afghanistan im Dezember 1979 revitalisierte die pakistanisch-amerikanischen Beziehungen wieder. Zia-ul-Haq wurde nun als Verteidiger der Freien Welt gegen den „gottlosen“ Kommunismus und Pakistan als „Frontstaat“ angesehen. Auf ausdrücklichen Wunsch der USA errichtete der pakistanische Geheimdienst Inter Services Intelligence (ISI) ein Büro in Kabul ein und arbeitet mit der Central Intelligence Agency (CIA) der USA an einem verdeckten Programm gegen die Sowjetunion in Afghanistan (vgl. Ali 2008). Für die pakistanisch-amerikanischen Beziehungen brach ein neues Zeitalter an, das Nuklearprogramm, der Kaschmirkonflikt und die pakistanischen Beziehungen zu China traten ins Abseits des politischen Handelns. Der Kampf gegen den Kommunismus stand im Vordergrund und wurde verdeckt und in enger Kooperation des ISI-CIA geführt. Zu jedem amerikanischen Dollar für den Kampf der Mudschaheddin in Afghanistan steuerten die Saudis noch einen weiteren Dollar bei. Mit amerikanischen und saudischen Geldern wurden Waffen und Ausbildung sowie die Grundversorgung der afghanischen Flüchtlinge in Pakistan finanziert (vgl. Synnott 2009). Die pakistanische Armee hatte schon bereits sehr früh darauf bestanden, dass die USA keinen direkten Kontakt zu den verschiedenen Mudschaheddin-Gruppen aufbauen sollten, stattdessen sollten die Hilfen indirekt über den ISI und das pakistanische Militär an die „Widerstandskämpfer“ geleitet werden. Der Vorschlag wurde von der Carter-Administration auch sehr begrüßt, denn offiziell unterstützten die USA den Freiheitskampf in Afghanistan lediglich ideologisch und nicht militärisch (vgl. Ali 2008). Da die Hilfen aus unterschiedlichen Quellen stammen und geheim eingestuft wurden, liegen keine eindeutigen Beweise vor, die ein Abzweigen der Gelder für rein pakistanische Zwecke unterstützen. Es kann jedoch angenommen werden, dass ein Teil der Gelder in das geheime Forschungsprogramm zur Urananreicherung in Pakistan umgeleitet wurde. Die Hauptfinanziers des pakistanischen Atomprogramms waren jedoch islamische Staaten (Saudi-Arabien, Golfstaaten und Libyen), während westliche Staaten und China die Technologie lieferten (vgl. Synnott 2009). Mit Beginn der indirekten Verhandlungen zwischen Afghanistan und Pakistan 1982 in Genf, vermittelt durch die Vereinten Nationen, trat auch das Nuklearprogramm Pakistans auf die politische Bühne der USA zurück. Für US-Präsident Ronald Reagan spielte das Nuklearprogramm Pakistans jedoch eine Nebenrolle, sein Hauptanliegen war die Vernichtung des „Reich des Bösen“, wie er die Sowjetunion und den Warschauer-Pakt gerne nannte. Reagan empfing Zia-ul-Haq im Dezember 1982 und sicherte ihm finanzielle und militärische Unterstützung für weitere sechs Jahre zu (vgl. Haqqani 2005, Lodhi 2011a). Der US-Kongress war von Zia-ul-Haq weniger beeindruckt als Reagan und verabschiedete 1985 das Pressler Amendment zum Foreign Assistance Act of 1961 und verpflichtete damit den US-Präsidenten einen jährlichen Bericht zum pakistanischen Nuklearprogramm vorzulegen. Währenddessen gab der Leiter des pakistanischen Nuklearprogramms Abdul Qadir Khan 1987 eher beiläufig in einem Interview bekannt, dass Pakistan nun im Besitz einer eigenen Atombombe sei (vgl. Ali 2008, Haqqani 2005). Die pakistanische Regierung dementierte dies unverzüglich und betrieb gegenüber Reagan eine Appeachment-Politik, um drohenden Sanktionen zu entgehen (vgl. Haqqani 2005).
Erst nach dem Ende des Kalten-Krieges 1989 unter Präsident George H. Bush wurde im US-Kongress das pakistanische Nuklearprogramm und eine „post cold war“-Strategie in den amerikanisch-pakistanischen Beziehungen gefordert (vgl. Haqqani 2005). Präsident Bush (Sen.) konnte dem Kongress auch im Oktober 1990 keine eindeutigen Beweise für das pakistanische Nuklearprogramm bzw. zu pakistanischen Nuklearambitionen vorlegen. Somit traten die Sanktionen des Pressler Amendments in Kraft und wirtschaftliche und militärische Leistungen an Pakistan mussten unverzüglich eingestellt werden. Auch die bereits vor Inkrafttreten des Gesetzes bestellten und bezahlten Rüstungsgüter in Milliardenhöhe durften nicht mehr ausgeliefert werden. Ein wesentlicher Unterschied zum Symington Amendment war, dass das Pressler Amendment ein staatsspezifisches Gesetz war. Der Gesetzeszusatz behandelte nur das pakistanische Nuklearprogramm, während das Symington Amendment auf alle US-Leistungsempfänger mit Nuklearambitionen abzielte. Auf den freundschaftlichen Beziehungen im Kalten Krieg folgte eine Abkühlung der Beziehungen in den 1990er. Die Divergenz in den pakistanisch-amerikanischen Beziehungen wurde durch Themen wie NPT, Terrorismus (in Kaschmir) und den chinesischen Raketentechnologietransfer an Pakistan weiter verfestigt. So waren die Beziehungen 1993 auf Krisenmanagement beschränkt und erlebten einen freien Fall. Die Rettung amerikanischer Soldaten während des UN-Friedenseinsatzes in Mogadischu im Oktober 1993 durch pakistanische UN-Einheiten konnte das Misstrauen in den Beziehungen nicht mindern (vgl. Lodhi 2011a). Auch fand das pakistanische Angebot, über das eigene Nuklearprogramm im Rahmen einer regionalen Denuklearisierung Südasiens zu verhandeln, keine Zustimmung in Washington (vgl. Haqqani 2005). Die wirtschaftliche Liberalisierung des pakistanischen Marktes in den 1990er eröffnete jedoch auch Bereiche der Kooperation im privaten Sektor. Durch wirtschaftliche Kontakte angeregt, wurde bald auch in den USA erkannt, dass die gegen Pakistan verhängten Sanktionen die Nuklearisierung Südasiens eher verschleierten als verhinderten und unverhältnismäßig waren (ebd.).
Das Treffen der Premierministerin Benazir Bhutto mit US-Präsidenten Bill Clinton im April 1995 gilt als ein Meilenstein in den pakistanisch-amerikanischen Beziehungen nach dem Ende des Kalten Krieges. Clinton bemühte sich, die Beziehungen wieder zu normalisieren und versprach der Premierministerin, den Kongress um die Aufhebung der Sanktionen gegen Pakistan zu konsultieren (vgl. Lodhi 2011a). Im Mai des Jahres wurden durch das Brown Amendment alle nicht-militärischen Sanktionen gegen Pakistan aufgehoben. Auch das IMET-Programm wurde wieder aufgenommen und die sanktionierten Rüstungsgüter für den Transfer frei gegeben.
Bis 1998 entwickelten sich die Beziehungen zu einem relativen Normalpunkt hoch, sie wurden jedoch durch die indischen Atombombentests 1998 wieder auf eine harte Probe gestellt. Trotz der eindeutigen Warnungen aus Washington führte Pakistan im Mai 1998 eigene Tests durch und wurde somit neben Israel und Indien die dritte Atommacht außerhalb des NPT. Damit wurde der 1974 geäußerte Wunsch Zulfikar Ali Bhuttos von einer „islamischen Atombombe“ doch noch wahr. Dass sich damit die pakistanisch-amerikanischen Beziehungen wieder dem Gefrierpunkt nähern würden, wurde von großen Teilen der pakistanischen Gesellschaft in Kauf genommen (vgl. Ali 2008). Die USA verurteilten die Atombombentests und reagierten mit dem Glenn Amendment zum Nuclear Proliferation Prevention Act von 1994 und alle US-Leistungen an Pakistan wurden eingefroren. Zudem wurde der von General Pervez Musharraf und vier weiteren Kommandeuren der pakistanischen Armee durchgeführte Überfall auf das strategisch wichtige Gebiet Kargil in der Kaschmirregion im Mai 1999 und sein Coupe d’État im Oktober des Jahres von den USA scharf verurteilt. Im März 2000 verbrachte Bill Clinton nach einem einwöchigen Staatsbesuch mit der gesamten Familie in Indien nur sechs Stunden in Pakistan. Die First Lady Hillary Clinton flog von Indien direkt nach Washington. Dies wurde von der pakistanischen Seite als eine Demütigung im Hinblick auf über 50 jährige Zusammenarbeit mit den USA empfunden (vgl. Musharraf 2007). Somit näherten sich die pakistanisch-amerikanischen Beziehungen im Jahre 2000 wiederholt dem Gefrierpunkt. Auch die neugewählte US-Regierung unter George W. Bush im Januar 2001 zeigte wenig Interesse an einer Vitalisierung der pakistanisch-amerikanischen Beziehungen. Pakistan wurde von den USA weiterhin als „Pariastaat“ angesehen (vgl. Rashid 2010a). Militärische und geheimdienstliche Konsultationen auf höchster Ebene wurden jedoch routinemäßig weitergeführt. Erst am 11. September 2001 veränderten sich die pakistanisch-amerikanischen Beziehungen fundamental, was im nächsten Kapitel untersucht wird.
Bisher lässt sich folgendes festhalten: die pakistanisch-amerikanischen Beziehungen beruhten weniger auf geteilte Ideen, Werte und Normen, sondern vielmehr auf rationalistisch-materialistischem Kalkül. Während Pakistan aufgrund seiner Indien-zentrierten Außen- und Innenpolitik auf internationale Unterstützung in der Kaschmirfrage bedacht war, verfolgten die USA ihre globalen Interessen in Asien. Nach der Aufnahme der diplomatischen Beziehungen 1947 intensivierten sich die bilateralen Beziehungen in den 1950er und erreichten ihren Höhepunkt in 1959 mit der Unterzeichnung der Mutual Defence Treaty. Dem folgte eine Abkühlung der Beziehungen nach dem Krieg 1965 gegen Indien in den 1960er. Anfang der 1970er wurden die Beziehungen im Hinblick auf die China-Politik der USA wieder normalisiert, jedoch aufgrund des Krieges 1971/72 gegen Indien wieder gedämpft. Mit Zulfikar Ali Bhuttos öffentlicher Absichtserklärung zum Bau einer Atombombe verschlechterten sich die bilateralen Beziehungen wieder und befanden sich im freien Fall. Das Symington Amendment von 1979 und das Pressler Amendment von 1985 zeugen davon. Mitte der 1990er verbesserten sich die Beziehungen zu einem Normalpunkt, um auch gleich im Kargil Krieg 1998 und dem Militärputsch 1999 wieder abzustürzen. Bis 2001 blieben die Beziehungen auf ein Minimum begrenzt.
Inwiefern die hier dargelegten historischen Erfahrungen in den pakistanisch-amerikanischen Beziehungen im „war on terror“ als bestimmend angesehen werden können, wird im nächsten Kapitel untersucht.
[...]
[1] Seit 2005 Chevron Texaco
[2] UNSC-Resolution 38 (17. Januar 1948), UNSC-Resolution 39 (20. Januar 1948), UNSC-Resolution 47 (21. April 1948) und UNSC-Resolution 51 (03. Juni 1948)
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Erstausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2012
- ISBN (Paperback)
- 9783863412975
- ISBN (PDF)
- 9783863417970
- Dateigröße
- 329 KB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- FernUniversität Hagen
- Erscheinungsdatum
- 2015 (Februar)
- Note
- 2
- Schlagworte
- internationale Beziehungen amerikanische Außenpolitik Heartland-Theorie New Great Game Eurasisches Schachbrett Afghanistan IB
- Produktsicherheit
- BACHELOR + MASTER Publishing