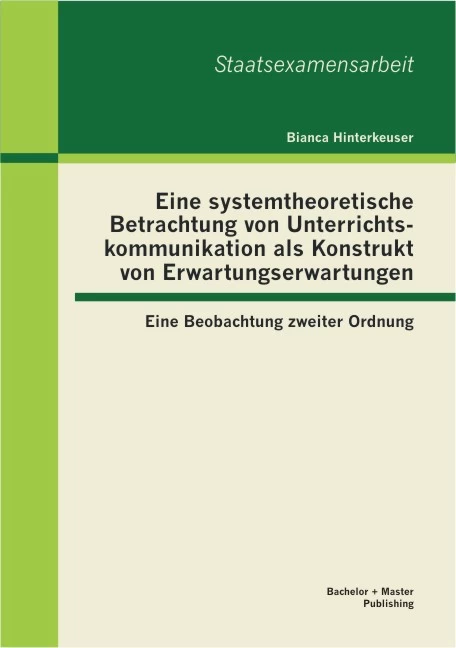Eine systemtheoretische Betrachtung von Unterrichtskommunikation als Konstrukt von Erwartungserwartungen: Eine Beobachtung zweiter Ordnung
Zusammenfassung
Die Qualität der Bildungsabschlüsse und des dadurch definierten Bildungserfolgs oder Bildungsmisserfolgs hat erheblichen Einfluss auf die spätere Integration der Schüler in unsere Gesellschaft und deren Struktur. Daher ist es erforderlich, die vielfältigen Umstände zu ergründen, die zu einer Schieflage im Bildungssystem führen können.
In der vorliegenden Arbeit soll den Bedingungen, unter denen Unterrichtskommunikation stattfindet, aus der Perspektive der Systemtheorie Niklas Luhmanns nachgegangen werden.
Die von Luhmann entwickelte Theorie der sozialen Systeme identifiziert und analysiert spezifische Kommunikationen als Grundeinheiten gesellschaftskonstituierender funktionaler Teilsysteme. Vor diesem Hintergrund erscheint sie in besonderer Weise zu einer Analyse kommunikativer Funktionalitäten und Dysfunktionalitäten geeignet, die zur beklagten Mangelhaftigkeit des Erziehungs- bzw. Schulsystems beitragen.
Grundsätzlich beobachtet Luhmann Kommunikationssysteme und Bewusstseinssysteme in ihren Operationen strikt voneinander getrennt. So ist es möglich, Kommunikation auf eine andere Weise zu behandeln, als es die eher informationstheoretisch begründeten Kommunikationstheorien auf der Basis von Sender-Empfänger-Modellen erlauben.
In diesem Sinne wird im Folgenden untersucht, wie das Unterrichtssystem heute welche Funktionen in der und für die Gesellschaft erfüllt und welcher Dynamik es dabei folgt. Auf Grundlage dieser Untersuchung wird beantwortet, ob ein Bildungsmisserfolg - der ja auf Grundlage bestimmter Unterscheidungen als solcher erst definiert wird - im Zusammenhang mit den Bedingungen, unter denen sich Unterrichtskommunikation in unseren Schulen vollzieht, steht.
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
Die im Grundgesetz verankerte staatliche Aufsicht über das gesamte Schulwesen weist der Schule als einer zentralen Institution unserer Gesellschaft die Funktion und Aufgabe zu, Schüler[1] chancengleich zu unterrichten und damit den nachfolgenden Generationen die grundlegenden Bedingungen für ein produktives und integriertes Leben innerhalb der gesellschaftlichen Systeme zu verschaffen.
Trotzdem bestehen – bereits bedingt durch unser mehrgliedriges Schulsystem, aber auch innerhalb der Schulformen – offenbar beträchtliche Diskrepanzen bezüglich Schülerbildung und Bildungserfolg.
Der Frankfurter Bildungsforscher Eckard Klieme hat zuletzt im Bildungsbericht 2008 festgestellt, dass sogar rund 80.000 Schüler in Deutschland die Schulen ohne Abschluss verlassen.
Der Schulabschluss bestimmt als Definition und Ausweis des jeweils erreichten Bildungsgrades die Optionen des anschließenden Berufslebens oder die Anschlüsse in Form von sogenannter Höherer Bildung der Schüler. Ein fehlender oder schlechter Schulabschluss senkt damit die Wahrscheinlichkeit für das Erreichen einer Ausbildung und einer entsprechenden Arbeitsstelle, was für das Sozialsystem eine erhebliche Belastung darstellt.
Die Qualität der Bildungsabschlüsse und des dadurch definierten Bildungserfolgs oder Bildungsmisserfolgs hat erheblichen Einfluss auf die spätere Integration der Schüler in unsere Gesellschaft und deren Struktur, was es erforderlich macht, die vielfältigen Umstände zu ergründen, die zu einer derartigen Schieflage im Bildungssystem führen können.
Der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Josef Kraus, etwa fordert in ergreifender Schlichtheit eine Ausweitung der Lerninhalte zur Behebung der immerhin als Problem wahrgenommenen Bildungsdefizite:
"Unsere jungen Leute brauchen mehr konkretes Faktenwissen, dann erst können sie kreativ sein, dann erst sind sie wettbewerbsfähig, dann erst sind sie mündig gerade auch im politischen Bereich. Wer nichts weiß, muss jedem alles glauben. Da muss wieder mehr Futter ran. (...) Ich würde mir wünschen, dass wir weg wieder von diesem allgemeinen und seichten Kompetenzen- und Schlüsselqualifikationen-Gerede zu inhaltlichen Debatten kommen und uns ernsthaft überlegen, was müssen unsere jungen Leute konkret wissen in den Naturwissenschaften, in Deutsch, in Literaturgeschichte, in Musikgeschichte, in Geschichte überhaupt, in Politik, im Bereich der ästhetischen Bildung. Die inhaltliche Debatte kostet nichts und sie wäre unglaublich wertvoll." (Josef Kraus, Interview, Deutschlandfunk am 27.08.2009)[2]
Gegenüber derartigen – letztlich doch eher hilflosen – Vorschlägen, die dem Prinzip des Mehr-desselben folgen, zeigen sich etwa die Arbeitgeberverbände, denen im Hinblick auf Bildungsergebnisse durchaus ein primäres Verwertungsinteresse unterstellt werden kann, erfrischend offen:
"Die Schule muss sich am Bildungserfolg der Schüler messen lassen. Deshalb muss dem Schüler mehr Aufmerksamkeit als bisher zuteil werden. Dafür müssen neue Formen des Lernens, des Differenzierens und des fachübergreifenden Unterrichts stärker genutzt werden. Die Schüler sind – in Zusammenarbeit mit den Eltern – zu selbstständigen und verantwortungsbewussten Persönlichkeiten mit Selbstvertrauen und mit Teamfähigkeit zu entwickeln." (Positionspapier der BDA)[3]
Solche Vorschläge werden sich jedoch auf die Bildungserfolge der Schüler kaum positiv auswirken können, wenn die Bedingungen, unter denen Unterrichtskommunikation stattfindet, dabei keine angemessene Beachtung finden.
In der vorliegenden Examensarbeit soll diesen Bedingungen aus der Perspektive der Systemtheorie Niklas Luhmanns nachgegangen werden.
Die von Luhmann entwickelte Theorie der sozialen Systeme, im Rahmen derer je spezifische Kommunikationen als Grundeinheiten gesellschaftskonstituierender funktionaler Teilsysteme identifiziert und analysiert werden, erscheint vor diesem Hintergrund in besonderer Weise zu einer Analyse kommunikativer Funktionalitäten und Dysfunktionalitäten geeignet, die zur beklagten Mangelhaftigkeit des Erziehungs- bzw. Schulsystems beitragen.
Ihr Anspruch, die moderne differenzierte Gesellschaft in Form der genannten funktional differenzierten Teilsysteme zu beschreiben, durch die eine Reduktion der unendlich komplexen (Um)welt ermöglicht wird, erlaubt es, das Unterrichtssystem als soziales Subsystem der Schule in ihrer Rolle als konstituierendes gesellschaftliches Teilsystem zu beobachten. Die analytische Grundoperation Luhmanns, Kommunikationssysteme und Bewusstseinssysteme in ihren Operationen als strikt voneinander getrennt agierend zu beobachten, macht es dabei möglich, Kommunikation auf eine andere Weise zu behandeln, als es die eher informationstheoretisch begründeten Kommunikationstheorien auf der Basis von Sender-Empfänger-Modellen erlauben.
Dieser ausdifferenzierte Kommunikationsbegriff ist jedoch nicht unbedingt unmittelbar und intuitiv zugänglich. So warnt Baecker ausdrücklich:
"Die Differenz zwischen wahrnehmbarer Kommunikation und inkommunikabler Wahrnehmung macht den Kommunikationsbegriff, wie wir ihn hier verwenden, intuitiv so schwergängig. An diesen Aspekt einer soziologischen Kommunikationstheorie kann man sich im wahrsten Sinne des Wortes nur gewöhnen, indem man ihn versuchsweise akzeptiert, mit ihm experimentiert, dass heißt Beobachtungen auf seiner Grundlage anstellt, und so allmählich ein Gefühl dafür gewinnt, wo er Sinn macht und wo möglicherweise nicht." (Baecker, 2005, S. 50)
In diesem Sinne soll im Folgenden untersucht werden, wie das Unterrichtssystem heute welche Funktionen in der und für die Gesellschaft erfüllt und welcher Dynamik es dabei folgt. Auf Grundlage dieser Untersuchung soll eine Antwort versucht werden, ob ein Bildungsmisserfolg – der ja auf Grundlage bestimmter Unterscheidungen als solcher erst definiert wird – im Zusammenhang mit den Bedingungen, unter denen sich Unterrichtskommunikation in unseren Schulen vollzieht, steht[4].
Luhmann hat mit seiner Systemtheorie den Versuch unternommen, die moderne Gesellschaft in allen ihren Bereichen strukturell zu beschreiben. Sein Ziel dabei ist die Beschreibung der einzelnen gesellschaftlichen Systeme unter einem gemeinsamen grundlegenden strukturellen Blickwinkel. Er arbeitet hier also mit der Prämisse, dass jedem gesellschaftlichen System eine Struktur zugrunde liegt, die sich auch in allen anderen Systemen oder Lebensbereichen wiederfinden lässt und ein System als "funktional differenziert" abgrenzt – sei es Wirtschaft, Politik, Recht oder eben auch Bildung. Um eben dieses funktional differenzierte System und die Bedingungen seiner funktionalen Differenzierung soll es hier gehen.
Wissen ist hier auf Grundlage dieser Theorie Resultat eines Lernprozesses im Bewusstseinssystem eines Individuums. Die Theorie sozialer Systeme basiert auf der Grundannahme, dass kein System außerhalb seiner Grenzen operieren kann.
Im anschließenden Kapitel sollen deshalb die Begriffe Bildung und Wissen systemtheoretisch beleuchtet werden. Dafür werden zu Beginn die Grundannahmen der Theorie sozialer Systeme erläutert (Kapitel 2), woraufhin eine Analyse des Wissenserwerbs vorgenommen werden soll (2.1), indem der Lernbegriff systemtheoretisch gefasst und die verschiedenen Wege des Wissenserwerbs nachgezeichnet werden (2.1.1; 2.1.2). Daran anschließend wird das Thema Vertrauen als nötige und katalysierende Komponente von Lernprozessen thematisiert (2.2).
Basierend auf der vorangegangenen Entwicklung der Definitionen von Wissen und Lernen soll dann im nächsten Kapitel die Unterrichtskommunikation beleuchtet werden. Dazu werden zu Beginn deren charakteristische Eigenschaften herausgearbeitet (Kapitel 3), woraufhin im weiteren Verlauf auf das Verstehen im Kommunikationsprozess (3.1) und in der Unterrichtskommunikation speziell (3.2) eingegangen wird.
Die Selektionsfunktion der Schule, zeigt sich in der Unterrichtskommunikation in Form von Erwartungen. Das Erfüllen und Nichterfüllen dieser Erwartungen bestimmt die Beurteilung der Schüler durch den Lehrer. Es soll im folgenden Abschnitt deshalb auf die Besonderheit der Erwartungen in der Unterrichtskommunikation (3.3) und die vom Lehrer abhängige Interpretation von Erfüllen (3.3.1) und Nichterfüllen (3.3.2) seiner Erwartungen eingegangen werden.
Dass diese Erwartungen weniger an einen formalen Wissenserwerb für die Schüler gebunden sind, wie er in den Curricula vorgegeben ist, sondern eher denen eines „heimlichen Lehrplans“ folgen, den die Schüler entschlüsseln müssen, soll nachfolgend verdeutlicht werden (3.4).
Für die Problematik einer Selektion aufgrund von nichterfüllten Erwartungen, die im Ermessen des Lehrers liegen, wird ein Lösungsversuch diskutiert, der die Unterrichtsdidaktik in Beziehung zu dieser Problematik setzt (3.5).
Die Montessoripädagogik mit ihren ganz eigenen Grundsätzen und Methoden soll als Beispiel dienen für eine maximale Zurücknahme der Erwartungen im Unterricht (Kapitel 4) und abschließend der aus der vorangegangenen Analyse entwickelte Erkenntnisgewinn der Verfasserin verdeutlicht werden (Kapitel 5).
2. Bildung und Wissen
Bildungsabschlüsse zertifizieren Schülern ihren Bildungsgrad. Bildung wird in diesem Zusammenhang gemeinhin verstanden als das Ausmaß von Wissen und Kompetenzen, die der Schüler während seiner Schulzeit gesammelt und die er als Fähigkeit, Wissen auf unbekannte Aufgaben und in neuen Problemsituationen anzuwenden, in verschiedenen Prüfungssituationen demonstriert hat. Bildung wird damit als ein Kontingent von Wissen und Handlungsoptionen angesehen, das der Schüler in der Schule erworben hat und auf das er zurückgreifen kann. Ein fehlender oder als schlecht bewerteter Bildungsabschluss definiert den Schüler dann entsprechend als wenig oder ungebildet, was in aller Regel erheblichen Einfluss auf seine berufliche Karriere hat.
Eine solche Sichtweise nimmt implizit und stillschweigend an, dass Schülern in der Schule ein Input von Fakten, Zusammenhängen und Kompetenzen vermittelt wird, den sie abspeichern, um ihn als Output ver- und anwenden zu können. Aus der Perspektive der Theorie sozialer Systeme und ihres Kommunikationsbegriffs ist – auf die Schüler bezogen – ein solcher Input jedoch prinzipiell, weil systembedingt, nicht möglich.
Luhmann beschreibt Systeme als strukturdeterminiert, jedoch nicht auf Grundlage einer Analyse ihrer Elemente definitionsfähig:
„Es gibt Maschinen, chemische Systeme, lebende Systeme, bewusste[5] Systeme, sinnhaft-kommunikative (soziale) Systeme; aber es gibt keine all dies zusammenfassenden Systemeinheiten.“ (Luhmann, 1991b, S. 67)
Gemeinsam ist allen Systemen vielmehr der Umstand, dass ein Entfallen ihrer individuellen Merkmale „den Charakter eines Gegenstandes als System in Frage stellen würde“ (vgl. ebd., S. 15).
Konkreter gefasst: Alle Systeme sind die Ganzheit ihrer internen Elemente, die eine individuelle Ordnungsstruktur aufweisen und damit in einer bestimmten Weise zueinander in Beziehung stehen.
Zur Diskussion der gesellschaftsrelevanten funktional differenzierten Systeme führt Luhmann das operative Begriffspaar System/Umwelt als Ersatz für den in bisherigen Beschreibungen gebräuchlichen kategorialen Dualismus Subjekt/Objekt ein. Umwelt ist dabei alles, was das untersuchte System nicht ist – auch die anderen Systeme. Was System und Umwelt scheidet ist letztlich die gemeinsame Grenze:
„Neben der Konstitution von systeminternen Elementen ist demnach die Bestimmung der Grenzen das wichtigste Erfordernis der Ausdifferenzierung von Systemen.“ (Luhmann, 1991b, S. 54)
Im Unterschied zu unbelebten Maschinensystemen, die nur als „regulierte Transformation von Input in Output“ fungieren (vgl. Luhmann, 1994, S. 192), erhalten sich Organismen (lebende Systeme), psychische Systeme (Bewusstseinssysteme) und soziale Systeme (Kommunikationssysteme) durch eine interne Interaktion als ihr jeweils individuelles Netzwerk. Sie sind
„ (...) Systeme mit der Fähigkeit, Beziehungen zu sich selbst herzustellen und diese Beziehungen zu differenzieren gegen Beziehungen zu ihrer Umwelt“ (Luhmann, 1991b, S. 31)
Entstehen und Fortbestehen psychischer und sozialer Systeme ist demnach nicht einfach durch die Relation der systeminternen Elemente untereinander gegeben, sondern vollzieht sich im Wesentlichen durch die systeminterne Stabilisierung einer Differenz von Innen und Außen, also von System und Umwelt. Diese Selbsterhaltung bezeichnet Luhmann als selbstreferentiell:
„Ein System kann als selbstreferentiell bezeichnet werden, wenn es die Elemente, aus denen es besteht, als Funktionseinheiten selbst konstituiert und in allen Beziehungen zwischen diesen Elementen eine Verweisung auf diese Selbstkonstitution mitlaufen lässt, auf diese Weise die Selbstkonstitution also laufend reproduziert.“ (Luhmann, 1991b, S. 59)
Durch das rekursive Beziehen auf die systeminternen Elemente und die dadurch vollzogenen systeminternen Operationen sichert sich das System also sein Fortbestehen. Luhmann folgert, dass die Elemente eines Systems die nicht weiter auflösbaren Einheiten sind, durch die das System sich erhält, und erläutert:
“>>Nicht weiter auflösbar<< heißt zugleich: dass ein System sich nur durch Relationieren seiner Elemente konstituieren und ändern kann, nicht aber durch deren Auflösung und Reorganisation.“ (Luhmann, 1991b, S.43)
Diese nicht weiter auflösbaren Einheiten identifiziert Luhmann im Falle sozialer Systeme als Kommunikationen und im Falle psychischer Systeme als Gedanken. So operieren und erhalten sich soziale Systeme selbstreferentiell, indem sie Kommunikation an Kommunikation anschließen, und psychische Systeme, indem sie Gedanken an Gedanken anschließen.
„Selbstreferentielle Systeme sind auf der Ebene dieser selbstreferentiellen Organisation geschlossene Systeme , denn sie lassen in ihrer Selbstbestimmung keine anderen Formen des Prozessierens zu.“ (Luhmann, 1991b, S. 60)
Dieses selbstreferentielle Prozessieren geschlossener Systeme bezeichnet Luhmann, im Anschluss an einen ursprünglich von den Neurobiologen Maturana und Varela geprägten Begriff, als „autopoietisch“.
Bezogen auf die Änderung ihrer eigenen Zustände, das heißt auf die Änderung der Relationen ihrer Elemente und damit ihrer Struktur, sind autopoietische Systeme operational geschlossen und damit durch ihre rekursiv sich auf sich selbst beziehende Herstellung und Erhaltung autonom. Alles, was außerhalb des jeweiligen Systems liegt, stellt für dieses Umwelt dar, durch die eine Determination ausgeschlossen ist. Determination geschieht nur systemintern aufgrund der jeweiligen Operationen, die ihre Elemente aus ihren Elementen hervorbringen.
Zugleich wird damit deutlich, dass Systeme keine starren Gebilde sind, sondern durch ihre Operationen, die sich aneinander anschließen, einer Dynamik folgen, die sie selbst durch eben diese Operationen bestimmen.
„Insofern operieren autopoietische. Systeme struktur- bzw. zustandsdeterminierend .“ (Kneer/Nassehi, 2000, S. 56)
Psychische Systeme sind danach autopoietische Systeme, als deren selbstreferentielle Operationen Gedanken an Gedanken anschließen. Soziale Systeme sind autopoietische Systeme, als deren selbstreferentielle Operationen Kommunikationen an Kommunikationen anschließen.
Luhmann unterscheidet weiter drei Ebenen der sozialen Systembildung: Interaktionssysteme, Organisationssysteme und Gesellschaft.
Dabei definieren sich Interaktionssysteme über die gemeinsame Anwesenheit mindestens zweier psychischer Systeme und Organisationssysteme über eine Mitgliedschaft, die bestimmten Regeln untersteht.
Gesellschaft ist das soziale System, das alle anderen Teilsysteme umfasst und somit alle möglichen Kommunikationen. Gesellschaft ist insofern ein besonderer Systemtyp, da dieses System notwendig alle sozialen Kontakte umfasst und damit keine soziale Differenz zu einer Umwelt haben kann. Dabei sieht Luhmann Gesellschaft nicht lediglich als Summe aller Teilsysteme, sondern als System höherer Ordnung, dem sich in unserer heutigen modernen Gesellschaft niemand entziehen kann.
Diese moderne Gesellschaft stellt sich mit ihren möglichen Ereignissen als unendlich komplex dar, woraus die Notwendigkeit folgt, eine handhabbare Auswahl zu treffen:
„Komplexität besagt, dass eine Vielzahl von Elementen, (...) nur selektiv verknüpft werden kann. Komplexität bedeutet also Selektionszwang.“ (Luhmann, 1991b, S. 291)
Dieser Selektionszwang der Komplexität bedeutet, dass das System eine Auswahl treffen muss, die auch immer hätte anders ausfallen können.
„Dieses >>auch anders möglich sein<< bezeichnen wir mit dem traditionsreichen Terminus der Kontingenz“ (Luhmann, 1991b, S. 47)
Sozialen Systemen ist die Operation „Kommunikation“ als nicht weiter auflösbare Einheit gemeinsam. Sie reduzieren Komplexität durch ihre systemspezielle Funktion, mit Hilfe eines jeweils spezifischen binären Codes die Grenze zur Umwelt zu manifestieren. Darauf beruht die gerichtete Selektion des jeweiligen, so auch des hier untersuchten Systems:
„Der Code des Erziehungssystems entsteht aus der Notwendigkeit, eine Karriere zu bilden, also eine Sequenz von selektiven Ereignissen aufzubauen, die jeweils in einem Zusammenwirken von Selbstselektion und Fremdselektion zustande kommen und für anschließende Ereignisse Bedingung der Möglichkeit und strukturelle Beschränkung bedeuten. Nur wenn man in die Schule aufgenommen wird, erhält man Zensuren. Die Zensuren sind von Bedeutung für die Versetzung innerhalb der Schullaufbahn. Der erfolgreiche Abschluss einer Ausbildung ist von Bedeutung für den Berufseintritt. Der Berufseintritt bestimmt die weitere Karriere, wobei in allen Fällen das freiwillige oder unfreiwillige Nichterfüllen der Anforderungen ebenfalls Karrierewert hat, nur eben negativen.“ (Luhmann, 1988a, S. 195)
Das Bildungssystem ist somit ein Funktionssystem, das mit dem Code der Bildung, ihrem Karrierewert „gebildet/ungebildet“ operiert. In der alltäglichen Bildungspraxis wird diese Unterscheidung auf das Subsystem des Unterrichts als Interaktion übertragen. Dieses Interaktionssystem jedoch operiert mit dem Selektionscode „besser/schlechter“.
Jedes soziale System besitzt auf Grundlage seines jeweiligen binären Codes seine ihm je eigene Struktur. Diese Struktur ergibt sich aus den Erwartungen, die dem jeweiligen Code des Systems als Programmierung entspringen (vgl. Luhmann, 2004, S. 41f). Die operative Geschlossenheit des Systems, die sich durch die binäre Codierung ergibt, öffnet sich für die Umwelt in Form von Programmen.
Programme sind die Regeln für „richtiges oder doch brauchbares Verhalten im System“ (vgl. Luhmann, 2004, S. 23).
Mithin ist Bildung als das Programm des Bildungssystems zu beschreiben, das sich im Subsystem Unterricht in der Struktur der Lehr- und Lernpläne nach der Codierung besser/schlechter ausdrückt.
Der Schüler, als Teilnehmer des Bildungssystems notwendig immer verstanden als psychisches System, entnimmt aufgrund seiner autopoietischen, selbstreferentiellen und mithin operational geschlossenen Struktur kein Wissen aus der Umwelt, sondern konstruiert Wissen ausschließlich durch interne Bewusstseinsoperationen – d.h. Gedanken – selbst:
„Legt man diese Annahmen zugrunde (...) erscheint das Grundproblem der Erziehung in neuem Licht. Die Theorie operativ-geschlossener Systeme schließt die Annahme aus, man könne durch Kommunikation Bewusstseinsoperationen (-strukturen, -zustände usw.) spezifizieren. Das was der Erzieher sich vornimmt ist unmöglich. (Luhmann, 2004, S. 162)
2.1 Wissenserwerb
Das psychische System ist permanent Reizen seiner Umwelt ausgesetzt.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 1: Umweltreize
Diese Reize führen zur Wahrnehmung von Irritationen im psychischen System und in der Folge zu Bewusstsein. Nassehi und Kneer beziehen sich zur Erklärung dieses Prozesses auf experimentelle neurophysiologische Forschungen von Maturana und Valera zum Nervensystem: Aufgrund von Messungen bei Experimenten mit der Informationsverarbeitung bei der Farbwahrnehmung von Tauben, ergab sich die Schlussfolgerung, dass das Nervensystem ein autopoietisches System sei. Auch das Nervensystem verfügt demnach über keinen Input und keinen Output (vgl. Kneer/Nassehi, 2000, S. 51f):
“Das Nervensystem fertigt somit kein Abbild der Umwelt an, vielmehr konstruiert das Nervensystem durch seine eigenen Operationen sein eigenes Bild der umgebenen Welt.“ (Kneer/Nassehi, 2000, S. 52)
Diese Ergebnisse bestätigten sich für Maturana und Varela in weiteren Forschungen zur Funktionsweise des Gehirns. Auch das Gehirn arbeitet selbstreferentiell und ermöglicht so keinen Output oder Input.
Über die Sinne werden die Reize der Umwelt zu Reizen im Nervensystem. Das Nervensystem reizt wiederum das Gehirn.
„Das menschliche Gehirn bildet ein geschlossenes, selbstreferentielles System, das keinen direkten Zugang zu seiner Umwelt besitzt. Auch über die entsprechenden Sinnesorgane steht das Gehirn in keinem Kontakt mit der Außenwelt. (...) Das Nervensystem benutzt die unterschiedlichen Sinneswahrnehmungen, wie etwa Sehen, Hören, Riechen und Fühlen als jeweils gleiche systemeigene Sprache. Der neuronalen Erregung sieht man also nicht an, ob sie durch visuelle, akustische, geruchliche oder sensomotorische Signale hervorgerufen worden ist.“ (Kneer/Nassehi, 2000, S. 53)
Mit der Wahrnehmung der Reize im Gehirn transformiert das psychische System diese Reize im Rahmen systeminterner Operationen zu Gedanken.
Reizung Irritation Wahrnehmung Gedanke
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Problem
Abbildung 2: Wahrnehmungsprozess
Eine Irritation bringt das psychische System damit in Reaktionsnotwendigkeit. Dieser Umstand soll hier als „Problem“ bezeichnet werden. Das Erfahren dieser Abfolge wird mit dem Problem für das psychische System zu einer Information.
„Eine Information kommt immer dann zustande, wenn ein selektives Ereignis (externer oder interner Art) im System selektiv wirken, das heißt Systemzustände auswählen kann.“ (Luhmann, 1991b, S. 68)
Informationen sind also bewusstgewordene Reize aus der Umwelt. Das psychische System muss entscheiden, wie es diese Information verarbeitet, auf welchem Weg es also das Problem löst, denn:
„Eine Information wird nicht daran gemessen, was man weiß, (...) sondern was man außerdem herausfindet (...), denn eine Information gilt nicht bestimmten Gegenständen oder Zuständen, sondern sie gilt der Ordnung dieser Gegenstände und Zustände im Verhältnis zu anderen Gegenständen und Zuständen.“ (Baecker, 2005, S. 19)
Dieser Lösungsprozess des „Problems“ besteht in einer Abfolge interner Operationen, also einer gedanklichen Reaktion, der eine sinnhafte Selektion von Anschlussgedanken voraus geht:
„Das Phänomen Sinn erscheint in der Form eines Überschusses an Verweisungen auf weitere Möglichkeiten des Erlebens und Handelns.“ (Luhmann, 1991b, S. 93)
Die Auswahl aus dem Überschuss, also der Kontingenz an Möglichkeiten, bestimmt die Stabilisierung der Gedankenstruktur so von Moment zu Moment. Die Selektion der Anschlussoperation stellt das psychische System wieder vor ein Problem, das den gleichen Prozess in Gang bringt. Auf diese Weise werden Informationen im psychischen System miteinander verknüpft, verweist Sinn auf Sinn.
Information Information
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 3: Lösungsprozess
Dieser Prozess des Problemlösens, also die Verknüpfung von Informationen, die in Form von Gedanken durch Wahrnehmung als Folge von Irritation durch einen Reiz sinnhaft erfolgt, soll als Lernen bezeichnet werden:
„>>Lernen<< ist die Bezeichnung dafür, (...) wie Informationen dadurch weitreichende Konsequenzen auslösen, dass sie in einem System partielle Strukturveränderungen bewirken, ohne dadurch die Selbstidentifikation des Systems zu unterbrechen.“ (Luhmann, 1991b, S. 158)
Lernen ist folglich der Prozess, der sich als Anschlussoperation durch Erfahrungen miteinander verknüpfter Informationen vollzieht.
Im psychischen System verläuft dieser Prozess als eine Wenn-Dann-Abfolge, (obgleich auch immer andere Optionen möglich gewesen wären). Bleiben Ergebnis und Abfolge für das psychische System unbewusst, findet dennoch nach der oben getroffenen Definition Lernen statt. Dieses Lernen soll als „Elementares Lernen“ bezeichnet werden:
„Elementares Lernen vollzieht sich unabsichtlich-beiläufig auf Grund von Erfahrungen bei einem Verhalten, das andere Ziele verfolgte[6]. Das Gelernte erscheint dann als eigene[7] oder zugetragene[8] Erfahrung anderer“ (Luhmann, 1991a, S. 94f)
Im Gegensatz zum elementaren Lernen durch Selbsterfahrung, vollzieht sich elementares Lernen durch die Übernahme von Fremderfahrung, als Nachahmung in einem interaktiven sozialen Prozess.
In das Bewusstsein gelangen Ergebnisse dieser Prozesse durch eine Beobachtung erster Ordnung, in Form einer „Einführung der System/Umwelt-Differenz“ (vgl. Luhmann, 1991b, S. 63) durch das psychische System und werden damit zu Wissen. Beobachten ist damit die Operation eines Systems mit einer Unterscheidung (ebd., S. 110):
„Beobachtung erster Ordnung ist das Treffen von Unterscheidungen zur Bezeichnung von Sachverhalten, seien es Objekte, Personen mit ihren Namen oder auch Zeithorizonte inklusive der Unterstellung, dass Vergangenheit bekannt, Zukunft unbekannt und die Gegenwart jetzt ist.“ (Baecker, 2005, S. 75)
Wissen ist die Erinnerung und damit die Beobachtung, bzw. die Konstruktion des „Dann“, demgemäß als der Moment einer Erinnerung an das Ergebnis eines Erfahrungsprozesses (Selbst- oder Fremderfahrung). Dabei muss nicht zugleich zwingend erinnert werden, wie es zu diesem Ergebnis gekommen ist, also welche Erfahrung dahin geführt hat. Wissen hat also zu eigen, dass es sich dabei um eine systeminterne Realität handelt, die letztlich aber nur eine Konstruktion, also ein Abbild der Umwelt des Systems ist.
Die Vollendung der Konstruktion des kompletten „Wenn-Dann-Prozesses“ ist der Moment einer Erkenntnis. Das heißt, das psychische System konstruiert im Moment der Erkenntnis die Abfolge der Verknüpfung der Informationen eines oder mehrerer Gedankenprozesse.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 4: Erkenntnisprozess
2.1.1 Erkenntnislernen
Lernen ist der Prozess, in dem Informationen miteinander verknüpft werden. Psychische Systeme lernen also permanent, indem ein Gedanke aus einem Gedanken entspringt. Dabei bestimmt der vorausgegangene Gedanke den Folgegedanken in Form von Sinn. Lernen ist somit sinngerichtetes Denken.
Konstruiert das psychische System das Ergebnis eines Lernprozesses erlangt es Wissen. Diese systeminterne Operation wird als (Selbst-)Beobachtung bezeichnet.
Das psychische System beobachtet eine Information, indem es zwischen Fremd- und Selbstreferenz unterscheidet.
Die Ergebniskonstruktion kann aufgrund von unbewusster Selbsterfahrung oder Übernahme von Fremderfahrung erfolgen. Die dem sinngerichteten Lösungsprozess vorausgegangene Information wird also nicht mitrekonstruiert. Jede Beobachtung steht mit ihrer vollzogenen Unterscheidung vor einem „blinden Fleck“. Der „blinde Fleck“ ist das, was die Beobachtung nicht sehen kann, nämlich die Unterscheidung, die getroffen werden muss, um eine Unterscheidung zu bezeichnen.
Wird der Selbst- oder Fremderfahrungsprozess, der zu einer neuen Information geführt hat, als gesamter Verknüpfungsablauf im psychischen System konstruiert, gelangt es zu einer Erkenntnis. Diese systeminterne Operation wird als Beobachtung zweiter Ordnung bezeichnet.
„(..) Beobachtung zweiter Ordnung ist die Beobachtung im Hinblick darauf, dass diese [die Beobachtungen erster Ordnung][9] eine Zweiseitenform haben, also einschließen, was sie ausgrenzen. Beobachtung zweiter Ordnung ist damit gleichzeitig die Beobachtung von Beobachtern, denn Unterscheidungen gibt es nur, insofern sie getroffen werden (...).“ (Baecker, 2005, S. 77)
Das psychische System beobachtet gewissermaßen das Wissen vom Wissen und damit den „blinden Fleck“ der Beobachtung erster Ordnung. Dieser reflexive Prozess soll als Erkenntnislernen bezeichnet werden.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 5: Lernebenen
Der reflexive Prozess des Erkenntnislernens findet statt, wenn das psychische System Anschlussgedanken nach einem bewussten Sinnzusammenhang auswählt. Ein Problem ist also bewusst und wird in einem Trial und Error Verfahren mit weiteren Informationen verknüpft. Gedanken werden beharrlich auf eine Lösung angeschlossen, mit dem bewussten Ziel der Erkenntnis.
Elementares Lernen schließt also Erkenntnis aus. Aber auch elementares Lernen kann durch eine Erkenntnis gesteigert werden. Die zur Erkenntnis geführt habenden Informationskopplungen werden im psychischen System erst mit der Erkenntnis wahrgenommen. Der Erfahrungsprozess wird mit der Erkenntnis reflexiv nachkonstruiert. Das psychische System konstruiert rekursiv die zur Erkenntnis geführt habenden Informationen und vollzieht so einen reflexiven Lernprozess.
Elementares Lernen mit einer Anschlussreflexion, sowie zielgerichtetes reflexives Lernen sind Arten kognitiver Lernprozesse, die Wissen durch Erkenntnis aufgrund von bewusster Selbsterfahrung steigern.
Selbsterfahrung ist nichts anderes als sich zu sich selbst in Beziehung setzen. Das Bewusstmachen geschieht über die Selbstbeobachtung dieses Prozesses. Eine notwenige Komponente dieses Prozesses ist es, dem Konstrukt der selbstgemachten Erfahrungen zu vertrauen, um Anschlussoperationen und damit das System zu sichern. Ohne das Vertrauen auf die Wahrnehmung der eigenen Erfahrungen würde das psychische System unfähig Selektionen zu treffen, also weiterzudenken.
So bestätigen sich in der Wiederholung erfolgreicher Problembewältigungen bestimmte Lösungsprozesse, die zu mehr Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein führen.
Für das Lernen durch Selbsterfahrung ist also Selbstvertrauen notwendig, um auf dem Ergebnis dieser Erfahrung weitere Selektionen aufzubauen, sich als psychisches System selbst zu erhalten und die Welt durch Reduktion der komplexen Umwelt zu konstruieren.
2.1.2 Nachahmungslernen
Die Selbstreferenz und damit der Erhalt des psychischen Systems ist also auf Fremdreferenz[10] angewiesen – ohne Reizungen, keine Gedanken.
„Kein Bewusststeinssystem kann ohne entsprechende Umweltbeiträge existieren und seine Autopoiesis fortsetzen.“ (Kneer/Nassehi, 2000, S. 61)
Diese Umweltbeiträge gestalten sich nicht nur durch dingliche Reizung, sondern ebenso durch kommunikative.
Die Wissensstruktur eines psychischen Systems, die ein Überleben in der Welt sichert, muss im Kindesalter erst erlernt werden. Die Abhängigkeit vom sozialen Kontakt zu Bezugspersonen, die ein Überleben des Kindes sichern, nimmt mit zunehmendem Selbstbewusstsein, also zunehmenden Vertrauen in die eigenen Erfahrungsprozesse (also der Konstruktion von Wissen und Erkenntnis) ab. Erkenntnislernen geht also immer Elementares Lernen voraus.
Jedes psychische System ist zu Beginn auf eine Umweltreduktion durch soziale Systeme angewiesen. Dem kann sich niemand entziehen. Hier findet ein Lernen statt, das sich in Form von Nachahmung manifestiert.
Nachahmung heißt: Problemlösungen aufgrund von Fremderfahrungen annehmen. Lernen entsteht hier entweder durch elementare Lernprozesse oder durch das Vertrauen auf die Beobachtung erster Ordnung der Informationen eines anderen psychischen Systems. Da dies nur im sozialen Kontakt möglich ist, gestaltet sich dieser Prozess durch Irritationen des psychischen Systems durch soziale Systeme, also durch Kommunikation. Diese
„(..)kommt zustande durch eine Synthese von drei verschiedenen Selektionen – nämlich Selektion einer Information , Selektion der Mitteilung dieser Information und selektives Verstehen oder Missverstehen dieser Mitteilung und ihrer Information.“ (Luhmann, 1995, S. 115)
Mit der Synthese und der gleichzeitigen Unterscheidung dieser drei Selektionen unterscheidet sich Kommunikation von bloßer Wahrnehmung als psychischem Ereignis. Wahrnehmung, also psychische Informationsgewinnung, hat im psychischen System ein Verhalten zu Folge. Dieses Verhalten wird für andere psychische Systeme beobachtbar.
„Wahrnehmung ist, im Vergleich zu Kommunikation, eine anspruchslosere Form von Informationsgewinnung. (...). Wahrnehmung ist zunächst psychische Informationsgewinnung (...), nur in wenigen Fällen verdichtet sie sich zu Kommunikation“ (Luhmann, 1991b, S. 560)
Erst durch die Beobachtung im sozialen Kontext erwächst aus bloßem Verhalten eine Handlung. Diese Handlung ist also Element des sozialen Systems, somit Kommunikation. Es ist daher nicht das psychische System das handelt, sondern die Kommunikation[11], die die Grundeinheit und Strukturkomponente des sozialen Systems darstellt.
Mit der gegenseitigen Wahrnehmung mindestens zweier psychischer Systeme entsteht ein Interaktionssystem, das sich durch Kommunikation charakterisiert. Dabei kommunizieren also nicht psychische Systeme oder gar Menschen, sondern der Kommunikationsprozess vollzieht sich autopoietisch im sozialen System.
„Bewusstseinssysteme und Kommunikationssysteme bestehen mithin völlig überschneidungsfrei nebeneinander.“ (Luhmann, 1995, S. 45)
Nur die Kommunikation kommuniziert. Dennoch kann natürlich kein soziales System ohne psychische Systeme existieren: So wie psychische Systeme auf ihren Organismus angewiesen sind, sind soziale Systeme auf psychische Systeme angewiesen und damit strukturell gekoppelt. Diese strukturelle Koppelung ergibt sich aufgrund von Erwartungsstrukturen im sozialen System, die sich wiederum in einem vom sozialen System konstruierten Personenbegriff konstituieren, worin Handlungen der Kommunikation im System der jeweiligen Person zugeschrieben werden:
„ Personen dienen der strukturellen Kopplung von psychischen und sozialen Systemen . Sie ermöglichen es dem psychischen System, am eigenen Selbst zu erfahren, mit welchen Einschränkungen im sozialen Verkehr gerechnet wird.“ (Luhmann, 1995, S. 153f)
Diese Zuschreibung des sozialen Systems wird vom psychischen System wahrgenommen. Die Erwartungen die einer Person im sozialen System entgegengebracht werden, fungieren so als äußere Form der Person. Die Konstruktion dieser Erwartung im psychischen System stellt die innere Form der Person dar. Das Verhalten des psychischen Systems entlang der Erwartungen trifft im sozialen System auf Resonanz.
„Das Bewusstsein, eine Person zu sein, gibt dem psychischen System für den Normalfall das soziale o.k.; und für den abweichenden Fall die Form einer im System noch handhabbaren Irritation.“ (Luhmann, 1995, S. 154)
Das psychische System ist als Umwelt des sozialen Systems angehalten, zu lernen, im System als die Person zu erscheinen, die die Teilhabe an diesem rechtfertigt. Lernen durch Nachahmung ist insofern immer an ein normatives Lernen gebunden, da es einen sozialen Kontakt voraussetzt.
Die strukturelle Kopplung und die damit einhergehenden Erwartungen sind immer Verhaltenserwartungen, die auf die Sozialisation eines psychischen Systems abzielen.
„Sie [die Sozialisation[12] ] geschieht überall, geschieht in jedem sozialen Kontakt, sofern die Beteiligten in der wechselseitigen Beobachtung oder in der Reaktion auf Zumutung lernen.“ (Luhmann, 1990, S. 211)
Psychische Systeme können sich also dem Sozialisationsprozess nicht entziehen. In der Entscheidung, den Erwartungen zu entsprechen oder eben nicht, verhalten sie sich jedoch autonom. Sozialisation ist demzufolge immer Selbstsozialisation.
Der Sozialisationsprozess beginnt so mit der Geburt in der Familie (bzw. in der Interaktion mit Sorgetragenden, die das Überleben eines Kindes sichern) und setzt sich im sozialen Kontakt für das psychische System lebenslang fort.
„Sozialisation vermittelt natürliche und soziale Verhaltensbedingungen als Selbstverständlichkeiten . (Luhmann, 2002, S. 53)
Sozialisation ist keine Spezialfunktion der Familie, jedoch kommt der Sozialisation in der Familie eine besondere Bedeutung zu. Das Sozialsystem Familie ist darauf eingestellt die gesellschaftliche Inklusion der ganzen Person zu ermöglichen (vgl. Luhmann, 1990, S. 211).
Die Verhaltensweisen, die in der Interaktion vom psychischen System als Handlungen beobachtbar werden, sind aufgrund von Erfahrungen getroffene Entscheidungen (also erlerntes Wissen) der jeweiligen beobachteten psychischen Systems.
Die von den Familienmitgliedern vorgelebten Verhaltensweisen werden vom Kind übernommen oder auch nicht. Als autopoietisches System entscheidet das psychische System Kind dies selbst, es sozialisiert sich also ausschließlich selbst.
„Der Prozess der (Selbst)sozialisation kann mithin als Prozess der Bildung von Erwartungen begriffen werden, die ihrerseits dann regulieren, welche Ereignisse für das System möglich sind.“ (Luhmann, 2004, S. 115)
Die anderen Sozialsysteme beziehen sich auf die Person gebunden an eine ausgeprägtere Form der Rollendifferenzierung.
So ist das Kind als Mitglied der Organisation Schule dort in der Rolle des Schülers. Auf diese Rolle beschränken sich auch die Erwartungen an seine Person im Unterricht. Die Schule hat die Aufgabe, Schüler zur Bildung zu erziehen.
„(...) [Erziehung stellt[13] ] im Unterschied zu Sozialisation, absichtsvoll herbeigeführte, als Verbesserung gemeinte Veränderungen psychischer Systeme [dar[14] ]“ (Luhmann, 2004, S. 159)
Erziehung findet auch in der Familie statt, jedoch ist in der Familie anders als in der Schule als Organisation, die Befolgung bestimmter Regeln nicht Bedingung für Mitgliedschaft. So stabilisiert sich die Kommunikation in der Familie auf der Grundlage von Vertrauen.
2.2 Vertrauen
Für das Erkenntnislernen ist Selbstvertrauen unerlässlich. Nachahmungslernen erfordert Fremdvertrauen, da diesem keine selbst gemachten Erfahrungen im psychischen System vorausgehen. Für alle Arten des Wissenserwerbs ist folglich Vertrauen notwendige Grundlage.
Die Autonomie eines Heranwachsenden entwickelt sich aus zunehmenden Erfahrungen, die sich in seiner Wissensstruktur zu Erwartungen verdichten, auf die er Vertrauen kann. Dies geschieht zunächst im Sozialisationsprozess in der Familie.
Schule und Familie haben so das gemeinsame Ziel, die Heranwachsenden auf ein Leben in der Gesellschaft vorzubereiten, also zur Autonomie zu führen.
„Der Übergang zur funktionalen Differenzierung [der Gesellschaft[15] ] hat für die Prozesse der Sozialisation und Erziehung weitragende Bedeutung. Sie ergibt sich daraus, dass jetzt in einem Sondersystem für andere Systeme erzogen wird. In der eigenen Familie wächst der junge Mensch zunächst problemlos und nahezu übergangslos in das gesellschaftliche Leben hinein in dem Maße, als sein Aktionsradius, sein Kontaktradius sich vergrößert. Der erzwungene Einritt in die Schule konfrontiert ihn dagegen erstmals und plötzlich mit der nicht mehr durch seine Familie vermittelte Gesellschaft.“ (Luhmann, 1988b, S. 25)
In der Schule wird der Heranwachsende mit Erwartungen konfrontiert, die sich an seine Person in der Rolle als Schüler richten. Das Vertrauen, das in der Familie – von Ausnahmen abgesehen – auf Inklusion der ganzen Person beruht, richtet sich also nun an die rollengebundene Person des Schülers als psychisches System. Dabei stellt sich die Problematik, dass der Schüler sich in seiner ungefestigten Autonomie als ganze Person noch nicht schützen kann, sich aber wegen seiner noch nicht ausgeprägten Rollenhandlungsfähigkeit als ganze Person in die Schulsituation einbringt. Durch die rollenspezifische Ebene im Unterricht, steigt mit fehlender Anerkennung des Schülers als ganze Person die Wahrscheinlichkeit für Misstrauen des Schülers in den Lehrer.
„Misstrauen ist jedoch nicht nur das Gegenteil von Vertrauen, sondern als solches zugleich ein funktionales Äquivalent für Vertrauen. Nur deshalb kann (und muss) man nämlich zwischen Vertrauen und Misstrauen wählen. (...) Vertrauen reduziert soziale Komplexität (...). Wer sich nur weigert, Vertrauen zu schenken, stellt die ursprüngliche Komplexität der Geschehensmöglichkeiten wieder her und belastet sich damit. Solches Übermaß an Komplexität überfordert aber den Menschen und macht ihn handlungsunfähig.“ (Luhmann, 1973, S. 78)
Gerade diese Handlungsfähigkeit oder -unfähigkeit bestimmt aber die Beurteilung in der Schule für den Schüler. Der Lehrer ist – durch die Erwartung der zielgerichteten Wissensstabilisierung im psychischen System Schüler – im Unterricht also auf das (Fremd)vertrauen des Schülers angewiesen. Anders gesagt: Die Wahrscheinlichkeit, dass sich der Sozialisationsprozess im psychischen System Schüler an den Sinnvorgaben des Lehrers orientiert, wird durch das Vertrauen in den Lehrer sehr viel wahrscheinlicher. Aber:
„Man kann Vertrauen nicht verlangen. Es will geschenkt und angenommen sein. Vertrauensbeziehungen lassen sich daher nicht durch Forderungen anbahnen, sondern nur durch Vorleistung – dadurch, dass der Initiator selbst Vertrauen schenkt oder zufällig sich bietende Gelegenheiten benutzt, sich als vertrauenswürdig darzustellen. (...) Für den Vertrauenden ist seine Verwundbarkeit das Instrument, mit dem er seine Vertrauensbeziehung in Gang bringt.“ (Luhmann, 1973, S. 46)
Schüler und Lehrer befinden sich jedoch in ihrer einer asymmetrischen Beziehung. „Verwundbarkeit“ findet sich nur auf Seiten der Schüler. Die Rolle des Lehrers drückt sich in einer durch den Selektionszwang gegebenen Machtposition aus, der sich der Lehrer nicht entziehen kann. Er wird für die Schüler berechenbar, doch die Wahrscheinlichkeit der Vertrauensbildung sinkt:
Personen und Sozialsysteme, die Vertrauen dadurch verdienen, dass sie starr und unbeweglich bleiben und damit sind, was sie sind, nämlich berechenbar, sind langfristig eine Gefahr für die Erhaltung des Systems und damit für die Fortsetzbarkeit von Vertrauen, da sie eine weniger komplexere Umwelt voraussetzen (vgl. Luhmann, 1973, S. 67).
Vertrauensbildung erfordert den beiderseitigen Einsatz von Vertrauendem und demjenigen, dem vertraut wird. Es kann nur auf die Probe gestellt werden, indem sich beide darauf einlassen „und zwar in nicht umkehrbarer Reihenfolge: zuerst der Vertrauende und dann der dem vertraut wird“ (vgl. Luhmann, 1973, S. 45). Durch die noch nicht erlernte Rollenhandlungsfähigkeit, bezieht der Schüler die durch den Lehrer an ihn gestellten Erwartungen auf seine ganze Person. Werden diese Erwartungen aus der Sicht des Lehrers nicht erfüllt, kommt es zwangsläufig zu Sanktionen, aktuell in der Interaktion und nachhaltig durch die gegebene Zwangsbenotung durch den Lehrer. Dem Schüler bleibt im asymmetrischen Unterrichtssystem mithin nur der Versuch, diesen Erwartungen zu genügen oder andernfalls die Konsequenzen zu tragen. Im Unterricht bietet sich so eine geringe Wahrscheinlichkeit der Vertrauensbildung der Schüler in den Lehrer.
Das Bemühen des Lehrers, eine positive Vertrauensbasis zum Schüler aufzubauen ist somit grundsätzlich erschwert, da sich Lehrer und Schüler der Selektionsfunktion im Unterricht nicht entziehen können.
[...]
[1] Für bessere Lesbarkeit verzichtet diese Arbeit auf die doppelte Nennung von Schülerin und Schüler bzw. Lehrerin und Lehrer zugunsten der männlichen Form.
[2] online verfügbar unter http://www.dradio.de/dlf/sendungen/interview_dlf/1024129/
[3] online verfügbar unter http://bda-online.de/www/arbeitgeber.nsf/id/DE_Schule
[4] Wobei der Verfasserin bewusst ist, dass diese Antwort auf der Grundlage bestimmter Unterscheidungen im Rahmen ihrer Beobachterperspektive zustande kommt.
[5] Aus Gründen der Einheitlichkeit werden Originalzitate, die der alten Rechtschreibung folgen, in die neue Rechtschreibung übertragen.
[6] also während das System ein anderes Problem lösen wollte
[7] aber nicht bewusste
[8] also angenommene und ebenfalls nicht bewusste
[9] Anmerkung der Verfasserin
[10] Fremdreferenz meint die Beschreibung der Umwelt durch das System.
[11] Hier zeigt sich exemplarisch – und darum sei noch einmal darauf verwiesen – die von Baecker festgehaltene „intuitive Schwergängigkeit“ des Luhmannschen Kommunikationsbegriffs.
[12] Anmerkung der Verfasserin
[13] Anmerkung der Verfasserin
[14] Anmerkung der Verfasserin
[15] Anmerkung der Verfasserin
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Erstausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2009
- ISBN (Paperback)
- 9783863414047
- ISBN (PDF)
- 9783863419042
- Dateigröße
- 274 KB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Universität zu Köln
- Erscheinungsdatum
- 2015 (Februar)
- Note
- 1
- Schlagworte
- Konstruktivismus Luhmann Systemtheorie heimlicher Lehrplan Lernen Pädagogik
- Produktsicherheit
- BACHELOR + MASTER Publishing