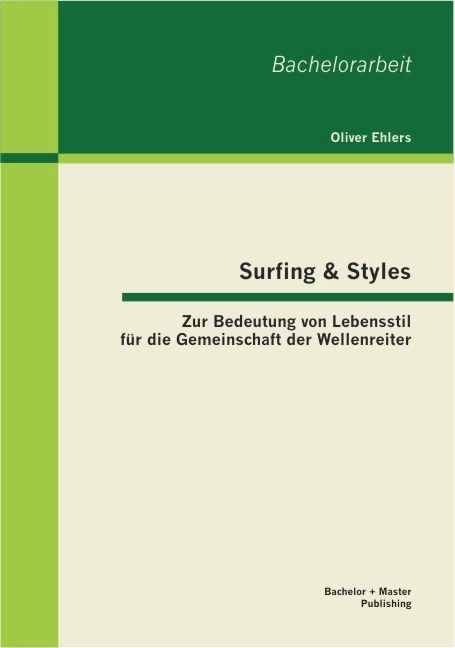Surfing & Styles: Zur Bedeutung von Lebensstil für die Gemeinschaft der Wellenreiter
Zusammenfassung
Im Rückblick auf meine eigene Wellenreiterkarriere stelle ich diesbezüglich fest, dass zu verschiedenen Zeitpunkten je unterschiedliche Bündel aus Surfbrettern, Surfmanövern, Profisurfern, Surfmarken, Surfspots, Surfreisezielen oder Kleidungsstücken (bzw. deren gewollte Abwesenheit) in meinen Wünschen und meinem Besitz vertreten gewesen sind, die mir irgendwie interessant, cool und zu meiner Person passend vorgekommen sind und mir gegenüber der Surfergemeinschaft und meiner Alltagswelt in irgendeiner Weise eine treffende Inszenierung meiner selbst versprochen haben.
Die praktische Auseinandersetzung mit dem Phänomen Wellenreiten scheint zusammengefasst einherzugehen mit der Ausbildung eines spezifischen Lebensstils, eines surferischen Stils und Stilisierens des eigenen Alltagslebens. Dieser persönliche Eindruck aus meiner Teilnehmerperspektive soll im Rahmen der vorliegenden Bachelorarbeit eine wissenschaftliche, theoretisch fundierte Aufarbeitung erfahren. Unter Zuhilfenahme einer kultursoziologischen Brille entlang der Bourdieu’schen Konzepte von Habitus und Feld wird untersucht, in welchem Verhältnis Lebensstile in der Gemeinschaft der Wellenreiter zu deren Formierungs- und Vergemeinschaftungsprozessen stehen und welche Bedeutungen und Funktionen Stil in diesem Zusammenhang zukommt.
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
2 Wellenreiten im kulturellen Feld des Sports
Zur Klärung der eingangs aufgeworfenen Frage, in wie weit es sich beim Wellenreiten um eine Sportart oder vielmehr um einen Lebensstil handelt bzw. in welcher Relation es zu diesen beiden steht sowie für eine erste kultursoziologische Fundierung dieses Phänomens, wird in diesem Kapitel eine Verortung des Surfens im kulturell und historisch geformten Raum des Sports vorgenommen.
2.1 Die relationale Bedeutung von Sportarten
Im Anschluss an Pierre Bourdieu lassen sich die vielgestaltigen Formen von Sport „als eine Art Angebot verstehen, das auf eine bestimmte gesellschaftliche Nachfrage stößt“ (Bourdieu 1992, 91). Die Angebotsseite des Sports kann dabei als „Raum der Sportarten“ (ebd., 193) verstanden werden, in dem die zahlreichen sportlichen Betätigungsformen in einem relationalen Beziehungsgefüge zueinander positioniert sind. Über Gegnerschaften und Nachbarschaftsverhältnisse wie sie beispielsweise zwischen Skifahrern und Snowboardern auf der einen und Snowboardern und Wellenreitern auf der anderen Seite erkennbar sind, weisen sich die verschiedenen Sportarten ihre Position in dieser landkartenähnlichen Ordnung des Sportraumes zu. Die jeweilige Bedeutung einer Sportart geht dabei immer erst aus ihren Verhältnissen zu allen anderen Sportarten des Raumes hervor. Entlang der wachsenden Anzahl unterschiedlicher Körperpraktiken zeigt der Angebotsraum eine zunehmend komplexe Binnenstruktur, deren hierarchische Ordnung auf die Verhältnisse der Sportarten zueinander gründet (vgl. ebd, 195).
Der kulturelle Raum des Sports ist in der analytischen Konstruktion Bourdieus nicht fest mit dem sozialen Raum verklammert. Ihr Zusammenspiel fußt lediglich auf den körperlichen Analogien zwischen Sportpraktiken und sozialen Dispositionen. Es entscheidet sich auf der einen Seite danach, in welcher Weise eine Sportpraktik den Körper seiner Aktiven einsetzt: Welche Bewegungsweisen, Körperbilder, Körpervorstellungen und ausgebildeten Haltungen sie zu ihrer Ausführung einfordert, welche körperlichen Beziehungen zu anderen Teilnehmern nötig sind oder welches körperliche Selbstverhältnis hierzu an den Tag gelegt werden muss (vgl. Schmidt 2009, 165).. Auf der anderen Seite entscheidet es sich gleichsam danach, inwieweit die Praktik „den Möglichkeiten Rechnung trägt, welche im Körper der Akteure“ (Bourdieu 1985, 7) angelegt sind.
„[Die] spezifische Logik, dergemäß die Akteure sich eher diesem als jenem Sport zuwenden und eher auf diese als auf jene Weise praktizieren, [ist] erst dann nachvollziehbar, wenn die jeweils besonderen Haltungen und Einstellungen zum Sport Berücksichtigung finden, die – als Dimensionen eines jeweils bestimmten Verhältnisses zum eigenen Körper – dem einheitlichen System der Dispositionen eingebunden sind, das heißt dem Habitus als Fundament der Lebensstile.“ (Bourdieu 1986, 106f)
Sportangebote und ihre Nachfrage bewegen sich damit in einem relationalen Verhältnis zueinander, deren jeweilige Entwicklungen „aus der unablässigen Konfrontation und Anpassung jener beiden [...] resultiert“ (ebd., 106).
2.2 Veränderungen im Raum des Sports
Das relationale Gefüge des kulturellen Raumes der Sportangebote ist jedoch immer nur zu einem bestimmten Zeitpunkt gültig und unterliegt einer permanenten Differenzierungs- und Innovationsdynamik. Jedes Auftreten einer neuen bzw. der Bedeutungswandel einer bestehenden Sportart bewirkt immer eine Umgestaltung seines gesamten Relationengefüges (vgl. Bourdieu 1992, 195).. Derartige Prozesse lassen sich auch innerhalb einer Sportart beobachten, die hierdurch immer neue und feingliedrigere Unterarten der grundlegenden Praxisform hervorbringen und dadurch intern, neue soziale Unterscheidungsgelegenheiten bereitstellen. Die aufgezeigte Innovations- und Differenzierungsdynamik legt ein Verständnis des Sportraums als ein Kampffeld nahe, auf dem die Akteure unterschiedlicher sozialer Regionen nach den Regeln des kulturellen Raumes des Sports um soziale Anerkennung für ihre körperlichen Einsätze ringen.
Diese Rangeleien im Sportraum finden jedoch nicht ausschließlich mittels rein sportlicher Praxisformen statt. Sie werden zunehmend auch mit solchen kulturellen Praktiken ausgetragen, die zwar eigentlich nicht dem Sportraum entstammen, sich aber auch auf den Körper der Sportakteure beziehen. Die sozialen Auseinandersetzungen im Sportraum sind also darüber hinaus auch „eingebettet in ein umfängliches Feld von Auseinandersetzungen, die die Definition des legitimen Körpers und des legitimen Gebrauchs des bzw. Umgangs mit dem Körper zum Gegenstand haben“ (Bourdieu 1986, 99). Ihre Teilnehmer sind „neben den Vereins- und Verbandsfunktionären, Trainern, Sportlehrern und sonstigen Anbietern von Gütern und Dienstleistungen des Sportbereichs, neben [...] Kirchenvertretern, Medizinern und [...] Erziehern [...] auch die Richter über Geschmack und Eleganz, die Modemacher, usw..“ (ebd.). Auch sie verfolgen in Bezugnahme auf Sportpraktiken die Durchsetzung ihrer jeweiligen Körperentwürfe und ihre Relevanz nimmt angesichts nachfolgend geschilderter Entwicklungstendenzen an Durchsetzungskraft zu. Sportive Tätigkeiten werden im Verlauf dieser Entwicklungen zu legitimen, stilisierenden Elementen einer alltäglichen Lebensführung und sind so zunehmend tiefer “eingebettet in den Wandlungsprozess der Lebensstile und damit dessen allgemeinen Gesetzmäßigkeiten unterworfen“ (ebd., 112).
2.3 Das präsentatorisch-inszenatorische Sportmodell
Der Angebotsraum des Sportes in Deutschland entwickelt in Anschluss an Robert Schmidt ab Ausgang der 80er Jahre eine kaum überschaubare Heterogenität, die im bisher gültigen Modell des vereinsmäßig organisierten und wettkampforientierten Sports nicht mehr aufgeht (vgl. Schmidt 2002, 31). Seine Entwicklung ist durch die drei ineinander verflochtenen Transformationsprozesse der Inklusion, Differenzierung und Expansion gekennzeichnet: die Einbindung zuvor sportferner sozialer Gruppen, das Aufkommen neuer Organisationsformen und Rahmungen im Sport und eine wachsende Anzahl und Ausdifferenzierung sichtbarer Sportpraktiken. Der starke Zulauf, den Gemeinschaften des informell organisierten Trend- und Extremsports (Bsp.: Wellenreiten) und der neu aufkommenden Spiele (Bsp.: Streetball, Frisbee-Golf etc.) im Zuge dessen verzeichnen, weist auf eine „beträchtlich gestiegene kulturelle Legitimität das Sports hin“ (Schmidt 2009, 169). Dem Praxismuster Sportivität kommt auf Basis dieser Entwicklungen eine vermehrte Sichtbarkeit in der alltäglichen Lebensführung gesellschaftlicher Akteure zu, dessen Beschreibung nicht mehr auf das Modell des vereinsmäßig organisierten Wettkampfsports rückführbar ist. Es bildet sich nach Robert Schmidt ein neues, präsentatorisch-inszenatorisches Modell des Sports heraus (vgl. Schmidt 2002, 31).
Gegenüber Wettkampf und Leistung stehen in diesem Modell neben gesundheitsbezogenen Funktionen des Sportreibens vor allem Aufführungen von körperlich ästhetischer Kompetenz im Vordergrund und damit Aspekte wie Gestik, Stil, Aussehen oder Erscheinung (vgl. Schmidt 2002, 32). Parallel hierzu ist eine gegenseitige Durchdringung von Elementen des Sports mit den vielfältigen Angeboten, Stilistiken und Konsummustern der kommerziellen und medienvermittelten Populärkultur zu beobachten. Diese wird neben einer vermehrten Inanspruchnahme öffentlicher Räume am nachdrücklichsten in der Symbiose sportiver Praktiken mit Mode und Freizeitkonsum sichtbar (vgl. ebd.). Der rein funktionale, praktische und auf den sportlichen Wettkampferfolg bezogene Charakter von Sportbekleidung gerät gegenüber dessen neuer Bedeutung für „Triumphe im gesellschaftlichen Verkehr“ (Rittner 1989, 360) ins Hintertreffen. Die sozialen Auseinandersetzungen im kulturellen Raum des Sports werden in einem neuen Modus geführt. Kulturelle Grenzziehungen im Sportraum und innerhalb der Sportformen sowie das Herstellen von Zugehörigkeit gründen dabei wesentlich auf das authentische Präsentieren einer gefragten körperlichen Stilistik. Entlang dieses neuen Modus der Vergemeinschaftung über körperliche Praktiken, Stilistiken und Attribute, mit einer zentraleren Bedeutung von Gerätschaften, Mode und anderen popkulturellen Elementen, stellen die Praxisformen des neuen präsentatorisch-inszenatorischen Sports ein zunehmend legitimes alltagskulturelles Muster dar (vgl. Heinemann 1993, 93ff). Sie bieten den unterschiedlichen und immer neu eintretenden sozialen Milieus eine Gelegenheit, sich eine distinkte Wiedererkennbarkeit und Darstellungsfähig zu verleihen. Die vielgestaltigen Praxisangebote des Sportraums eröffnen eine Bühne zur sozialen „Repräsentationsarbeit“ (Bourdieu 1985a, 16) auf der verschiedene Gruppierungen und Milieus versuchen, „ihre gesellschaftliche Identität durchzusetzen“ (ebd.). In ihrer sportlichen Repräsentationsarbeit erzeugen die Milieus eine kulturelle Wirklichkeit, die sie von anderen Milieus in dieser selbstgeschaffenen Sichtbarkeit unterscheidet (vgl. Schmidt 2009, 171). Der gewandelte Sport stellt sich in der Gegenwartsgesellschaft somit als ein komplexes kulturelles System körperlicher Praktiken dar, auf dessen Bühne eine Vielzahl „kollektiver sozialer Identitäten ausgedrückt, körperlich dargestellt und sichtbar gemacht, beglaubigt und bekräftigt werden“ (ebd., 162) können.
3 Die Gemeinschaft der Wellenreiter
Entlang seiner expressiven Körperpraktiken des Wellenreitens, im Rahmen der Gemeinschaft gegebener Möglichkeiten zur Umcodierung mitgebrachter Dispositionen zu einer surferischen Körper- und Lebensstilistik und seinem Modus sozialer Aggregation stellt Wellenreiten ein signifikantes Angebot im entstehenden Konvergenzbereich von Pop- und Sportkultur dar. Trotz seiner ungleich weit zurückreichenden Geschichte und Tradition [1], stellen u. a. Lamprecht/Stamm (vgl. 2002, 129) Wellenreiten in die Nähe sozial ähnlich kontextualisierter Bewegungskulturen und Szenen sogenannter Trend-, Mode- oder Risikosportarten wie Skateboarding, Snowboarding oder auch Kitesurfing. Ford/Brown begründen die Nähe des Wellenreitens zu solchen lifestyle sports zudem auf Basis geteilter struktureller Elemente und Diskurse:
„[...] concerns with authenticity, sensation and thrill-seeking, mediatization, widespread social debate regarding the place of professionalism and competition, and especially high levels of involvement in the practice by ‚hardcore’ participants.“ (Ford/Brown 2006, 63)
Als ein Vertreter der Aggregationsform Sportszene gründen die Rahmungen der Wellenreitgemeinschaft auf „ähnlichen verkörperten Dispositionen der Teilnehmer [und auf ein] fremdorganisiertes, von der Sport- und Lifestyle-Industrie bereitgestelltes Angebot“ (Gebauer et al. 2004, 63). Zugehörigkeit lässt sich in diesen sozialen Kontexten nicht schon formal via Mitgliedsausweis garantieren, sondern muss in einem „doppelten Auswahlprozess des Präsentierens und Akzeptierens von Attributen“ (ebd., 58) immer wieder aufs Neue performativ hergestellt werden. Die Möglichkeit einer Teilnahme an den Praktiken der Bewegungskultur findet sich nach Gebauer et al. im Verweis auf Bourdieu im Moment einer „prästabilierten Harmonie zwischen dem einzelnen Stilisten und der Spielgemeinschaft“ (ebd., 64) bedingt und benötigt zu ihrer Realisierung neben der Übereinstimmung äußerer Merkmale von Kleidung, Accessoires und Sportgeräten, vor allem eine Passung zum, „im Habitus verankerten praktischen Umgangs mit den Attributen“ (Gebauer et al. 2004, 64). Mit diesen Elementen verschlungene Aufführungen bieten den Akteuren Möglichkeiten des ostentativen Hervorbringens gemeinschaftlichen wie gleichsam individuellen Stils, der den „Kern der kollektiven Identität“ (Gebauer et al. 2004, 65) der Sozialform einer Szene bildet und dem einzelnen Akteur insoweit eine Mitgliedschaft versichert, wie er in der Lage ist, diesen mittels seiner individuellen Ästhetik und Stilistik glaubhaft aufzuführen:
„Es ist der von allen Beteiligten anerkannte Stil, der die Gemeinschaft zusammenhält, ihr Beständigkeit gibt und ihre zeitliche Kontinuität sicherstellt. Als ein solcher Stabilitätsgarant tritt in den neuen Spielgemeinschaften der Stil an die Stelle von Satzungen und Vereinsstrukturen.“ (Gebauer et al. 2004, 65)
Mit anderen Worten: Zur Teilnahme muss der Akteur die vorhandenen „Gemeinschaftsmotoriken“ (Vgl. Gebauer 2002, 162ff) der Szene und ihren Akteuren in seinen praktischen Hervorbringungen weitgehend reproduzieren können.
„Im Zusammenspiel von Bewegungsmustern, Zeichen, ritualisierten Handlungen, Gesten und Symbolen formieren sich kollektive Repräsentationen und ein gemeinsamer Glaube [...]. In den körperlichen Aufführungen im Spiel modelliert die Gemeinschaft ihre Gestalt; sie wird erkennbar und beginnt für sich und andere sozial zu existieren.“ (Gebauer et al. 2004, 65)
Das nachfolgende Kapitel widmet sich daher den stilistischen Idealvorstellungen des Surfens und deren Verschränkung mit dem gemeinsam geteilten, körperpraktisch fundierten Glauben seiner Gemeinschaft.
3.1 Der gemeinsam geteilte Glaube
Die Wellenreitszene wird wesentlich durch eine eigenlogische Ordnung bestimmt.
„The joy, peak experience and sheer pleasure of [...] surfing has prompted a cultural process of reflections and storytelling, through which practitioners have sought to make sense of their obsession and passion.“ (Ford/Brown 2006, 166)
In ihren Darstellungen konturiert sie sich gegenüber anderen kulturellen Feldern, beispielsweise dem politischen oder dem ökonomischen als relativ autonomes Feld.
„[...] status through economic capital is probably not a high priority for most surfers.“ (Ford/Brown 2006, 76)
Dies zeichnet sich auch in nahezu allen Idealisierungen eines surferischen Lebensstils ab. Es wird das Ideal eines Vollzeitakteurs sichtbar, der sich - Bourdieus Beschreibung eines freien Künstlers sehr ähnlich - seiner surferisch praktischen Tätigkeit total und ausschließlich widmet, der gesellschaftlichen Anforderungen und Ansprüchen und den Imperativen bürgerlicher Moral gegenüber gleichgültig bleibt und keine andere Bewertungsinstanz anerkennt als die spezifische Norm seiner Bewegungskunst und seines Umfelds (vgl. Bourdieu 1999, 127).
„[...] surfing subculture articulates a middle class myth of holiday leisure time spent in relaxation. The ‚surfie’ appears to live a life of escape in the eyes of the individual trapped in a 48-hour-a-week job, and is given a certain status by his/her position as myth.“ (Ford/Brown 2006, 66)
Surferische Stilisierungen und Ritualisierungen führen sich dementsprechend als möglichst direkt und permanent auf den Ozean bezogen und an dessen Veränderungen angepasst sowie dessen Surfpotential optimal und möglichst virtuos ausnutzend auf (vgl. Ford/Brown 2006, 74). Akteure, die einen solchen hardcore surfing lifestyle in ihrem Alltag glaubhaft als eine die gesamte Lebensführung einbindende Form hervorbringen, genießen im Rahmen der Szene höchstes Renomé als ernstzunehmende Surfer (vgl. Ford/Brown 2006, 76). Derartiges Ansehen in der Szene kann mit Pierre Bourdieu als symbolisches Kapital des Hervorbringenden verstanden werden.
Es „besteht aus einem beliebigen Merkmal, [...] das wie eine echte magische Kraft symbolische Wirkung entfaltet, sobald es von sozialen Akteuren wahrgenommen wird, die über die zum Wahrnehmen, Erkennen und Anerkennen dieser Eigenschaft nötigen Wahrnehmungs- und Bewertungskategorien verfügen: Ein Merkmal, das, weil es auf sozial geschaffene ‚kollektive Erwartungen’ trifft, auf Glauben, eine Art Fernwirkung ausübt [...].“ (Bourdieu 1985, 173)
Diese als Glaube bezeichnete, kollektiv geteilte Erwartung innerhalb eines Feldes bezeichnet Bourdieu an anderer Stelle mit dem Begriff der illusio als das, „um was es bei diesem Spiel geht (also die illusio im Sinne von Spieleinsatz, Spielergebnis, Spielinteresse, Anerkennung der Spielvoraussetzungen - doxa)“ (Bourdieu 1987, 122). Als praktischer Glaube der Feldakteure bezeichnet die doxa ein körperliches Verhältnis, eine leibliche Haltung des Glaubens gegenüber den Selbstverständlichkeiten eines Feldes. Sie ist „jenes unmittelbare Verhältnis der Anerkennung, das in der Praxis zwischen einem Habitus und dem Feld hergestellt wird, [...] also jene stumme Erfahrung der Welt als einer selbstverständlichen [...]“ (Bourdieu 1987, 126). Diese Glaubenshaltung der Akteure, die eine symbolische Wirkung und ihre Kapitalisierung im Feld erst ermöglicht, fußt nach Bourdieu wiederum auf der Ausbildung oder das Innehaben feldspezifischer Wahrnehmungs- und Bewertungskategorien bei den Akteuren. Die Internalisierung der äußeren, materiellen und kulturellen Existenzbedingungen, der gegebenen Strukturen eines Feldes als hiermit verbundene Vorstellungen, Ansichten, Gefühle und Weltbilder in die Akteure erfolgt laut Bourdieu wesentlich auf körperlicher Ebene. Er spricht in diesem Zusammenhang auch von der Inkorporierung sozialer Praxen und gesellschaftlicher Normen, in der der Leib eine speichernde Funktion übernimmt sowie als Medium und Agens fungiert (vgl. Bourdieu 2001, 192). Die „Einarbeitung“ in ein immer schon strukturiertes, kulturelles Feld erfolgt nach Gebauer/Wulf über praktisch mimetische Prozesse, mittels „Bewegungen, die auf andere Bewegungen Bezug nehmen“ (Gebauer/Wulf 1998, 11). Mimesis meint hier jedoch nicht die direkte Reproduktion eines vorliegenden Modells, vielmehr ist es eine kreative Nachschöpfung realer oder möglicher Vorgänge, ritualisierter Handlungen, des Umgangs mit Dingen oder auch von Gesprächen und Personen. Sie vollzieht sich immer unter vorbewusstem Einbezug von Kriterien wie Anschaulichkeit, Wahrscheinlichkeit und Glaubhaftigkeit der eigenen Hervorbringung und ist aufgrund der individuellen Biografie eines jeden Akteurs gleichsam durch einen performativen Überschuss gekennzeichnet, der „etwas zur Aufführung [bringt, dass] es genau so noch nicht gegeben hat“ (Wulf 2001, 257).
3.2 Dersurferische Blick
Solches in der leidenschaftlichen [2] Auseinandersetzung mit dem Feld erworbenes körperliches Wissen [3] schreibt sich in die Dispositionen des Habitus der Akteure ein und repräsentiert sich nach Bourdieu zum einen äußerlich, in ihrer körperlichen Haltung als hexis, die den Glauben an das Feld äußerlich sichtbar manifestiert.
„Die körperliche Hexis ist die realisierte, einverleibte, zur dauerhaften Disposition, zur stabilen Art und Weise der Körperhaltung, des Redens, Gehens und damit des Fühlens und Denkens gewordene [...] Mythologie“ (Bourdieu 1987, 129).
Zum anderen zeigt es sich in der Herausbildung eines spezifischen praktischen Sinns für das Feld:
Dieser leitet Entscheidungen „[...] die zwar nicht überlegt, doch durchaus systematisch und zwar nicht zweckgerichtet sind, aber rückblickend durchaus zweckmäßig erscheinen. Als besonders exemplarische Form des praktischen Sinns, als vorweggenommene Anpassung an die Erfordernisse eines Feldes, vermittelt das, was in der Sprache des Sports als Sinn für das Spiel (wie Sinn für Einsatz; Kunst der Vorwegnahme) bezeichnet wird, eine recht genaue Vorstellung von dem fast wundersamen Zusammentreffen von Habitus und Feld, von einverleibter und objektiver Geschichte, das die fast perfekte Vorwegnahme der Zukunft in allen konkreten Spielsituationen ermöglicht.“(Bourdieu 1987, 122)
In Bezugnahme auf Szenen schreibt sich ein solcher Sinn nach Thornton unter Formung subkulturellen Kapitals [4] in die Körper der Szeneakteure ein und liegt ihnen als strukturierende wie strukturierte Schemata der Perzeption und Performation vor (vgl. Thornton 2005, 186). So beschreiben Ford/Brown die Ausbildung eines surferischen Blicks, der abhängig vom Karrierepunkt des Surfers für relevante Aspekte der Surfer-Kultur ein entsprechend hohes Maß an Sensibilität und Differenziertheit in der Wahrnehmung bereithält (vgl. Ford/Brown 2006, 82). Dieser Blick zielt über die Art und Weise der Betrachtung des Ozeans und seinen Wellenbedingungen und dem Erkennen und Bewerten von Virtuosität im Stil anderer beim Surfen hinaus auch auf Surfequipments und Kleidung dieser (vgl. Ford/Brown 2006, 82). Ebenso ist er auf die medialen Repräsentationen der Szene und Markenzeichen ausgerichtet (vgl. Wheaton/Beal 2003, 174).
3.3 Szenespezifische Stilisierungsrahmen
Solchen Wahrnehmungsschemata stehen nach Ford/Brown in der Szene gleichsam surferspezifische Hervorbringungsqualitäten gegenüber: ein als performance capital bezeichnetes Vermögen an Virtuosität in der körperlichen Haltung und der Art und Weise des Kombinierens von Manövern beim Surfen in verschiedensten Wellenbedingungen (vgl. Ford/Brown 2006, 77). Dieses kommt zudem in szeneadäquatem Gebrauch von Musik [5], Gerätschaften und Kleidung (vgl. Ford/Brown 2006, 66f) zum Tragen und bringt in den Aufführungen der Surfer einen mehr oder weniger prestigeträchtigen, individuellen, surferischen Stils hervor. Sie finden sich vor allem in den Bewegungsformen und Körperhaltungen des Wellenreitens selbst wieder, zeigen sich darüber hinaus aber auch in wiederholten Darstellungen und Versicherungen gemeinsamer Interessen und Leidenschaft in der Peripherie der eigentlichen Praxis (Bsp. morgendliche Kontrolle der Wellenbedingungen). Ritualisierte Handlungen und Symboliken bieten den Szeneakteuren dabei ebenso Möglichkeiten der Hervorbringung von Zugehörigkeit, wie der Abgleich von Erlebnissen in ihrer Wellenreitkarriere oder die Teilnahme an szeneeigenen Events oder sonstigen Zusammenkünften. Hierunter fallen im Wellenreiten über eine Teilnahme an organisierten Surfveranstaltungen und -parties hinaus beispielsweise auch die Annahme von Dienstleistungsarrangements von Surfschulen, surferorientierten Hostals oder Bars, ebenso wie die Nutzung von Surfmagazinen, Internetseiten zur Wellenvorhersage oder zum Austausch zwischen Wellenreitern über Spots, Surftrips oder Wellenbedingungen. Hier kommt es in Diskussionen über optimale Wellenhöhen, Tidenstände und Windrichtungen und den damit hervorgerufenen Hoffnungen auf kommende Surfsessions und ihrer Planung zur Geltung. Das tieferliegende Interesse an der Herausbildung und Benutzung einer relativ eigenständigen Surfersprache [6] zielt nach Ford/Brown - in Verweis auf Bourdieu - auf die Durchsetzung aristokratischer Differenzierung nach ‚außen’ als auch innerhalb der Surfszene und fungiert analog zur distinkten Körperpraxis als Mittel der Auseinandersetzung um kulturelles Kapital und Prestige (vgl. Bourdieu 1991, 94). Möglichkeiten der performativen Manifestation von Zugehörigkeit liegen darüber hinaus in der gekonnten Konsumation und Verwendung bedeutsamer Gerätschaften (Surfboards) und Warenangeboten (Surfbekleidung und Accessoires), deren Herkunft in der Surfszene oder ihrer direkten Umgebung verwurzelt sind (vgl. Ford/Brown 2006, 68). In Zusammenhang mit Soeffners Aussage: „[...] im Gegensatz zu alltäglicher Typenbildung enthält jeder Stil zusätzlich eine ästhetische Komponente – eine ästhetische Überhöhung – des Alltäglichen“ (Soeffner 1986, 319), erfüllen gerade diese Phänomene die Charakteristika einer Art von Bühne, auf der jeder Surfer (bewusst oder vorbewusst) zum einen die in ihrer Auffassung als legitim geltenden Praktiken der Szene und ihrer Unterfraktionen beglaubigt und zum anderen gleichsam eine Inszenierung performen [7] kann, die auf sein tiefenstrukturell verankertes individuelles wie überindividuelles Interesse verweist. Zwei dieser Bühnen sollen nun genauer analysiert werden.
3.3.1 Surfstile und Gerätschaften
Das am nachhaltigsten wirksame Prestige sichert sich der Akteur in der Wellenreitszene mittels seines performance-capital -Vermögens an Virtuosität in der körperlichen Haltung und der Art und Weise des Kombinierens von Manövern beim Surfen in kleinen wie großen Wellen (vgl. Ford/Brown 2006, 77). Ebenso markiert Booth diese Bühne als „basic sources of prestige among surfers: dancing style[...]“ (Booth 2003, 322). Er unterscheidet hierzu drei Stile, deren Auftreten mit je eigenen historisch-kulturellen und technologischen Aspekten einhergeht: „Polynesien rhythm, California hot dogging, and Australian shredding“ (Booth 2003, 323). Die Entwicklung dieser Stile beschreibt er in enger Zusammenschau und Abhängigkeit mit der technologischen Entwicklungsgeschichte des Surfboards.
Weil eine einfache Lenkbarkeit von Surfbrettern erst mit der Einführung von Finnen im Jahr 1935 möglich wurde, vermochten zuvor nur wenige Akteure, das aktuell medienübliche Bild des Wellenreitens hervorzubringen, seitwärts auf dem ungebrochenen Teil der Welle zu surfen und dies auch nur auf flachen und sachte brechenden Wellen, da die Kantenführung der finnenlosen Bretter hierzu nicht ausreichte.
„This limited technology produced a rigid, statue-like style; proficient surfers demonstrated their superior balance rather than graceful movements.“ (Booth 2003, 324)
Erst mit der Einführung der Finne wandelte sich diese Bewegungsästhetik hin zu ‚graziösen Posen’ mit leicht gebeugten Knien, leicht überstrecktem Rücken und leicht ausgebreiteten Armen, die das stilistische Bild des ‚Polynesien rhythm’ prägen (vgl. ebd.). Diesen Stil kennzeichnet eine möglichst genaue Anpassung des Wellenreiters an den fließenden Rhythmus einer Welle, indem er sich in unaufdringlicher Weise von dieser entlang ihrer natürlichen Richtung führen lässt und auf diesem Wege den Ausdruck einer möglichst exakt aufeinander abgestimmten Einheit von Welle und Surfer zu erzeugen sucht.
„Hawaiians have ‚traditionally exhibited an innate respect for the wave’ and ‚instead of attempting to impose their order on the wave they seek to join forces.’“ (Lopez 1976, 104)
Zusammen mit der Entwicklung des ersten sehr manövrierfähigen Surfbretts, dem Malibu [8], im namensväterlichen Küstenort Kaliforniens, wurde mit Beginn der frühen 50er Jahre der Stil des ‚hot dogging’ eingeleitet „[showing] maximum turns, climbing and dropping the board along the wall of the wave, stalling, walking to the nose of the board, dipping the head into the crest of the wave“ (Booth 2003, 324). In einer Transformation des hawaiianischen Stils, durch gleichzeitiges Zeigen von graziösem Anmut und gestalterischem Elan, zeigt sich der Versuch, im Gesamtausdruck dieses Bewegungsstils mit der Welle, ihre Ästhetik von Schönheit und Natürlichkeit noch zu verstärken (vgl. Booth 2003, 324).
Erneut im Kalender der Surfbrettentwicklung verortet, erfüllt sich im Auftreten des Shortboards [9], dessen schlagartige Durchsetzung sich im Wellenreiten zu drei Vierteln alleine im Jahre 1967 vollzog, die Bedingung der Möglichkeit zum Emporkommen des ‚Australian Shredding’. Zeichnete sich das ‚hot dogging’ noch sehr durch ein Unterstreichen und Betonen der natürlichen Ästhetik einer Welle aus, so kennzeichnet sich das ‚Australien Shredding’, im Gegensatz dazu im klaren Voranstellung der Ästhetik surferischer Bewegungsfiguren verschlungen mit dem Board und im Bemühen um ein Verhältnis der Dominanz gegenüber der Welle. Dies wird in einer sehr impulsiven und als aggressiv beschriebenen Bewegungsweise vollzogen.
„It was a major turning point, in the transformation of surfing from a smooth, rhythmic style into a gymnastic dance in which the wave became the apparatus on which to perform every imaginable maneuver.“ (Booth 2003, 325).
In der Fortschreibung dieses impulsiven Surfstils, dessen Gesamtgestus auch die Wettkampfästhetik des Wellenreitens prägt, fügt sich mit Ende der 90er Jahre die Bewegungsfigur des ‚Aerials’[10] an, die, zusammen mit weiteren aus dem Skateboardfahren abgeleiteten Tricks, die relativ eigenständige Bewegungsrhythmik der sogenannten „New School“ im Wellenreiten manifestiert.
Indem jede wellenreiterische Darbietung stets mit der Benutzung eines Surfbretts einhergeht, nimmt dieses ebenfalls eine zentrale Stellung in der Anhäufung von kulturellem Szenekapital und Prestige ein. ‚Performance capital’ findet sich ausschließlich von einer Art ‚Komplex’ aus Artefakt und Akteur hervorgebracht. Der Sichtbarkeit jeglichen Surfstils ist stets die Auswahl eines Bretts vorangegangen. Das Gespür für die Auswahl eines zum Surfkönne und -stil passenden Bretts entwickelt sich dabei als Teil des surferischen Blicks. Die Auswahl eines passenden ‚boards’ wird damit zu einer wesentlichen Bedingung jeder prestigeträchtigen körperlichen Hervorbringung, und die fahrstilistische Verortung des Akteurs in der Szene vollzieht sich als das Ergebnis eines zweifachen Auswahlprozesses bzw. in seiner geglückten Form als eine doppelte Passung: zwischen Gerätschaft und Akteur und gleichzeitig zwischen Gerätschaft-Akteur-Komplex und ‚gewähltem’ sowie anerkanntem Stil.
Die Performance des Wellenreiters erfolgt in einem permanenten Schwellenzustand zwischen der Hingabe an die Situation und ihrer Kontrolle. Das Surfbrett dient dem Surfer hierbei als emotional hoch besetztes Instrument zur Intensivierung von Erfahrungen und Erlebnissen, ebenso wie zum Erfinden und Weiterentwickeln von Manövern. Die Akteure verströmen ihre Affekte, Gefühle und Wünsche an die Geräte und wandeln sie auf diese Weise zu „charismatischen Produkten“ (Alkemeyer 2003, 186). In dieser Bedeutung haben sie im Rahmen der Szene nicht mehr den Status von rein technischen Geräten, sondern werden zu einem von Emotionen durchdrungenen Teil der Person und ‚verwachsen’ in der Wahrnehmung des Akteurs nach und nach als eine „leibnahe Technik“ (ebd., 188) mit dessen Körper. Einem flexiblen Kunstglied ähnlich, dient das technische Artefakt dem Surfer als Körpererweiterung und Sinneszone und entschwindet seiner Wahrnehmung im praktischen Umgang umso mehr, je größer dessen Virtuosität und Könnensstand sind. Die Aneignungen von szenekulturellen ‚performance capital’ stehen damit in ebenso direkter Verbindung zu den „skills“ (Ford/Brown 2006, 77) des surfenden Akteurs wie zum jeweils von ihm genutzten Surfboard, dass abhängig von seiner Beschaffenheit bestimmte Fahrweisen, Manöver und Wellenbedingungen favorisiert. In Abhängigkeit von Länge, Breite und Dicke, Formung des Hecks, der Seitenkanten und des Unterschiffs sowie dem Grad der Aufbiegung verschiedener Brettbereiche und der Konstellation und Anzahl verwendeter Finnen, bietet das Surfboard eine je spezifische Fahrcharakteristik, die bestimmte Fahrstile und Könnensstufen bevorzugt oder benachteiligt. Die Gerätschaften sind wichtig für die Selbstidentifikation und –darstellung der Szenegänger. Sie markieren individuelle Unterschiede innerhalb der Gemeinschaft und zeigen die Stellung ihrer Benutzer in ihr an. Es wird eine Gemeinschaft von Individualisten sichtbar, mit dem technisch erweiterten Bewegungsstil als Distinktionsmedium. Als solchermaßen aufgewertete Objekte besitzen die Sportgeräte aber nicht nur eine emotionale Bedeutsamkeit für ihre Besitzer, sondern verfügen für Gleichgesinnte auch über heraldische Bedeutungen, die zwischen den Personen und deren Kultur vermitteln (vgl. Marlovits 2001, 327f).
„In ihren sinnlich evidenten, symbolischen Dimensionen drücken die Spielgeräte habituelle Gemeinsamkeiten der Angehörigen einer Spiel-Gemeinschaft ebenso aus wie individuelle Unterschiede zwischen ihnen.“ (Alkemeyer 2003, 187)
Gleichzeitig mit der Bedeutung für die Performance trägt ein Surfboard eine historisch gewordene Symbolik in sich und nimmt einen konstitutiven Platz in der Szene-Mythologie erzeugter Texte und Bilder ein. Auch die Gebrauchsspuren und ästhetisch kreative wie technisch innovative Veränderungen an den Geräten haben hierbei ostentativen Charakter. In die zumeist surfgeschichtlich angebundenen Surfboardshapes[11] sind immer schon kollektive Vorstellungen von ihrer legitimen Benutzung eingelassen, die als Rudimente legitimer Surfpraxis aus deren Entstehungsepoche verblieben sind und dem Akteur, in Gestalt des Bretts und im Zusammenspiel mit dessen Fahreigenschaften und Mythologie in objektivierter Form, quasi als „Handlungsdispositiv“ (Foucault 1978, 119ff) vorliegen.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 1: Aktuell gängige Surfboardshapes.
Verstärkt wird diese historisch-symbolische Wirkung teilweise noch in der Wahl des Herstellers, der dem Board, als Ikone einer bestimmten Surf-Epoche oder eines bestimmten Surfstils, mittels seines Namens einen zusätzlichen Symbolwert verschaffen kann.
Die Wahl der Gerätschaft als objektivierter praktischer und emotional durchdrungener Wissensbestand der Szene bietet als Bühne zur Aufführung einer kreativen und individuellen Personalität, die sich im Besitz und im Gebrauch einer Gerätschaft zeigt, die Möglichkeit der ästhetischen Überhöhung und damit der Stilisierung des Akteurs. Sowohl durch seine emotionale und praxisermöglichende als auch durch seine symbolische Qualität bekommt das Sportgerät künstliche Strahlkraft, Flair und Image, „[...] schreibt sich in die Wunschökonomie der potentiellen Käufer ein und gestattet es, die technischen Produkte zur ästhetischen Stilisierung einer sozialen Lage, des Selbst und damit als Distinktionsmedium zu verwenden“ (Alkemeyer 2003, 186). In der Wahl seines Boards und im Stil seiner Verwendung bringt der Wellenreiter seine Vorstellung legitimer Surfpraxis zum Ausdruck und nimmt gleichzeitig eine distinkte Position im Szeneraum ein.
3.3.2 Kleidung
Bekleidung ist auch für Surfer sehr bedeutungsvoll. Im Wellenreiten kann, ebenso wie nach Wheaton/Beal in den verwandten Sportszenen des Windsurfens (vgl. Wheaton 2000, 270) oder Skateboarding (vgl. Beal 1995, 261) eine Szenezugehörigkeit auch durch die Präsentation bestimmter Kleidung hergestellt werden, die auf Einstellungen und Haltung und damit soziale Orientierung der Akteure verweist (vgl Soeffner, 318). Über den Habitus ist die äußerlich sichtbare Haltung des Körpers, die hexis, mit einer inneren Haltung von Gemütszuständen, Gefühlen und Gedanken verzahnt (vgl. Bourdieu 1987, 129). Über mimetische Praxis in der Surfszene inkorporieren die Akteure einen surferischen Blick und Stil. Kleidung fungiert im Rahmen der Auseinandersetzungen im Szeneraum daher „an der Schnittstelle von innen und außen“ (Scheipers 2008, 135) und nimmt bei den Akteuren die „Funktion einer textilen Membran“ (ebd.) ein.
„In den textil gestalteten Körperbildern zeigt sich nicht nur die äußerliche Inszenierung des Körpers, sondern Sich-kleiden beinhaltet auch eine leibliche Erfahrung und verweist auf die innere, sinnliche Wahrnehmungs- und Erlebnisdimension.“ (ebd.)
Indem ein szenespezifisches Bekleiden des Körpers stets mit dessen Formung und der Einnahme körperlicher Haltungen einhergeht, verfestigt sich im sich formenden Habitus ein korrespondierender surferischer Kleidungsgeschmack und -stil. Die kleidungsgelagerten Aufführungen der Szene werden jedoch nicht als rein kopierende oder nachahmende Inkorporation und Hervorbringungen angesehener Stilinszenierungen verstanden, sondern als Herstellung eines je neuen Verhältnisses zum Körper in mimetischer Bezugnahme und dessen performativer Aufführung.
„Die Hineinnahme der Gestaltungselemente des Anderen ‚ist eine Integration der anderen Welt in sein Inneres’, in die eigenen Vorstellungen von [...] coolness oder was immer die Wünsche, Absichten oder Phantasien der jungen Frauen und Männer berührt. In der Veräußerlichung und ‚Aufführung werden die Vorstellungen des Handelnden über sich selbst und die Gesellschaft dargestellt’.“ (Gebauer/Wulf 1998, 133)
Kleidungsstücke werden vor diesem Hintergrund als kulturelle Objekte verstanden, im Medium derer sich die Akteure auf essayistisch vorreflexive Suche nach solchen Kleiderkörpern begeben, die ihre historisch geformten wie gleichsam surfspezifisch umgearbeiteten körperlichen Habitus performativ zur Geltung bringen können. Im Anschluss hieran kann Kleidung szenespezifisches kulturelles Kapital in Abhängigkeit davon symbolisieren, wie sehr sie es vermag, einen für die Szene und ihre Akteure authentischen Stil möglichst umfänglich artikulierbar zu machen.
Bei Bekleidungselementen kann in der Wellenreitszene zwischen Kleidungsstücken und Accessoires unterschieden werden, die entweder einen vorrangig funktionalen Charakter haben und direkt in die Surfpraxis ‚eingewoben’ sind oder solchen, die für die Praxis des Wellenreitens eigentlich keine Notwendigkeit besitzen und als Surfmode ihren Nutzen vorrangig im Anzeigen von gewünschter, gefühlter oder auch tatsächlicher Zugehörigkeit zur Szene und ihren Fraktionen trägt.
Zu ersterer Kategorie zählen alle aus Neopren gefertigten Bekleidungsstücke, zu denen neben Ganzkörperanzügen auch Kopfhauben, Handschuhe, einzelne Hosen und Oberteile sowie Schuhe gehören. Sie dienen in erster Linie dem Erhalt der Körperwärme im Ozean und variieren in ihrer Materialstärke je nach Wassertemperatur. Um eine möglichst geringe Beeinträchtigung der Bewegungen beim Wellenreiten zu gewährleisten, findet sich hierzu sehr elastisches Neopren zu einem möglichst genau auf die Körperform angepassten Schnitt verarbeitet. Darüber hinaus bietet es dem Surfer Schutz vor Schnitt- und Schürfverletzungen an Finnen oder schroffem Meeresgrund. Aus Lycra hergestellte Unterziehleibchen verringern zum einen die Reibung eines Anzugs auf der Haut und beugen Wundscheuerung an stark beanspruchten Hautstellen im Bereich der Achseln und der unteren Rippenbögen vor und dienen zum anderen dem Surfer einzeln getragen als Sonnenschutz in heißen Umgebungen. Mit Ausnahme eines kurzen Zeitraums am Übergang der 70er zu den 80er Jahren, in denen ein Wetsuit [12] in zeitgemäß vielfältiger und greller Farbgebung bzw. ob seiner körperbetonten Passform in Persiflagen von Superhelden-Outfits designt wurde, zeichnet er sich, wie alle andere Kleidung aus Neopren auch, allgemein durch eine sehr ‚zurückgenommene’ und subtile Ästhetik aus, dessen dominierender Farbton schwarz zumeist nur um eine weitere gedeckte Farbe erweitert ist.[13]
Am Übergang zur Fashion-Kategorie ist die surf trunk - auch boardshort oder baggies (vgl. Warshaw 2005, 35) genannt - anzusiedeln.
„Surf-style clothing originally derived from certain functional requirements, for instance, ‚baggy’ knee-length shorts were developed to prevent the legs from chafing while sitting astride a surfboard.“ (Ford/Brown 2006, 67)
Nach der surfkalendarisch festgehaltenen ‚Erfindung’ der surf trunk durch Dale Velzy in den 40er Jahren wurden Surfhosen - mit der ‚Makaha Drowner trunk’ des hawaiianischen Unternehmens M. Nii’s - in den 50er Jahren erstmalig kommerziell vermarktet und in den folgenden zwei Dekaden von mehreren californischen Unternehmen bereits in den verschiedensten Ausführungen auch auf dem amerikanischen Markt vertrieben. Die Betonung ihrer Funktionalität wurde spätestens in den 70er Jahren mit der Einführung der boardshort des australischen Herstellers Quiksilver sukzessiv durch ihren ästhetischen Wert als Modegut überlagert. Zusammen mit funktionellen Innovationen in der Wahl des Stoffes und den Verschlüssen der Hose unterliegt ihre Gesamtentwicklung sowohl in ihrem jeweiligen Schnitt als auch in ihrer Farbgebung zu jeder Zeit sehr stark modischen Einflüssen und Zyklen und findet sich aktuell in verschiedenste Sport- und Freizeitkontexte eingewoben (vgl. Warshaw 2005, 592). In der Beobachtung dieser Entwicklung schreibt Surfjournalist Sam George der Boardshort eine betonte symbolische und surf-kulturelle Bedeutsamkeit zu und stellt sie überspitzt mehr als eine Philosophie, denn als ein Kleidungsstück dar, dessen Auswahl das ultimative Statement über eine spezifische Position in der Szene abgibt.[14]
Hinsichtlich dieser Funktion von Kleidung nimmt das Surfing T-Shirt eine noch exponiertere Stellung in der Surfszene ein. Als Werbegag im Jahr 1961 von verschiedenen führenden Kalifornischen Surfbrettmanufakturen lanciert, stellt es heute wie damals das am leichtesten erkennbare, etablierteste und populärste Modegut der Szene dar. Seine klassische Form, mit einem zumeist großen Aufdruck auf dem Rücken, in Form eines Firmenlogos oder einer Illustration und einem kleineren auf der linken Brust, hat es bis in die heutige Zeit beibehalten (vgl. Warshaw 2005, 611f). Slaps - oder auch Flip-Flops genannt - sind ein weiteres Element aktueller Alltagsmode, dessen Wurzeln auch in der Szene der Wellenreiter zu finden sind und ebenso wie das T-Shirt in den peripheren Praktiken der Bewegungskultur und dessen Image eingewoben seit den 60er Jahren ihren festen Platz haben (vgl. ebd., 545f).
Wie alle anderen Artefakte auch, werden die Kleidungsstücke zu einem Zeichen, einem Ausdrucksmittel und einer Darstellungsform sozialer Zuordnung und Abgrenzung und deuten auf das eigene „Herausgehobensein“ (Soeffner 1986, 318ff) aus der Gleichmäßigkeit und Alltäglichkeit in gleichem Maße hin wie auf das Zugeordnetsein zu einer Szenefraktion. Zeichencodes von Kleidung (und Ausrüstung) sind jedoch komplex und die distinktive Bedeutung eines Zeichens gewinnt dieses erst im Kontext anderer Zeichen und Symboliken, so dass das alleinige Tragen eines bestimmten Kleidungsstücks wenig aussagekräftig ist, wenn die stilistische Gesamtinszenierung des Akteurs nicht in sich stimmig erscheint (siehe Kap. 3.5).
3.4 Das stilistische Mosaik der Surfszene
Wirkt die Surfszene auf den außenstehenden Betrachter wie eine weitgehend homogene Einheit, so zeigt sie sich intern bzw. ihren Stilisten als weitgehend heterogen. Ein verkörperter, szenespezifischer Stil ist gleichsam die Grundlage für ein feingliedriges soziales Binnendifferenzial des Szenefeldes. Ebenso wie die vagen und verschwimmenden Außengrenzen der Wellenreitszene mittels des szeneeigenen Stils gezogen sind, zeigen sich feinere Fraktionierungen innerhalb der Szene ebenfalls auf Basis stilistischer Differenzen.
In Anlehnung an Robert Schmidt kann man das stilistische Binnendifferential des Szenefeldes als ein “relationales Raummodell denken, in dem sich die einzelnen Stilgruppen wechselseitig definieren, unterscheiden und sich ihre Position zuweisen“ (Schmidt 2002, 261f). In einer entwicklungsgeschichtlichen Betrachtung skizziert Booth für die Wellenreitszene eine Auswahl von sechs Stilistiken, die in ihrer aktuellen Sichtbarkeit zwar in weiten Teilen durch zeitgeistige Strömungen der Wellenreitszene re-interpretiert vorliegen, jedoch stets epochale Elemente in der historischen Entwicklung des Surfens zitieren.
„They are complex, both in their internal dynamics, roles, rules and symbolic meanings, and in the social and cultural interactions they initiate across society. [...] [They display] the ways that surfers have historically differentiated and separated themselves from ‚outsiders’ and the way they distribute prestige and honor within their social group.“ (Booth 2003, 316)
Booth unterscheidet hedonistische hawaiianische Beachboys, Mitglieder vereinsähnlich strukturierter Clubs australischer Rettungsschwimmer, sorgenfreie und spaßorientierte kalifornische Surfer, umstürzlerische spirituelle Soulsurfer, körper- und gesundheitsbewusste, professionelle Wettkampfsurfer sowie Anhänger einer aggressiv-nihilistischen Punkbewegung (vgl. ebd.). Analog zu sportiven Praktiken im Modell präsentatorisch-inszenatorischen Sports stehen die verschiedenen Stile im Feld der Surferkultur nach Ford/Brown in einem Zusammenhang mit feinen sozialen Unterschieden in der Gemeinschaft der Wellenreiter:
„The field of surfing therefore, is comprised of a number of sub-fields, all of which give values to the practiced, surfed body in subtly different ways and these manifest themselves through surfing styles. Moreover these sub ‚fields’ have distinct practices, institutions and practicioners with subtle, but important, distinctions in their habitus that command different degrees of capital conversion.“ (Ford/Brown 2006, 128)
Spannen Ford/Brown das Feld der Surfszene, entlang einer sehr direkten Integration der eigenlogischen und nur datums- und ortsbezogen gültigen Booth’schen Surfstilistiken, als Gefüge von Sub-Feldern auf, so werden diese in der vorliegenden Arbeit nicht weiter als Sub-Felder, sondern als stilistische Idealtypen des aktuellen Feldes verstanden, in dem sich die Aktiven nach heutiger (und je von ihrer eigenen Position im Feld abhängigen) Auffassung und Interpretation dieser historischen Figuren in Relation zu den verschiedenen Orten auf einer Art stilistischen Landkarte der Surfszene positionieren.[15]
Das von Ford/Brown beschriebene Verhältnis einer Position im sozialen Raum zu ihrer Position im relationalen Gefüge stilistischer Möglichkeiten des eigenlogischen Feldes ist dabei durch einen von Bourdieu so genannten „Übersetzungs- und Brechungseffekt“ (Bourdieu 1999, 349) gekennzeichnet, der aus einem eigenlogischen Modell für Erfolg und Ansehen im Feld resultiert, welches auch nur hier Gültigkeit besitzt. Je nach der Zusammensetzung seiner inkorporierten Dispositionen weist diese szeneeigene Ökonomie den stilistischen Aufführungen eines Akteurs symbolische Profite, in Form von Ansehen im Rahmen der Surferkultur zu. Diese eigenlogische „Hackordnung“ der Gemeinschaft wird im anschließenden Kapitel näher beleuchtet.
3.5 Stilaristokratie
Entlang individuell mehr oder weniger ausdifferenzierter surferischer Blicke und Kapitalakkumulationen verorten sich die Aufführungen nicht nur im stilistischen Binnendifferenzial der Szene, sondern auch auf einem bestimmten Level ihrer herrschenden Stil-Aristokratie(n).
In dieser Aristokratie sehen Gebauer et al. (2004) hohen, noblen Stil „als das Gekonnte, Beherrschte, Elegante, das durch Leichtigkeit und Lässigkeit gekennzeichnet ist in einem Gegensatz zum Schwerfälligen und Bemühten, [...] in der die Könner das, was andere mit Bedacht und nach Vorschrift ausführen, in einen leichtfüßigen Tanz“ (ebd., 130) verwandeln. Jeder so als „Muster und Variation“ (ebd., 126) in einer Szene auftretende Stil verkörpert sich als Idealtyp in einer vorbildlichen, authentischen Person, um die „herum sich die anderen Mitglieder in konzentrischen Kreisen einordnen, bis hin zu den Positionen an der Peripherie“ (ebd., 131). Die Stilisierung eines Akteurs erfüllt einen solchen Authentizitätsanspruch in dem Maße, wie ihre Bedeutungen auch im Alltag gelebt und auch dort über emblematische Zugehörigkeitsdarstellungen ausgedrückt werden (vgl. Schmidt 2002, 273). Darüber hinaus wird der Authentizitätsgrad einer praktischen Darbietung in seinen Augen danach gestaffelt, in wie weit das mehr oder weniger willentlich gestaltete Bricolage einer oberflächlichen Fassade szenischer Komponenten in einer Passung zu den mitgebrachten sowie szeneintern bereits umgearbeiteten habituellen Tiefenstrukturen (Dispositionen) des Akteurs steht[16] bzw. in den Worten Hahns ausgedrückt: „Der Stil des äußeren Auftretens und Handelns durch das inkommensurable ‚innere Sein’ gedeckt wird“ (Hahn 1986, 607).
„As with lifestyle shopping the consumption entailed in surfing is not so much that of objects, as of lifestyles.“(Ford/Brown 2006, 74)
Vor diesem Hintergrund kann sich eine überdimensionierte Betonung von szenetypischer Kleidung oder anderen Artefakten auch kontraproduktiv auf die Aneignung von Zugehörigkeit und vor allem Status in der Szene auswirken. Gegenüber unerfahrenen Akteuren, deren Bewegungsvirtuosität offensichtlich hinter der Qualität ihrer Ausrüstung zurückbleibt, wird mittels szeneeigener Ausdrücke wie beispielsweise ‚Poser’ oder Kook (vgl. Warshaw 2005, 328) deutlich gemacht, dass Engagement und praktisches Vermögen ausschlaggebender für die Anerkennung innerhalb der Szene sind, als eine oberflächlich zur Schau getragene Konsumpraxis. Eine authentische Gesamtwirkung der stilistischen Inszenierung beruht auf der Passung des Bricolage der bedeutsamen Artefakte und Symbole zur Art und Weise ihrer Aufführung durch den Szeneakteur, wobei die limitierende Größe einer authentischen Erscheinung auf der performativen und damit körperpraktischen Hervorbringungsqualität des Wellenreiters gründet, die im Verlauf der Surfkarriere erworben wurde.
3.6 Symbolische Machtkämpfe
Mit performativen Darbietungen auf der Folie eines derart aristokratisch stratifizierten Feldes stilistischer Möglichkeiten rangeln die Akteure in den szeneeigenen Machtstrukturen um Aneignung und Anerkennung symbolischer Profite in permanenten Akten symbolischer Legitimierung und Aufwertung der eigenen Stilposition gegenüber anderen Positionen bei gleichzeitiger Abwertung jener (vgl. Thornton 2005, 191). Das Feld der Szene ist damit zu jedem Zeitpunkt sowohl das Ergebnis von, als auch gleichsam die strukturelle Ausgangslage für „[...] struggle and competition for scarce resources and symbolic recognition related to the specific type of capital, that gouverns success in the field“ (Ritzer/Goodmann/Wiedenhoft 2001, 419). Die Beständigkeit der Feldökonomie des Wellenreitens stützt sich auf die stilisierenden Aufführungen kollektiv-körperlich eingelagerter romantischer Verklärungen[17] in den leidenschaftlichen, performativen Praktiken seiner Akteure (siehe Kap. 3.1) und „produziert als Profit für den, der die Euphemisierungs-, Verklärungs, Ausformungsakte vollzieht, ein Kapital an Anerkennung, das es ihm gestattet, symbolische Wirkung auszuüben“ (Bourdieu 1985, 173).
[...]
[1] „Stand-up surfing (as opposed to bellyboarding or kneeboarding) likely began around A.D. 1000 and was soon deeply integrated into Hawaiien culture, practiced by commoners and royalty, young and old, men, women and children“ (Warshaw 2005, XIIV).
[2] Bourdieu beschreibt das leidenschaftliche Verhältnis von Akteur und Feld mit dem Begriff der libido, unterscheidet sie dabei jedoch von der biologischen libido undifferenzierter Triebe als „sozial differenzierte und begründete Interessen die nur in Zusammenhang mit einem sozialen Raum existieren“ (Bourdieu 1985, 143).
[3] Bourdieu verweist auf eine körperlich verankerte Wissensform, die er der cogito als rationales Wissen hinzustellt: „Was der Leib gelernt hat, das besitzt man nicht wie ein wiederbetrachtbares Wissen, sondern das ist man“ (Bourdieu 1987, 135). Um keinen etablierten Entgegensetzungen von Geist und Körper, explizitem und implizitem, bewusstem und unbewusstem und letztendlich zwischen theoretischem und praktischem Wissen und Handeln das Wort zu reden, wird Wissen und Entscheidungsfindung der Anbieter hier im Anschluss an Brümmer als zwischen eben diesen dichotomen Begrifflichkeiten oszillierend aufgefasst und als je nach Handlungsanforderung und entsprechendem Könnensstand geformt verstanden (vgl. Brümmer 2009, 44f).
[4] Die Vorsilbe ‚sub’ entspringt Thorntons Arbeit in der britischen Subkulturforschung und betont den auf die Szene beschränkten Wertebereich dieses inkorporierten kulturellen Kapitals. Das inkorporierte kulturelle Kapital beschreibt das Produkt eines Verinnerlichungsprozesses von Kultur, das gegen die Aufwendung von Zeit akkumuliert wird und in körper- bzw. praxisgebundener Form vorliegt. Seine Weitergabe erfolgt ausschließlich auf dem Wege sozialer Vererbung und tradiert sich somit stets implizit und unsichtbar. Es umfasst Fertigkeiten und sozial angeeignete Lernvoraussetzungen wie Lesekompetenzen, Interesse für Mathematik, Kompetenzen, sich in öffentlichen Räumen zu bewegen, ein Musikinstrument spielen zu können oder sich beispielsweise mit Kunst auszukennen und im Bezug hierauf entsprechend artikulieren zu können (vgl. Bourdieu 1992, 55f).
[5] Surfer verorten sich auch über Musikkonsum in unterschiedlichen Unterräumen des Wellenreitens. Neben Musikrichtungen, die im Genre der Surfmusik (hierzu siehe auch das Kapitel „surf music“ in: Warshaw 2005, 585ff) zusammengefasst, lässt sich auch mittels der alltäglichen Vorliebe für bestimmte Musikrichtungen eine szeneräumliche Zuordnung des Rezipienten bestimmen. Anhand einer spezifischen Performance und Stimme, eines Sounds und Rhythmus konturiert sich nach Schmidt eine je eigene Körperästhetik des musikalischen Genres, das sich durch spezifische Ensembles von Körperbewegungen und körperlichen Ausdrucksformen kennzeichnet und in den eingekörperten Dispositionen des Habitus eines sozial entsprechend strukturierten Körpers einen Resonanzboden findet. Aufgrund dieser körperlichen Affinitäten ‚wählt’ ein Akteur einen entsprechenden Musikstil schon vorbewusst systematisch aus (vgl. Schmidt 2002, 110.). In dem Fall, in dem die Körperästhetik der Musik die Rhythmik der bevorzugten Surfpraktiken reproduziert, kann sie mittels ihrer Korrespondenz zum Surfstil auch fern des Wassers zum körperlich spürbaren Ausdruck des jeweiligen Surfstils werden und in dieser Weise der Anreicherung einer authentischen surferischen Stilisierung dienen. Die stimmige Koinzidenz von Musik und Bewegungspraxis findet sich vor allem in Surfvideos und anderen multimedialen Aufgriffen des Surfens genutzt und reproduziert.
[6] Hierzu siehe auch das Kapitel „surf slang“ in: (Warshaw 2005, 590).
[7] Anmerkung des Autors: Ich möchte mit diesem Begriff surferische Identität in Anlehnung an Judith Butlers Konstruktion von Geschlechtlichkeit als eine durch performative Akte konstituierte verstehen. Die scheinbare 'Ursache' der Surferidentität und der Körper als Oberfläche kultureller Einschreibungen, ist der performative Effekt einer diskursiven Praxis. Performativität wird nicht als die Möglichkeit eines intentionalen Subjekts verstanden, mit sprachlichen und körperlichen Äußerungen Handlungen zu vollziehen, sondern ein Surfer ist performativ in dem Sinne, dass er gerade das Subjekt, das er auszudrücken scheint, als seinen Effekt konstituiert. Es gibt keinen Surfer ‚hinter’ den Äußerungen und Ausdrucksformen von Surfidentität und -stil; Identität wird durch eben diese Äußerungen performativ hervorgebracht (vgl. Butler 1995).
[8] Zum Begriff Malibu siehe auch die Kapitel „Malibu“, „Malibu board“ in: (Warshaw 2005, 360).
[9] Zum Begriff Shortboard siehe auch die Kapitel „Shortboard revolution“ und „Shortboard, shortboarding“ in: (Warshaw 2005, 538).
[10] Zum Begriff Aerial siehe auch die Kapitel „Aerial“ in: (Warshaw 2005, 5).
[11] Zur geschichtlichen Entwicklung des Surfboards siehe auch (Ford/Brown 2006, 28f).
[12] Zur Entwicklung des Wetsuits oder auch Neoprenanzugs siehe auch die Kapitel „wetsuit“ und „O’Neill wetsuits“ in (Warshaw 2005, 425f).
[13] Dies dient vermutlich zur optimalen Wärmeausbeutung der Sonnenenergie.
[14] Sam George formuliert die Signifikanz der Wahl der Surfshort anhand einer Metapher: „the ultimate statement on who’s shooting the curl and who’s shooting the shit“ (George, zitiert in (Warshaw 2005, 592). „Shooting the curl“ meint hierbei das Ergattern und Surfen einer qualitativ hochwertigen Welle und damit eine sehr prestigeträchtige Praktik, die er dem „shooting the shit“, dem Bekommen und Surfen einer kraftlosen und kurzen Welle gegenüberstellt, da dies nicht für hohes Ansehen in der Szene bürgt. Hiernach drückt sich in der individuellen Wahl der Boardshort in den Augen von George auch sozialer Status in der Szene aus.
[15] Die metaphorische Verwendung von Orten und Landkarte soll in diesem Zusammenhang den konstruierten Charakter des entwickelten, heuristischen Modells eines Stilfeldes der Szene betonen, das zwar auf einem theoretisch angebundenen, aber sehr fragilen empirischen Fundament aufgebaut wurde.
[16] Schmidt (vgl. 2002, 285) verweist in diesem Zusammenhang auf Goffmanns ‚dramatologische’ Analysen körperlicher Ausdrucksformen und -strategien, gemäß derer die Akteure verschiedene szenische Komponenten der persönlichen Fassade (Kleidung, Haltung, Sprechweise, Gestik, Amtsabzeichen etc.) im Rahmen ihrer Aufführungen zur strategischen Manipulationen des Umfelds anwenden (vgl. Goffman 2004, 25).
[17] Hierzu Bourdieu: „Mit den unzähligen Akten des Anerkennens, diesem Eintrittsgeld, ohne das man nicht dazugehört, die ständig kollektive falsche Erkenntnis erzeugen, ohne die das Feld nicht funktioniert [...], investiert man gleichzeitig in das kollektive Unternehmen der Bildung symbolischen Kapitals, das nur gelingen kann, wenn unerkannt bleibt, wie die Logik des Feldes überhaupt funktioniert“ (Bourdieu 1987, 125).
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Erstausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2012
- ISBN (Paperback)
- 9783863414160
- ISBN (PDF)
- 9783863419165
- Dateigröße
- 413 KB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Carl von Ossietzky Universität Oldenburg
- Erscheinungsdatum
- 2015 (Februar)
- Note
- 1
- Schlagworte
- Surfen Szene Performanz Körper Surfer Wellenreiten
- Produktsicherheit
- BACHELOR + MASTER Publishing