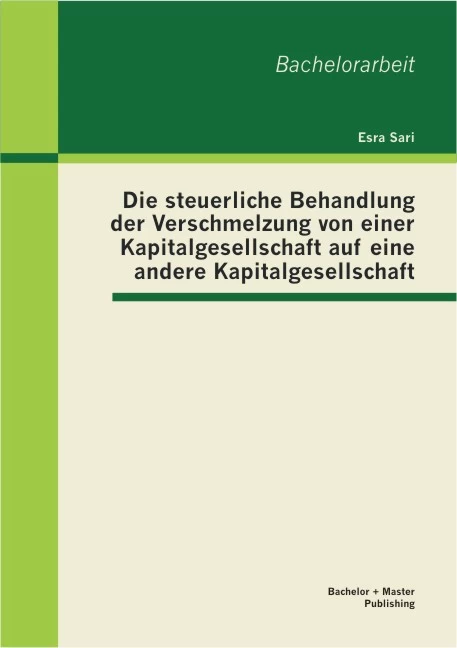Die steuerliche Behandlung der Verschmelzung von einer Kapitalgesellschaft auf eine andere Kapitalgesellschaft
Zusammenfassung
In diesem Buch werden die umwandlungsrechtlichen und ertragssteuerlichen Aspekte der Verschmelzung von Kapitalgesellschaften untereinander erläutert. Dabei werden zunächst die umwandlungsrechtlichen Aspekte verdeutlicht, um auch die steuerlichen Regelungen verstehen zu können. In Anschluss daran werden die steuerlichen Regelungen des Umwandlunsteuergesetzes sowie die des Umwandlungsteuererlasses erklärt.
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
2.2 Grenzüberschreitende Verschmelzungen
Im Hinblick auf die grenzüberschreitende Verschmelzung hat sich in den vergangenen Jahren vieles geändert. Die Vorschrift des § 1 Abs. 1 UmwG regelt allerdings nur Rechtsträger mit Sitz im Inland. Der EuGH entschied hingegen in seinem Urteil zur Sevic AG vom 13.12.2005[1], dass es mit der Niederlassungsfreiheit Art. 43 und 48 EGV unvereinbar sei, dass die Zulässigkeit einer grenzüberschreitenden Verschmelzung verweigert wird. In diesem Zusammenhang wurde durch das zweite Gesetz zur Änderung des UmwG ein zehnter Abschnitt im zweiten Teil des zweiten Buchs (§§ 122a bis 122l UmwG) eingefügt. Hierdurch wurde die grenzüberschreitende Verschmelzung von Kapitalgesellschaften aus verschiedenen Mitgliedsstaaten der EU oder des EWR ermöglicht.[2]
Im Übrigen lassen sich in der Praxis folgende Fällen der grenzüberschreitenden Verschmelzungen in folgende Gruppen einteilen:
- Inlandsverschmelzungen mit Auslandsbezug
Die beteiligten Rechtsträger sind im Inland ansässig, aber die Gesellschafter und/oder das Vermögen befinden sich im Ausland
- Hinausverschmelzung
Die übertragende Gesellschaft hat Sitz im Inland, aber die Übernehmerin ist im Ausland ansässig, Gesellschafter und/oder befinden sich im In- oder Ausland
- Hineinverschmelzung
Die übernehmende Gesellschaft hat ihren Sitz im Inland, aber die übertragende Gesellschaft ist im Ausland ansässig; Gesellschafter und/oder betroffenes Vermögen befinden sich im In- oder Ausland
- Auslandsverschmelzung mit Inlandsbezug
Beide Rechtsträger sind im Ausland ansässig und mindestens ein Teil der Gesellschafter ist im Inland ansässig oder inländisches Vermögen wird übertragen
2.3 Ablauf der Verschmelzung
2.3.1 Vorbereitungsphase
2.3.2 Verschmelzungsvertrag
Der Verschmelzungsvertrag bildet die Grundlage für eine Vermögensübertragung und ist ein Teil des Organisationsaktes, der die Umstrukturierung bzw. die Neuordnung der Beteiligungsverhältnisse der Verschmelzung festlegt[3]. Der Gesetzgeber verlangt in allen Verschmelzungsfällen den Abschluss eines Verschmelzungsvertrages. Der Vertrag bestimmt im Kern die Vermögensübertragung des übertragenden Rechtsträgers gegen Gewährung von Anteilen oder Mitgliedschaften der Übernehmerin ohne Liquidation der Überträgerin.[4]
Nach § 4 Abs. 1 UmwG sind die Vertretungsorgane der beteiligten Rechtsträger zum Abschluss des Verschmelzungsvertrages zuständig. Der Mindestinhalt des Verschmelzungsvertrages ist in § 5 Abs. 1 UmwG geregelt und muss in jedem Verschmelzungsvertrag bzw. Entwurf enthalten sein.[5] Neben den Mindestabgaben sind bei einzelnen Rechtsformen zusätzliche Angaben zwingend erforderlich. Für die AG und KGaA ist § 35 UmwG und für GmbH sind die §§ 46, 56, 57 UmwG zu beachten. Nach § 6 UmwG muss der Vertrag oder sein Entwurf notariell beurkundet werden und muss spätestens einen Monat nach der Gesellschafterversammlung dem Betriebsrat zugeleitet werden (§ 5 Abs. 3 UmwG).
Der wichtigste Punkt der Mindestangaben im Verschmelzungsvertrag ist das Umtauschverhältnis.[6] Das Umtauschverhältnis gibt an, wie viele Anteile der Übernehmerin an die Anteilseigner der übertragenden Gesellschaft übergehen. Damit die Anteilseigner der Überträgerin nicht schlechter stehen als vorher, sollte das Ziel sein, dass die neuen Anteile den untergehenden Anteilen wertmäßig entsprechen.[7] Daher muss nach § 8 UmwG das Umtauschverhältnis im Verschmelzungsbericht ausführlich erläutert und begründet werden. Dieser muss nach § 12 Abs. 2 Satz 1 UmwG auf seine Angemessenheit geprüft werden. Um die richtige Wertrelation der Unternehmenswerte festzustellen, ist zunächst bei den beteiligten Rechtsträgern eine Unternehmensbewertung durchzuführen, aus der sich dann schließlich das Umtauschverhältnis ergibt.[8]
2.3.2.1 Umtauschverhältnis
Das Umtauschverhältnis ist der Kernpunkt der Verschmelzung und spielt für die Gesellschafter der beteiligten Rechtsträger eine wichtige Rolle, da es bei der übernehmenden Gesellschaft ihre „neuen“ Anteile wiederspiegelt. Das Umtauschverhältnis ist bezogen auf den Nennbetrag der Anteile, und ist in einem zahlenmäßigen Verhältnis (z. B. 2:3 oder 1:2) auszudrücken.[9] Dieser muss nach § 12 Abs. 2 UmwG angemessen sein und soll für keinen Anteilseigner Vor- oder Nachteile in Bezug auf die Anteile darstellen.[10] Der Grundsatz der Gleichbehandlung zwischen den Gesellschaftern soll gewahrt werden.[11] Erreicht der Wert der erhaltenen Anteile nicht den hingegebenen Anteilen, können die Gesellschafter der übertragenden Kapitalgesellschaft gem. § 15 UmwG Ausgleich durch bare Zuzahlung verlangen.[12] Die bare Zuzahlung ist gem. § 54 Abs. 4 und § 68 Abs. 3 UmwG auf 10% des Gesamtnennbetrags aller von der übernehmenden Gesellschaft an die Anteilseigner der übertragenden Gesellschaft gewährten Anteile begrenzt. Diese Beschränkung gilt nur barer Zuzahlungen, die bereits im Verschmelzungsvertrag festgesetzt worden sind und nicht für Erhöhungen oder Neufestzungen durch das Gericht im Spruchverfahren nach § 15 UmwG.[13]
Ziel dieser Beschränkung ist, dass die Verschmelzung nicht zu einem Auskauf der Anteileigner des übertragenden Rechtsträgers führt und der Erhalt der Kapitalgrundlagen und die Liquidität des übernehmenden Rechtsträgers sichergestellt ist.[14]
Wird die 10% Beschränkung nicht eingehalten, so liegt darin ein Verstoß gegen § 54 Abs. 4 UmwG vor und führt somit zur Nichtigkeit des Verschmelzungsvertrages. In diesem Fall darf keine Eintragung erfolgen, aber mit der Eintragung ist der Mangel geheilt (§ 20 Abs. 2 UmwG).[15]
2.3.2.2 Kapitalerhöhungen
Sind nicht genügend Anteile vorhanden, um die Gesellschafter der übertragenden Gesellschaft abzufinden, müssen die Anteile mit einer Kapitalerhöhung vor der Verschmelzung geschaffen werden.[16] Die verschmelzungsbedingte Kapitalerhöhung bei einer GmbH sind in den §§ 53-55 UmwG und für Aktiengesellschaften in den §§ 66-69 UmwG geregelt. Bei der verschmelzungsbedingten Kapitalerhöhung handelt es sich stets um eine Sachkapitalerhöhung.[17] Die Berechnung der Kapitalerhöhung wird nach der allgemeinen Formel ermittelt, welches dem Verhältnis der Kapitalerhöhung zum Stammkapital nach der Verschmelzung entsprechen muss.[18] Folgendes Beispiel zeigt, wie sich die Kapitalerhöhung bei Gesellschaften mit beschränkter Haftung ermittelt:
Beispiel:[19]
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Früher musste der Mindestnennbetrag der Kapitalerhöhung im Zuge der Verschmelzung mindestens fünfzig Euro betragen. Dies wurde jedoch mit Inkrafttreten von MoMiG abgeschafft.[20] Damit die Durchführung der verschmelzungsbedingten Kapitalerhöhung nicht zur Nichtigkeit der Kapitalerhöhung führt, muss zur Anmeldung der Kapitalerhöhung beglaubigte Abschriften des Verschmelzungsvertrages sowie die Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Gesellschaften eingereicht werden.[21]
Zu einer Kapitalerhöhung bedarf es nicht, wenn der übernehmende Rechtsträger eigene Anteile inne hat (Kapitalerhöhungswahlrecht gem. § 54 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 UmwG bzw. § 68 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 UmwG).
Ein Kapitalerhöhungswahlrecht ist gem. § 54 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 bzw. § 68 Abs. 1
Satz 2 Nr. 1 UmwG auch dann gegeben, wenn die übertragende Kapitalgesellschaft voll einbezahlte Anteile an der Übernehmerin hält. Dies ist insbesondere dann gegeben, wenn einer Muttergesellschaft auf ihre Tochtergesellschaft verschmolzen wird (Downstream Merger).[22] Hierbei gehen die vor der Verschmelzung von der Muttergesellschaft gehaltenen Anteile an der Tochtergesellschaft auf die Anteileigner der Muttergesellschaft ohne Durchgangserwerb über.[23] Durch die Neuregelung besteht ein Kapitalerhöhungswahlrecht auch dann, wenn Schwestergesellschaften miteinander verschmolzen werden (§§ 54 bzw. 68 Abs. 1 Satz 3 UmwG).[24]
Die Normen der §§ 54 und 68 UmwG schließen die Möglichkeit einer Kapitalerhöhung insoweit aus, als die Übertragung des Vermögens auf die aufnehmende Gesellschaft zu keiner realen Einlage bei dieser führt.[25] Sinn des § 54 Abs. 1 UmwG bzw. § 68 Abs.1 UmwG ist durch das Kapitalerhöhungsverbot das Entstehen von eigenen Anteilen der aufnehmenden Gesellschaft zu verhindern bzw. mit dem Wahlrecht zur Kapitalerhöhung eigene Anteile abzubauen (Satz 2).[26] Die Regelung steht in unmittelbarem Zusammenhang mit § 20 Abs. 1 Nr.3 UmwG.
Nach §§ 54 bzw. 68 Abs. 1 Satz 1 Nr.1 UmwG besteht ein Kapitalerhöhungsverbot, wenn die übernehmende Gesellschaft Anteile des übertragenden Rechtsträgers innehat. Dies ist häufig in den Fällen von Konzernverschmelzungen gegeben. Denn bei einer 100%igen Beteiligung muss weder eine Kapitalerhöhung noch eine Anteilsgewährung erfolgen, da bei einer Verschmelzung der Tochtergesellschaft auf die Muttergesellschaft, die Muttergesellschaft 100% der Anteile besitzt (Upstream Merger).[27]
Unzulässig ist die Kapitalerhöhung auch dann, wenn die übertragende Gesellschaft eigene Anteile hält (Nr.2). Das Kapitalerhöhungsverbot gilt unabhängig davon, ob die die gehaltenen eigenen Anteile geleistet worden sind oder nicht.
Hält der übertragende Rechtsträger nicht voll eingebezahlter Anteile, darf auch dann keine Kapitalerhöhung stattfinden. In einem solchen Fall würde die übernehmende Gesellschaft infolge der Verschmelzung nicht voll eingezahlte eigene Anteile erwerben und würde gegen den § 33 Abs. 1 GmbHG verstoßen.[28]
2.3.3 Verschmelzungsbericht
Nach § 8 Abs. 1 UmwG haben die Vertretungsorgane der übernehmenden und übertragenden Rechtsträger einen ausführlichen schriftlichen Bericht über die rechtlichen und wirtschaftlichen Gründe für die Verschmelzung zu erstellen. Ein wichtiger Bestandteil ist die Erläuterung des Umtauschverhältnisses der Anteile bei dem übernehmenden Rechtsträger, sowie die Höhe der ggf. anzubietenden Barabfindung.[29] Der Verschmelzungsbericht soll dem Anteilseigner eine umfassende Information beschaffen und muss alle Angaben enthalten, damit die beteiligten Anteilseigner die zu erwartenden Vorteile und die möglicherweise bestehenden Risiken der Verschmelzung erkennen können. Ein Verschmelzungsbericht ist nach § 8 Abs. 3 UmwG nicht erforderlich, wenn alle beteiligten Anteilseigner darauf verzichten oder alle Anteile des übertragenden Rechtsträgers in der Hand des übernehmenden Rechtsträgers befinden. Die Verzichtserklärungen sind nach § 8 Abs. 3 Satz 2 UmwG notariell zu beurkunden.
2.3.4 Verschmelzungsprüfung
Die Prüfung des Verschmelzungsvertrages oder seines Entwurfs ist gem. § 9 ff. i. V. m. § 60 UmwG bei Aktiengesellschaften durchzuführen. Nach § 122f UmwG besteht auch bei grenzüberschreitenden Verschmelzungen die Pflicht zur Prüfung. Bei Gesellschaften mit beschränkter Haftung ist der Verschmelzungsvertrag oder sein Entwurf auf Verlangen eines Gesellschafters zu prüfen (§ 48 Satz 1 UmwG). Das Verlangen auf Prüfung kann nur innerhalb einer Woche vor der Gesellschafterversammlung gestellt werden.[30] Die Verschmelzungsprüfung wird durch einen auf Antrag vom Gericht auserwählten und bestellten Prüfer durchgeführt (§ 10 Abs. 1 S. 1 UmwG).
2.4 Beschlussphase
Der Verschmelzungsvertrag wird nur wirksam, wenn alle Anteilseigner der beteiligten Rechtsträger in einer Versammlung zustimmen (§ 13 Abs. 1 UmwG). Nach § 13 Abs. 3 UmwG muss der Beschluss und die einzelnen Zustimmungserklärungen der Anteilseiner sowie der nicht erschienen Anteilseigner notariell beurkundet werden. Für den Verschmelzungsbeschluss ist i. d. R. nach §§ 50 Abs. 1 Satz 1. 65 Abs. 1 Satz 1 UmwG eine Mehrheit von mindestens 75 % der abgegebenen Stimmen erforderlich.
2.5 Vollzugsphase
Die Vertretungsorgane der beteiligten Rechtsträger haben die Verschmelzung zur Eintragung in die jeweils zuständigen Gerichte anzumelden (§§ 16 Abs. 1, 38 UmwG). Zur Anmeldung sind verschiedene Anlagen beizufügen. Nach § 17 Abs. 1 UmwG ist der Anmeldung zum Register der Verschmelzungsvertrag, die Niederschriften der Verschmelzungsbeschlüsse, die ggf. notwendigen Zustimmungserklärungen, der Verschmelzungsbericht und Prüfungsbericht beizufügen.[31] Des Weiteren ist die Schlussbilanz jedes übertragenden Rechtsträgers zur Anmeldung
beizufügen (§17 Abs. 2 UmwG). Nach § 17 Abs. 2 S. 2 UmwG gelten die Vorschriften für die Schlussbilanz über die Jahresbilanz (Bilanz nach HGB) und deren Prüfung entsprechend.[32]
3. Handelsbilanzen bei der Verschmelzung
Im Rahmen der Verschmelzung ist sowohl eine handelsrechtliche als auch eine steuerliche Schlussbilanz auf den maßgeblichen Stichtag aufzustellen. In diesem Kapitel werden die handelsrechtlichen Bilanzierungsgrundsätze für die an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger erläutert.
3.1 Bilanzierung bei dem übertragenden Rechtsträger
Nach § 17 Abs. 2 UmwG hat der übertragende Rechtsträger eine Schlussbilanz zur Anmeldung beim Handelsregister beizufügen. Der Stichtag der Schlussbilanz darf höchstens acht Monate vor der Anmeldung ins Handelsregister liegen (§ 17 Abs. 2 Satz 4 UmwG). Wurde die Achtmonatsfrist nicht gewahrt, so ist eine besondere Bilanz aufzustellen, die innerhalb der Acht-Monate-Regelung liegt. Die Aufstellung einer besonderen Schlussbilanz begründet kein Rumpfwirtschaftsjahr.[33] Die Schlussbilanz ist gem. § 17 Abs.2 Satz 2 UmwG nach den Vorschriften der Jahresbilanz aufzustellen. Demnach ist die Schlussbilanz nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB aufzustellen.[34] Zusätzlich sind noch die Vorschriften für Aktiengesellschaften nach §§ 150 ff. AktG und für Gesellschaften mit beschränkter Haftung nach § 42 GmbHG zu beachten. Nach dem Gesetzeswortlaut des § 17 Abs. 2 Satz 2 UmwG reicht die Aufstellung einer Bilanz aus. Daher muss weder eine Gewinn- und Verlustrechnung noch ein Anhang der Verschmelzung zur Anmeldung zum Handelsregister eingereicht werden.
Da die handelsbilanziellen Rechnungslegungsvorschriften für die Schlussbilanz entsprechend gelten, hat der übertragende Rechtsträger in seiner Schlussbilanz sämtliche handelsrechtlichen Ansatzgebote, Ansatzverbote und Ansatzwahlrechte für die Handelsbilanz zu beachten.
Da gem. § 17 Abs. 2 Satz 2 UmwG die Vorschriften über den handelsrechtlichen Jahresabschluss entsprechende Anwendung finden, so gelten auch die Vorschriften der Jahresabschlussprüfung für große und mittelgroße Kapitalgesellschaften i. S. d. § 316 Abs.1 Satz 1 HGB entsprechend.
3.2 Bilanzierung beim übernehmenden Rechtsträger
Der übernehmende Rechtsträger muss keine spezielle Übernahmebilanz für das übernommene Vermögen erstellen. Der Vermögensübergang infolge der Verschmelzung durch Aufnahme wird beim Übernehmer wie ein laufender Geschäftsvorfall behandelt.[35] Anders ist es bei der Verschmelzung durch Neugründung zu behandeln. Nach § 242 Abs. 1 HGB hat die neu zu entstehende Gesellschaft eine Eröffnungsbilanz auf den Verschmelzungsstichtag aufzustellen.[36] Die Werte aus der Schlussbilanz des Überträgers sind bei der Eröffnungsbilanz der übernehmenden neu gegründeten Gesellschaft unverändert zu übernehmen.[37]
Da aus der früheren Gesetzgebung in vielen Fällen durch die Pflicht der Buchwertverknüpfung Verschmelzungsverluste beim Übernehmer entstanden sind und diese zur handelsrechtlichen Ausschüttungssperre geführt haben bzw. zu einem schlechteren Eigenkapitalausweis[38], hat der Gesetzgeber die Ausübung eines Wahlrechts zwischen Buchwertansatz und Neubewertung eingeräumt (§ 24 UmwG). Demnach kann die übernehmende Gesellschaft die übertragenen Vermögensgegenstände und Schulden mit den tatsächlichen Anschaffungskosten i. S. d. § 255 Abs. 1 HGB bewerten oder die Buchwerte, die in der Schlussbilanz bei der übertragenden Gesellschaft ausgewiesen wurden, fortführen.[39]
Die Ausübung des Wahlrechts gemäß § 24 UmwG ist einheitlich zu erfolgen.[40]
Entscheidet sich die übernehmende Gesellschaft für die Neubewertung, so sind die Anschaffungskosten für die Gesamtrechtsnachfolge zu ermitteln. Für die Ermittlung der Anschaffungskosten gelten die allgemeinen Grundsätze. Diese sind nach § 255 Abs. 1 Satz 1 HGB alle geleisteten Aufwendungen für den Erwerb eines Vermögensgegenstands.[41] Die wesentlichen Grundfälle der Anschaffungskosten bei der Verschmelzung werden je nach Art der Gegenleistung bestimmt.
Als Gegenleistung können sein:[42]
- Gewährung neuer Anteile im Zuge der Verschmelzung
- Ausgabe eigener Anteile
- Bare Zuzahlungen
- Abfindung von Gesellschaftern des übertragenden Rechtsträgers
- Fortfall einer beim übernehmenden Rechtsträger bestehenden Beteiligung am übertragenden Rechtsträger („upstream-merger“)
- Downstream Merger
In der Regel erfolgt das Anschaffungskostenprinzip erfolgsneutral, da die Anschaffungskosten mit dem Wert der Gegenleistung identisch sind. Gewinne oder Verluste können bei dem Ansatz zu Anschaffungskosten dadurch entstehen, wenn der Wert der eingebuchten Vermögensgegenstände den Wert der ausgebuchten Aktiva, im Falle der ausgegebenen Anteile, und der eingebuchten Passiva, im Falle der übernommenen Verbindlichkeiten, neues Eigenkapital, abweicht.[43] Bestehen Forderungen und Verbindlichkeiten der bei der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger untereinander, so dürfen diese im Jahresabschluss nicht ausgewiesen werden und werden erfolgsneutral ausgebucht.[44] Dies gilt entsprechend für Rückstellungen für ungewisse Verpflichtungen untereinander. Es können sich infolge der Konfusion Erfolgsauswirkungen ergeben, wenn die Verbindlichkeit die aktivierte Forderung gemäß § 253 Abs. 3, 4 HGB überschreitet oder eine Rückstellung aufzulösen ist.
Bei der Buchwertverknüpfung hat der übernehmende Rechtsträger, die in der Schlussbilanz vorhandenen Werte des Überträgers, in seine Bilanz zu integrieren. Der Verschmelzungsgewinn bzw. Verschmelzungsverlust bei der Buchwertverknüpfung ist die Differenz zwischen dem übergegangenem Vermögen und dem Nennwert der ausgegebenen Anteile bzw. den Buchwert der untergehenden Beteiligung.[45] In den häufigsten Fällen ist dieser Betrag negativ.
4. Das Umwandlungssteuergesetz
4.1 Aufbau des Umwandlungssteuergesetzes
Obwohl das UmwStG auf die gesellschaftrechtlichen Regelungen des UmwG verweist, ist der Aufbau jedoch nicht mit dem UmwG identisch. Die Gliederung des UmwStG ist systematisch an die Rechtsform des umzuwandelnden Rechtsträgers bzw. der Zielgesellschaft angelehnt. Die Systematik des UmwStG ist auf die steuerliche Beurteilung der juristischen und natürlichen Person bzw. Personengesellschaft gerichtet. Die Allgemeinen Vorschriften sind im ersten Teil (§§ 1, 2 UmwStG), die Verschmelzung von einer Körperschaft auf eine natürliche Person bzw. Personengesellschaft im zweiten Teil
(§§ 3-10 UmwStG) und im dritten Teil ist die Verschmelzung von Körperschaften untereinander (§§ 11-13 UmwStG) geregelt. Da die Verschmelzung von Personengesellschaften untereinander und die Verschmelzung einer Personengesellschaft auf eine Kapitalgesellschaft eine Einbringung darstellt, sind diese im sechsten und siebten Teil des UmwStG geregelt (§§ 20 ff.). Im dritten Teil ist weiterhin der Formwechsel von einer Körperschaft in eine Personengesellschaft (§§ 3 ff. i. V. m. § 9 UmwStG) geregelt. Der umgekehrte Fall ist im achten Teil des UmwStG bestimmt (§ 25 UmwStG). Die gewerbesteuerlichen Aspekte in Bezug auf die vorgenannten Umwandlungen sind im fünften Teil (§§ 18, 19 UmwStG) des UmwStG zu finden.
Das UmwStG stellt keine eigenständige Steuerart dar. Sie erfasst Regelungen über die Ertragsteuern (Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer). Auch die übrigen Steuerarten (Umsatzsteuer und Grunderwerbsteuer) können bei Umwandlungen Auswirkungen haben; hier gelten jedoch die allgemeinen Vorschriften für die jeweiligen Steuerarten geltenden Bestimmungen.[46]
4.2 Entwicklungen des UmwStG und wichtige Änderungen durch das SEStEG
In der Vergangenheit wurde das Umwandlungssteuergesetz 1995 vom 28.10.2004[47] mehrfach geändert.
Folgende Gesetze haben zu wichtigen Änderungen geführt:[48]
- das Gesetz zur Fortsetzung der Unternehmenssteuerreform vom 29.10.1997[49]
- das Steuerentlastungsgesetz 1999/2000/2002 vom 24.03.1999[50]
- das Steuerbereinigungsgesetz 1999 vom 22.12.1999[51]
- das Steuersenkungsgesetz vom 23.12.2000[52]
- das Unternehmenssteuerfortentwicklungsgesetz vom 20.12.2001[53]
- das Steuervergünstigungsabbaugesetz vom 16.05.2003[54]
Das Umwandlungssteuerrecht wurde zuletzt durch das Gesetz über steuerliche Begleitmaßnahmen zur Einführung der Europäischen Gesellschaft und zur Änderung weiterer steuerrechtlicher Vorschriften (SEStEG) vom 07.12.2006[55] geändert. Das SEStEG setzte die EU-Fusionsrichtlinie[56] in nationales Recht um. Durch die Internationalisierung des „neuen“ UmwStG sind erhebliche Änderungen im UmwStG verbunden, die auch in Zusammenhang mit der Verschmelzung eine wichtige Rolle spielen. Im Folgenden werden die wichtigen Änderungen in Zusammenhang mit der Verschmelzung aufgeführt und im Verlauf der Arbeit näher erläutert.
- Europäisierung des Umwandlungssteuerrechts
- Keine Maßgeblichkeit der Handelsbilanz für die Steuerbilanz
- Kein Bewertungswahlrecht des übertragenden Rechtsträger, sondern Grundsatz der Bewertung zum gemeinen Wert oder zum antragsgebundenen Buch- oder Zwischenwertansatz
- Konfusionsgewinne infolge abgeschriebener Gesellschafterdarlehen führen zur vollen Steuerpflicht
- Abzugsbeschränkung für Verschmelzungskosten
- Rückgängigmachung von steuerlich erfolgswirksam genutzten Teilwertabschreibungen oder Abzügen
- Wegfall des Übergangs von steuerlichen Verlustabzügen auf die übernehmende Kapitalgesellschaft
- Aufgabe der Stufentheorie durch den Umwandlungssteuerlass
4.3 Anwendung des UmwStG auf Verschmelzungsvorgänge zwischen Kapitalgesellschaften
4.3.1 Sachlicher Anwendungsbereich
Seit Inkrafttreten des SEStEG´ s wurde der Anwendungsbereich der steuerlichen Vorschriften zur Verschmelzung erheblich erweitert. Die alte Fassung des UmwStG erfasste nur inländische Verschmelzungsvorgänge. Aufgrund der EuGH-Rechtsprechung[57] und der Umsetzung der Verschmelzungsrichtline wurde der Anwendungsbereich der §§ 11 bis 13 UmwStG auf EU/EWR – Kapitalgesellschaften erweitert.[58] §§ 11 bis 13 UmwStG regeln somit die ertragsteuerlichen Folgen nicht nur für inländische Verschmelzungsvorgänge, sondern auch die grenzüberschreitende Hinaus- oder Hereinverschmelzungen von Kapitalgesellschaften innerhalb der EU/EWR.[59]
§ 1 Abs. 1 UmwStG bestimmt den sachlichen Anwendungsbereich des UmwStG und knüpft in § 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UmwStG an die gesellschaftsrechtlichen Vorgaben des Umwandlungsrechts an.[60] Nach § 1 Abs. 1 UmwStG sind die §§ 11-13 UmwStG auf inländische Verschmelzungen von Kapitalgesellschaften, ausländischer EU-/EWR-Kapitalgesellschaften mit Inlandsbezug, grenzüberschreitender Verschmelzungen unter Beteiligung inländischer Kapitalgesellschaften in Form von Hinaus- und Hereinverschmelzungen, ausländischer EU-/EWR-Kapitalgesellschaften mit Inlandsbezug sowie grenzüberschreitende Verschmelzungen unter Beteiligung von SE/SCE anzuwenden.
4.3.2 Persönlicher Anwendungsbereich
Nach § 1 Abs. 2 Nr. 1 UmwStG findet das UmwStG nur Anwendung, wenn der übertragende und der übernehmende Rechtsträger nach Art. 48 EG bzw. EWR-Abkommen gegründete Gesellschaften sind und in der EU bzw. im EWR ansässig sind (doppeltes Ansässigkeitserfordernis[61] ). Die beteiligten Rechtsträger müssen zudem nach § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 UmwStG ihren Sitz und Ort der Geschäftsleitung im Hoheitsgebiet eines EU- bzw. EWR-Staats haben.
Des Weiteren kommt es auf den Rechtstypus der beteiligten Rechtsträger (Typenvergleich) an. Dies bedeutet, dass es sich bei einem Umwandlungsvorgang nach ausländischem Recht um einen gesellschaftrechtlichen Umwandlungsvorgang handeln muss, der seinem Wesen nach einer der Umwandlungsarten des deutschen UmwG (hier Verschmelzung) entspricht.[62]
Die steuerlichen Auswirkungen für Verschmelzungsvorgänge zwischen Kapitalgesellschaften sind im dritten Teil des UmwStG (§§ 11-13) bestimmt. Die Regelungen des § 11 UmwStG betreffen die steuerlichen Wertansätze in der Schlussbilanz der übertragenden Kapitalgesellschaft. § 12 UmwStG regelt die Übertragungsfolgen bei der übernehmenden Kapitalgesellschaft[63] und § 13 UmwStG enthält Regelungen für die Gesellschafter, die an der Überträgerin beteiligt sind, soweit nicht die übernehmende selbst an der übertragenden Kapitalgesellschaft beteiligt ist.
4.3.3. Zeitlicher Anwendungsbereich
Das Umwandlungssteuergesetz i. d. F. des SEStEG ist nach § 27 Abs. 1 UmwStG erstmals auf Umwandlungen bzw. Verschmelzungen anzuwenden, bei denen die Anmeldung zur Eintragung in das Handelsregister nach dem 12.12.2006 erfolgt ist.
4.4 Handelsrechtlicher Verschmelzungsstichtag
Die dinglichen Wirkungen einer Umwandlung treten mit ihrer Eintragung ins Handelsregister ein. Die Verschmelzung wird erst mit der Eintragung rechtlich wirksam. Dies bedeutet, dass das Vermögen der übertragenden Körperschaft durch Gesamtrechtsnachfolge auf den übernehmenden Rechtsträger übergeht und die übertagende Körperschaft geht unter.[64]
Der handelsrechtliche Verschmelzungsstichtag ist nach § 5 Abs.1 Nr. 6 UmwG der Zeitpunkt, von dem an die Handlungen des übertragenden Rechtsträgers als für Rechnung des übernehmenden Rechtsträgers vorgenommen gelten. Nach § 19 Abs. 1 S. 2 UmwG wird die Verschmelzung, unabhängig vom Verschmelzungsstichtag, erst mit der Eintragung ins Handelsregister wirksam.
Der übertragende Rechtsträger führt bis zum Verschmelzungsstichtag sein Unternehmen auf eigene Rechnung und bis zur Eintragung ins Handelsregister, führt der übertragende Rechtsträger die Geschäfte für Rechnung des übernehmenden Rechtsträgers[65]. Bis zur Registereintragung ist die übertragende Gesellschaft zur Buchführung und Bilanzierung verpflichtet. Dies wird in der Praxis meist von der Übernehmerin fortgeführt. Die Schlussbilanz darf höchstens auf einen acht Monate vor der Anmeldung liegenden Stichtag aufgestellt worden sein. Der Stichtag der Schlussbilanz ist nach h. M. immer ein Tag vor dem im Verschmelzungsvertrag festgelegten Verschmelzungsstichtag.[66]
4.5 Steuerlicher Übertragungsstichtag
Der steuerliche Übertragungsstichtag ist nicht identisch mit den handelsrechtlichen Verschmelzungsstichtag (§ 2 Abs. 1 UmwStG).
Nach § 2 Abs. 1 UmwStG ist der steuerliche Übertragungsstichtag der Tag, an dem der übertragende Rechtsträger die Bilanz für die Vermögensübertagung aufzustellen hat. Der steuerliche Übertragungsstichtag geht dem handelsrechtlichen Verschmelzungsstichtag voran.
Beispiel:[67]
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Die Wahl eines anderen Stichtags besteht nicht.
Die übertragende Gesellschaft hat nach § 17 Abs. 2 UmwG auf den Schluss des Tages, der dem Verschmelzungsstichtag vorangeht, eine Schlussbilanz aufzustellen und diese bei der Anmeldung ins Register beizufügen. Das Registergericht darf die Verschmelzung nur eintragen, wenn die Bilanz auf einen höchstens acht Monate vor der Anmeldung liegenden Stichtag aufgestellt worden ist.[68]
[...]
[1] Vgl. Rs. C-411/03.
[2] Vgl. Sagasser, § 2 Rn.41.
[3] Vgl. Lutter/ Drygala, § 4 UmwG Rn.4.
[4] Vgl. Mayer, § 4UmwG Rn.20.
[5] Vgl. Mayer, § 5 UmwG Rn.2.
[6] Vgl. Bula/Pernegger, § 9, Rn.79.
[7] Vgl. Mayer, § 5 UmwG Rn.95.
[8] Vgl. Brähler, S. 40.
[9] Vgl. Schroer, § 5 UmwG, Rn.19.
[10] Vgl. Lutter/Drygala, § 5 UmwG Rn.20.
[11] Vgl. Lutter/Drygala, § 5 UmwG Rn.20.
[12] Vgl. Stratz, § 5 UmwG, Rn.5.
[13] Vgl. Reichert, § 54 UmwG, Rn.33.
[14] Vgl. Winter, § 54 UmwG, Rn.35.
[15] Vgl. Reichert, § 54 UmwG, Rn.41.
[16] Vgl. Reichert, § 55 UmwG, Rn.2.
[17] Vgl. Reichert, § 55 UmwG, Rn.7.
[18] Vgl. Stratz, § 55 UmwG, Rn.18.
[19] Vgl. Stratz, § 55 UmwG, Rn.19, vereinfachte Formel
[20] Vgl. Winter, § 55 UmwG, Rn.1.
[21] Vgl. Sagasser/Luke, § 9 Rn.307.
[22] Vgl. Reichert, § 54 UmwG Rn.16.
[23] Vgl. Winter, § 54 UmwG Rn.14.
[24] Vgl. Stratz, § 54 UmwG Rn.17.
[25] Vgl. Sagasser/Luke, § 9 Rn.315.
[26] Vgl. Reichert, § 54 UmwG Rn.3.
[27] Vgl. Reicher, § 54 UmwG Rn.6.
[28] Vgl. Winter, § 54 UmwG Rn.9.
[29] Vgl. Sagasser/Luke § 9, Rn.45.
[30] Vgl. Heckschen, DNotZ 2007, S. 448.
[31] Vgl. Sagasser/Luke, § 9, Rn.322.
[32] Vgl. Fronhöfer, § 17 UmwG, Rn.66.
[33] Vgl. Bula/Pernegger § 10, S. 368 Rn.16.
[34] Vgl. Priester in Lutter UmwG, § 24 Rn.14.
[35] Vgl. Bula/Pernegger §10, Rn.92
[36] Vgl. Bula/Pernegger § 10,Rn.92, Priester in Lutter, § 24 UmwG Rn.22.
[37] Vgl. Haritz in Semler/Stengel, § 24 UmwG, Rn.55.
[38] Vgl. Haritz in Semler/Stengel, § 24 UmwG, Rn.4.
[39] Vgl. Bula/Pernegger § 10, Rn.93.
[40] Vgl. Bula/Schlösser 2002, Rn.31.
[41] Vgl. Priester, § 24 UmwG Rn.43.
[42] Vgl. Haritz, § 24 UmwG Rn.33.
[43] Vgl. Haritz, § 24 UmwG Rn.54.
[44] Vgl. Bula/Pernegger § 10, S. 393, Rn.126.
[45] Vgl. Priester, § 24 UmwG Rn.68.
[46] Frotscher/Maas, § 1 UmwStG, Rn.11.
[47] BGBl. I 1994 S. 3267.
[48] Auf die Änderungen wird nicht näher eingegangen, da sich durch das SEStEG vom 07.12.2006 das Umwandlungssteuerrecht völlig geändert hat.
[49] BGBl. I 1997, S. 2590.
[50] BGBl. I 1999, S. 402.
[51] BGBl. I 1999, S. 2601.
[52] BGBl. I 2000, S. 1433.
[53] BGBl. I 2001, S. 3858.
[54] BGBl. I 2003, S. 660.
[55] BGBl. I 2006, S. 2782.
[56] EU vom 17.02.2005, 2005/19/EG, ABl. Nr. L 58 S. 19 und die SE Verordnung: Verordnung (EG) Nr. 2157/2001, ABl. L294/1 v. 10.11.2001
[57] „Hughes des Lasteyrie du Saillaint“, EuGH, Urteil v. 11.3.2004 Rs. C-9/02 und „SEVIC“ EuGH, Urteil v. 13.12.2005, Rs. C-411/03.
[58] Vgl. Bärwaldt, § 11 UmwStG Rn.1.
[59] Vgl. Schmitt, Vor §§ 11-13 UmwStG
[60] Vgl. Bärwaldt, § 11 UmwStG Rn.2.
[61] Vgl. Bärwaldt, § 11 UmwStG Rn.4.
[62] Vgl. BT-Drs. 16/2710, 35.
[63] Vgl. Bärwaldt, § 11 UmwStG Rn.11.
[64] Vgl. Schlösser, § 11 Rd.25.
[65] Siehe IDW-HFA 2/97
[66] Vgl. BMF-Schreiben v. 25.3.1998, Rn.02.02, Hörtnagl 2009, § 17 UmwG, Rn.37
[67] Vgl. BMF Entwurf Umwandlungssteuererlass v. 02.05.2011, Rn.02.02.
[68] Vgl. Klingebiel [2008], S. 55, BMF Entwurf Umwandlungssteuererlass v. 02.05.2011, Rn 02.02
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Erstausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2012
- ISBN (Paperback)
- 9783955490348
- ISBN (PDF)
- 9783955495343
- Dateigröße
- 315 KB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- FOM Essen, Hochschule für Oekonomie & Management gemeinnützige GmbH, Hochschulleitung Essen früher Fachhochschule
- Erscheinungsdatum
- 2015 (Februar)
- Note
- 2
- Schlagworte
- Globalisierung Unternehmensstruktur Europäisierung Ertragssteuerrecht
- Produktsicherheit
- BACHELOR + MASTER Publishing