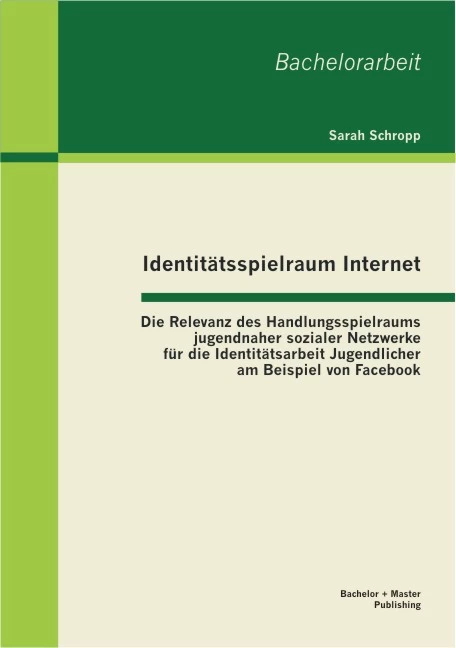Identitätsspielraum Internet: Die Relevanz des Handlungsspielraums jugendnaher sozialer Netzwerke für die Identitätsarbeit Jugendlicher am Beispiel von Facebook
Zusammenfassung
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
2.1 Sozialisation im Jugendalter
Seit den 80er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts erfahren die Medien zunehmend auch in der Pädagogik eine größere Beachtung. Es wird ihnen erstmals eine Rolle im Sozialisationsprozess von Kindern und Jugendlichen zugeschrieben. Einen bis heute gültigen sozialisationstheoretischen Ansatz formuliert Klaus Hurrelmann. Auf seine Sozialisationstheorie werde ich mich im folgenden Abschnitt beziehen.
Mit dem Begriff Sozialisation beschreibt Klaus Hurrelmann „den Prozess, in dessen Verlauf sich der mit einer biologischen Ausstattung versehene menschliche Organismus zu einer sozial handlungsfähigen Persönlichkeit bildet, die sich über den Lebenslauf hinweg in Auseinandersetzung mit den Lebensbedingungen weiterentwickelt.“[1]
In seinem sozialisationstheoretischen Ansatz untersucht Hurrelmann den Einfluss der Gesellschaft auf die Persönlichkeitsentwicklung. Zentral ist sein Modell „des produktiv Realität verarbeitenden Subjekts“.[2] Die zugrunde liegende Theorie besagt, dass sich die Persönlichkeit eines Menschen in allen Lebensphasen aus der aktiven Auseinandersetzung mit der „inneren Realität“, also den Bedürfnissen der eigenen Physiologie und Psychologie, und der „äußeren Realität“, also den Ansprüchen, Normen und Regeln der Gesellschaft, bildet.
Klaus Hurrelmann hebt dabei hervor, dass die „lebenslange Aneignung und Auseinandersetzung mit den natürlichen Anlagen“[3] und der individuellen biologischen Ausstattung die Vorstellung klar ausschließt, Sozialisation sei lediglich die Aneignung gesellschaftlich gewünschter Normen und Verhaltensregeln. Er beschreibt die Persönlichkeitsentwicklung als einen aktiven und durchaus produktiven Prozess, in welchem sich der Mensch mit den Anforderungen des eigenen Körpers und der eigenen Psyche aktiv auseinandersetzt und versucht, diese erfolgreich mit den Anforderungen der sozialen Umwelt in Einklang zu bringen.
Dieser Prozess wird von Hurrelmann deshalb als „produktiv“ beschrieben, weil jeder Mensch flexibel und kreativ eine individuelle Form der Sozialisation wählt, die sich aus den jeweiligen spezifischen inneren und äußeren Bedingungen generiert.[4] Hurrelmann arbeitet dabei mit einem Lebensphasenkonzept. Der Mensch hat darin selbstständig und ein Leben lang jeweils altersspezifische Entwicklungsaufgaben zu bearbeiten, in denen es gilt, die Prozesse der Individualisierung und der sozialen Integration in Einklang zu bringen.
Wenn Sozialisation sich nun als ein Prozess beschreiben lässt, der jedem Individuum lebenslange kreative und produktive Entwicklungsarbeit abverlangt, warum scheint dann vor allem die Adoleszenz eine so komplexe Phase des Sozialisationsprozesses darzustellen?
Eine zentrale Entwicklungsaufgabe im Jugendalter ist, nach Hurrelmann, die individuelle Ausbildung einer eigenen Identität ebenso wie die Übernahme der Rolle als sozial integrierter Bürger.[5]
Dass sich nun im Kontext von Jugend und Sozialisation die Identitätsbildung krisenhaft vollzieht, schreibt auch Erik Homburger Erikson.[6] Für den Psychoanalytiker stellt die Adoleszenz eine normative Krise dar, eine im Zyklus des Lebens determinierte „Phase vermehrter Konflikte“.[7] Psychische und physische Ver-änderungen in der Pubertät stellen neue Herausforderungen an die Jugendlichen, die es zu bewältigen und mit den gesellschaftlichen Anforderungen in Einklang zu bringen gilt. Das Erikson’sche Entwicklungsmodell beschreibt die Bildung der Identität als Thema, das in der Entwicklung eines Menschen zwar stets präsent bleibt, vorrangig jedoch in der Phase der Adoleszenz behandelt wird. Die Jugendlichen durchlaufen von der Geburt an verschiedene Entwicklungsstadien, in denen jeweils die Bewältigung eines bestimmten Themas Vorrang hat. Erikson vertritt die Vorstellung von Neubildung und Erweiterung des Könnens der Jugend-lichen auf der Grundlage von Vorangegangenem.[8]
Im Gegensatz zu Erikson bezieht sich Hurrelmann jedoch im Hinblick auf die oben genannte Identitätsbildung nicht auf die Verarbeitung kindlicher Identifikationsmuster und deren neue Verortung in der Gegenwart, sondern auf die „Ergebnisse der Verarbeitung der inneren Realität und [deren] Abstimmung mit den Ergebnissen der Verarbeitung der äußeren Realität“.[9] Diese werden, hier stimmen Erikson und Hurrelmann überein, im Verlauf der Entwicklung bis zur Adoleszenz zunehmend bewusster und für den Jugendlichen verfügbarer. Eben diese Bewusstwerdung der eigenen Bedürfnisse und das Potenzial, sie zu erkennen, sowie die Fähigkeit, sie mit den Anforderungen der Umwelt in Einklang zu bringen, „erreichen erst in der Jugendzeit eine qualitative Stufe“[10]. Dies macht die Komplexität der Jugendphase aus.
Erikson bezeichnet die Jugendzeit darüber hinaus als „entwicklungsförderliches Moratorium“.[11] Es ist eine Zeit zwischen abgeschlossener sozialer Integration und Identitätsbildung sowie jugendlicher Freiheit. Auf die Frage, ob Identitätsbildung jemals als abgeschlossen verstanden werden kann und ob das von Erikson entwickelte Identitätskonzept in Gänze auf die heutigen gesellschaftlich-kulturellen Bedingungen anwendbar ist, gehe ich an anderer Stelle meiner Arbeit ein.
Rückhalt finden die Jugendlichen in dieser krisenhaften Zeit der Adoleszenz in Gleichaltrigengruppen, den Peergroups. Sie spielen in der Jugendphase eine wichtige Rolle, denn sie avancieren in dieser Zeit zur bedeutendsten Sozialisationsinstanz. Sie bieten Rückhalt in der Ablösung vom Elternhaus und Raum für freies Experimentieren ohne erzieherische Konsequenzen.[12]
2.2 Mediensozialisation von Jugendlichen
Fritz, Sting und Vollbrecht bezeichnen Sozialisation als „jene dialektische Beziehungen zwischen Persönlichkeitsentwicklung und gesellschaftlich vermittelter sozialer Umwelt, die nicht an pädagogische Absichten und Dialektiken geknüpft sind“.[13] Moderne Kommunikations- und Informationsmedien haben sich in diesem pädagogisch dialektischen Vakuum etabliert.
Die Studie Jugend, Information (Multi-)Media, des Medienpädagogischen Forschungsverbunds Südwest, kurz JIM-Studie, erhebt jährlich Daten über die komplexe Medienwelt deutscher Jugendlicher zwischen 12 und 19 Jahren.
Im Jahr 2011 umfasste die Grundgesamtheit aller Befragten ca. 7.000.000 Jugendliche. Da die Mediennutzung der Jugendlichen jedoch vielfältige Ausprägungen hat und ich an dieser Stelle nicht detailliert auf Unterschiede in Bildungsniveau, Geschlecht oder Alter eingehen kann, sind die im Folgenden aufgeführten Zahlen und Darstellungen immer vereinfachend zu verstehen und sollen nur einen Überblick vermitteln.
Der JIM-Studie 2009 zufolge besteht bereits eine Vollversorgung an Mediengeräten, wenn ein Haushalt mit einem Computer, einem Internetzugang, einem Mobiltelefon und einem Fernsehgerät ausgestattet ist. Knapp 100 % der Haushalte, in denen 12- bis 19-Jährige heute aufwachsen, sind demnach, laut JIM-Studie, voll versorgt. Sie verfügen über einen Fernseher, mindestens einen Computer mit Internetanschluss und mehr als ein Mobiltelefon.[14]
Und die Gerätezahlen zur Mediennutzung pro Haushalt steigen weiterhin stetig an. Nach dem Einzug von Laptops, iPods und MP3-Playern in deutsche Familien haben sich im vergangenen Jahr Spielekonsolen mit Bewegungs- und Lichtsensortechnik, Tablet-PCs und iPads zunehmend im Alltag der Jugendlichen etabliert.[15] Die nachfolgende Tabelle ermöglicht einen Überblick über die Geräte-Ausstattung in deutschen Haushalten im vergangenen Jahr:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 1: Geräte-Ausstattung im Haushalt 2011
Über die Familiengeräte hinaus verfügen die Jugendlichen aber auch über ein beachtliches Repertoire an eigenen Geräten zur Mediennutzung. 79 % von ihnen haben einen eigenen Computer, 52 % einen eigenen Fernseher und 45 % können von ihrem Zimmer aus im Internet surfen.[16]
Ganz offensichtlich spielen die Medien in der wichtigsten Sozialisationsphase der Jugendlichen zunehmend eine bedeutungsvollere Rolle. Oft wird in der Pädagogik bereits von „Medienjugend“ oder „Medienkindheit“[17] gesprochen.
Neben den Beziehungen zur Peergroup sind also vor allem neue Kommunikationsmedien wie das Internet in der Adoleszenz besonders wichtig für Jugendliche. Indiz hierfür ist auch die steigende Anzahl von Smartphones. Sie bieten Jugendlichen neben den herkömmlichen Kommunikationsfunktionen die Möglichkeit, beinahe standortunabhängig im Internet zu surfen (2010 besaßen 23 % aller Jugendlichen zwischen 12 und 19 Jahren ein eigenes Smartphone, 2012 sind es bereits 43 %[18] ).
Die neuen digitalen Medien stehen in reziproker Beziehung zu den herkömmlichen Sozialisationsinstanzen wie der Familie, der Schule und den Peergroups. Selbstverständlich werden die traditionellen Sozialisationsinstanzen nicht gänzlich von den neuen abgelöst, sie werden jedoch von ihnen ergänzt. Hierbei entsteht ein für Eltern und Lehrer oftmals schwer einseh- und kontrollierbarer Raum.[19]
Der Prozess der Mediensozialisation wird in dieser Hinsicht zunehmend bedeutender, denn die Medien repräsentieren einen „Kulturbereich […], der sich weitgehend außerhalb pädagogischer Einrichtungen etabliert hat“.[20]
Gerade im Hinblick auf neue Kommunikationsmedien haben Erwachsene ihren Kindern gegenüber oft keinerlei Wissensvorsprung mehr. Dies macht den Prozess der Mediensozialisation in der Erziehungswissenschaft zunehmend wichtiger.[21] Ein pädagogisches Konzept aufrechtzuerhalten, in dem Medien, Medienpädagogik und Mediensozialisation nur eine Nebenrolle spielen, würde der Wirklichkeit der Digital Natives in keiner Weise entsprechen.[22]
Der Begriff Mediensozialisation wird fälschlicherweise vielmals nur eindimensional definiert. Einig ist man sich in der Medien- und Sozialisationsforschung darüber, dass bei der Mediensozialisation keineswegs von einer einseitigen Wirkungsweise ausgegangen werden kann. Medienhandeln ist ein aktives Handeln, das in der Alltagswelt von Jugendlichen heute fest etabliert und von großer Bedeutung im Kontext von Sozialisation und Identitätsbildung ist. Um jedoch den gesamten Umfang von Mediensozialisation zu berücksichtigen, ist eine weiter reichende Betrachtung notwendig.
Um den aktiven Teil der Mediensozialisation hervorzuheben, wird in der Forschung zwischen Selbstsozialisation und Fremdsozialisation unterschieden.
Mediensozialisation ist dabei nicht als „passiver“ Prozess zu verstehen. Dies würde bedeuten, dass sich Jugendliche von Medien völlig unselektiert sozialisieren ließen, ohne eine Möglichkeit zu haben, auf diesen Prozess Einfluss zu nehmen. Dies ist keineswegs der Fall. Denn Mediensozialisation findet sowohl fremd- als auch selbstbestimmt statt. Schließlich ist jede Mediennutzung unweigerlich verbunden mit einem von den Jugendlichen „erwarteten Nutzen“.[23] Mediensozialisation setzt infolgedessen aktiv handelnde Subjekte voraus, die sich mithilfe von Medien durchaus auch selbst sozialisieren.
Mediensozialisation ist darum nicht nur Sozialisation durch die Rezeption von Medieninhalten (passiv), sondern ebenso Selbstsozialisation durch die bewusste Nutzung von Medieninhalten (aktiv).[24]
Der Aspekt der Selbstsozialisation wird in der Pädagogik jedoch durchaus auch kritisch betrachtet. Konstatiert wird beispielsweise eine Entpädagogisierung des Sozialisationsdiskurses, einhergehend mit der Sorge, dass die Pädagogik an Bedeutung verliere. Ebenso wird die Gefahr einer Ökonomisierung der Pädagogik angeführt, die das Subjekt womöglich dafür verantwortlich macht, sich nicht eigenständig aktiv erfolgreich sozialisiert zu haben.[25] Leider kann hier nicht weiter auf die Kritikpunkte zur Selbstsozialisation durch Medien eingegangen werden.
Ziel der Mediensozialisation ist der Erwerb von Medienkompetenz. Die Begriffsdefinitionen beziehen sich heute meistens auf digitale Medien und gehen von einem Subjekt als Träger von Medienkompetenz aus.[26] Der Begriff der Medienkompetenz ist auf Dieter Baake zurückzuführen. Medienkompetente Personen sind demnach sachgerecht, selbstbestimmt, kreativ und verantwortungsbewusst im Umgang mit Medien. Sie haben Analyse-, Urteils- und Handlungskompetenzen erworben und können angemessen auch mit neuen digitalen Medien umgehen.
Während Jugendliche in der heutigen Zeit von Individualisierung und Pluralisierung zunehmend dem Zwang unterzogen werden, Schöpfer einer einzigartigen Individualbiografie zu sein, bietet ihnen das Medium Internet virtuelle Erfahrungsräume und Rollenvorbilder. Darüber hinaus erfüllt es die von Jugendlichen an ihre Freizeit gestellten Ansprüche ausgezeichnet, was es umso attraktiver macht.[27]
Medien sind demnach für Jugendliche identitätsprägend, da sie neben unterhaltenden und informativen Funktionen ebenso Orientierungsmöglichkeiten für Zukunftsvorstellungen, Rollenbilder und Identitätskonstruktionen bieten. Im 5. Kapitel meiner Arbeit werde ich ausführlich darlegen, in welcher Art und Weise das Internet als Identitätsstifter für Jugendliche fungieren kann. Vorab gebe ich jedoch einen Einblick in die Identitätsforschung und erläutere den Begriff Identität und sein Begriffsumfeld.
3 Traditionelle und aktuelle Identitätsforschung
Die Thematisierung von Identität hat in den letzten Jahrzehnten sowohl im Alltagsdiskurs als auch in den Fachszenen zugenommen.[28] Dennoch ist Identität noch immer ein Begriff mit einem vielschichtigen, komplexen semantischen Umfeld. Es fällt schwer, ihn in Worte oder gar in eine allgemeingültige Definition zu fassen. Die Verwendung des Begriffs geht selten mit einer Definition einher, was darauf schließen lässt, dass hier durchaus Klärungsbedarf besteht.
Ist Identität die Antwort auf die Frage „Wer bin ich“? Wodurch definiert sich Identität und wie wird sie konstruiert?[29]
Zur Erläuterung des Begriffs und zur Vorbereitung auf die Thematik jugendlicher Identitätskonstruktionen in sozialen Netzwerken werde ich im Folgenden zuerst einen Einblick in die Identitätsforschung sowie einen allgemeinen Überblick über ältere und neuere Identitätstheorien geben. Im Anschluss folgt eine Darlegung des von E. H. Erikson entworfenen Identitätskonzeptes und die Beantwortung der Frage, ob und inwiefern es auf die Identitätsarbeit Jugendlicher in der heutigen Zeit anwendbar ist. Weiter erfolgt die Untersuchung des Handlungsspielraums Social Network im Hinblick auf seine Relevanz für die Identitätsarbeit Jugendlicher sowie die Illustration der Netzwerkplattform Facebook. Ich differenziere im weiteren Verlauf meiner Arbeit nicht zwischen Identitätsarbeit, Identitätskonstruktion und Identitätsgenese. Zu verstehen ist darunter, je nach Kontext, die Erschaffung von und das Arbeiten an einer „individuellen Identität“.[30]
3.1 Einführung in die Identitätsforschung
Die Konstruktion von Identität ist, dem aktuellen Stand der Identitätsforschung zufolge, ein lebenslanger Prozess. Konzepte, nach welchen Identität, einmal konstruiert, lebenslange Gültigkeit erfährt, sind überholt und passen nicht mehr in das Bild einer Gesellschaft, die sich durch Individualisierung, Enttraditionalisierung und Globalisierung immer weiter fragmentiert und verändert. Offenbar sind es diese rasanten soziokulturellen Veränderungen unserer Gesellschaft, die das Thema Identität und Identitätsarbeit auch aktuell in den Fokus der Forschung rücken.[31]
Man selbst zu sein, sich selbst zu finden, seine Identität zu erschaffen oder mit sich selbst eins zu sein, scheinen momentan höher im Kurs zu stehen als je zuvor. Gibt man bei www.google.de den Begriff Selbstfindung ein, so öffnen sich innerhalb von 0,16 Sekunden 841.000 Ergebnisse[32] zu diesem Thema.
Überschrieben sind die meisten Suchergebnisse mit dem Satz „Wer bin ich?“.
Wissen die Menschen der Postmoderne nicht mehr, wer sie sind? Und warum scheint es heute eigentlich so wichtig, exakt definieren zu können, wer man ist? Sozialwissenschaftler erkennen in dieser scheinbar unablässigen Suche nach dem eigenen Selbst die Auswirkungen einer sich radikal verändernden Umwelt. Ina-Maria Greverus beantwortet die Frage nach der Suche der eigenen Identität mit einer Identitätsformel: „Sich Erkennen, Erkannt, Anerkannt werden“[33] und schreibt weiterhin, Identität sei ein Prozess, der nur im Dialog mit anderen funktioniere. „Der Andere erkennt und anerkennt mich als Du und etwas Besonderes.“[34]
Die Menschen scheinen auf der Suche nach Anerkennung, Zugehörigkeit und einem Platz in einer pluralistischen Gesellschaft.
Die aktuelle Identitätsforschung diagnostiziert, dass die Suche nach Identität und vor allem nach Anerkennung und Zugehörigkeit für die Menschen unserer Zeit zu einem Dauerthema geworden ist. Während das traditionelle Verständnis von Identität auf Dauerhaftigkeit und Einheit beruht, stellt die neuere Identitätsforschung die Veränderbarkeit und Vielseitigkeit der Identität in den Vordergrund.[35]
Einig ist man sich darin, dass traditionelle Wege und Formen der Identitätsbildung in einer dem Wandel unterworfenen postmodernen Gesellschaft zunehmend verschwinden. Identität wird heute nicht mehr auf dem herkömmlichen Weg erschaffen, sondern verlangt dem Menschen eine ganze Menge mehr Selbstbeteiligung ab als noch vor 500 Jahren. Denn kein Identitätskonzept kann losgelöst von seinem kulturellen, entstehungsgeschichtlichen Hintergrund gesehen werden. Sicher scheint, dass die Identitätsforschung in der heutigen Zeit einer Weiterentwicklung bedarf.
Gründe dafür sind in den soziokulturell veränderten Bedingungen zu finden, unter denen Identität heute entsteht. „Identitätsbildung ist prekär geworden“[36], schreibt Heiner Keupp. Aber was macht die Identitätsarbeit heute so prekär? Und warum scheinen vorangegangene Generationen dieses Problem nicht zu kennen?
In der Identitätsforschung geht man davon aus, dass sich Identität seit jeher mithilfe von Vorlagen und anhand vorgegebener Muster kreiert, die sich, je nach Kultur, Gesellschaftsform oder Zeit, voneinander unterscheiden, denen jedoch allen eine Konstruktionskraft zugrunde liegt, die es den Menschen ermöglicht, auf deren Basis individuelle Identität zu entwickeln.[37] Solche „Identitätsanker“[38] fanden Menschen bisher in soziokulturell und traditionell vorgeprägten Lebensformen. Familie, Gesellschaftsschicht, Geschlechterrollen, Religion oder Mythen liefern ihnen seit jeher „Identitätsschablonen“[39], die als Orientierungspunkte für den Entwurf der eigenen Identität fungieren.[40]
Diese traditionellen Orientierungshilfen scheinen den Jugendlichen heute nur noch rudimentär für die Identitätsarbeit zur Verfügung zu stehen. Ulrich Beck spricht von einer „Freisetzung des Menschen aus seinen Traditionen [durch die] Erosion stabiler Verhältnisse, die sich über Generationen gefestigt hatten“.[41]
Übereinstimmend kommt die Identitätsforschung gegenwärtig zu dem Schluss, dass der Auslöser für die zu zerfallen scheinenden traditionellen Identitätsvorlagen die durch Individualisierung und Globalisierung geprägte Zeit ist, in der wir leben. Die Postmoderne – eine Risikogesellschaft.
Individualisierung, so Beck in seinem Buch „Risikogesellschaft“[42], bedeutet den Ausstoß des Menschen aus seinem traditionellen, über Jahrhunderte entstandenen Rollenverständnis. Der Mensch hat in der heutigen Zeit eine Überfülle an Wahlmöglichkeiten und Optionen, sein Leben und somit seine Identität zu gestalten.[43] Stabile Verhältnisse, die sich über Generationen hinweg gebildet haben, erodieren und kulturell vorgefertigte Identitätsmuster lösen sich auf. Der Mensch ist heute, vereinfacht gesagt, nicht mehr allein Bauer, Ehemann und Vater, wie noch vor 500 Jahren. Heute ist er darüber hinaus Steuerzahler, Vorsitzender des ansässigen Kulturvereins, Motorradfahrer, Blutspender und Raucher. Auch zu Beginn des 20. Jahrhunderts war es noch ungleich leichter, anhand der wenigen, aber klar definierten Rollenvorgaben eine kohärente Identität zu entwerfen und seinen Platz in Gesellschaft und Familie zu verorten.
Im weiteren Verlauf verwende ich den Begriff der Individualisierung im soziologischen Sinne. Im Hinblick auf das Identitätsmanagement Jugendlicher ist Individualisierung die Aufgabe, die eigene Biografie und Identität selbst zu kreieren. Sie ist sowohl die Chance, aus einer Überfülle an Möglichkeiten frei wählen zu können, als auch „der Zwang zur Selbstverwirklichung [oder] die Forderung, Baumeister seines eigenen Lebens und seiner Identität zu sein“.[44]
Die Globalisierung kommt in diesem Prozess auf den ersten Blick anscheinend erschwerend hinzu. Sie eröffnet einen unvorstellbaren Horizont an Wahlmöglichkeiten und verlangt Individualisierungs- und Identitätsarbeit auf einem weitaus größeren Terrain, als es vorangegangenen Generationen abverlangt wurde. Auf den zweiten Blick bietet sie aber auch ein schier unerschöpfliches Potenzial an Optionen zur Selbstverwirklichung.
Der Begriff Globalisierung wird in diesem Zusammenhang nicht aus ökonomischer Sichtweise betrachtet, sondern bezieht sich auf die „Intensivierung weltweiter Beziehungen“.[45] Denn gerade die sogenannte kulturelle Globalisierung[46] hat großen Einfluss auf die Identitätsarbeit von Jugendlichen. Besonders moderne Informations- und Kommunikationsmedien wie das Internet unterstützen und beschleunigen den weltweiten Austausch von Bildern, Texten, Musik und Identitätsschablonen rund um den Globus.
Im Folgenden erläutere ich das Stufenmodell der psychosozialen Entwicklung nach Erikson, um einen Einblick in die traditionelle Identitätsforschung zu geben.
3.2 Traditionelle Identitätsforschung – das Stufenmodell der psychosozialen Entwicklung nach Erikson
In der Mitte des 20. Jahrhunderts entwickelt Erik Homburger Erikson ein Identitätskonzept, welches im Unterschied zu den bisherigen entwicklungspsychologischen Konzepten seiner Zeit, zum Beispiel dem Sigmund Freuds, nicht der frühen Kindheit, sondern der Adoleszenz eine bedeutende Rolle in der Identitätsgenese zuspricht.
Erikson definiert Identität als die „unmittelbare Wahrnehmung der eigenen Gleichheit und Kontinuität in der Zeit und die damit verbundene Wahrnehmung, dass auch andere diese Kontinuität erkennen“.[47] Er beschreibt Identität als das bewusste Erleben eines konstanten Ich-Gefühls, einhergehend mit dem Bewusstsein, auch von anderen als konstantes Ich wahrgenommen zu werden.
Der Psychoanalytiker bezeichnet die Identitätsentwicklung als eine psychosoziale Entwicklung, bei der die permanente Wechselwirkung zwischen Individuum und Gesellschaft im Mittelpunkt steht.[48] Ferner formuliert Erikson, dass Jugendliche während des Prozesses der Identitätsbildung Kindheitserfahrungen und Identifikationsmuster aufarbeiten, rekonstruieren und wieder in ihre gegenwärtige Lebenswelt integrieren, um eine einheitliche und kontinuierliche Identität erschaffen und diese ein Leben lang aufrechterhalten zu können.[49]
Ist nun aber eine beständige und konsistente Identität in einer sich permanent verändernden Umwelt überhaupt wünschenswert? Kann man die Vorstellungen von Erikson in eine Zeit übertragen, in der sich die Bedingungen, unter denen sich Identität bildet, so sehr verändert haben? Diese Fragen sollen im Folgenden Beantwortung finden. Vorab soll das von Erik H. Erikson entwickelte Stufenmodell der psychosozialen Entwicklung[50] beschrieben werden.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 2: Entwicklungsmodell nach Erikson
Das von Erikson entwickelte Stufenmodell der psychosozialen Entwicklung zeigt, dass die verschiedenen Stadien der menschlichen Entwicklung, unter ihnen auch die Identitätsentwicklung, ein Leben lang präsent bleiben, wobei sie nur jeweils in bestimmten Altersphasen für den Menschen von besonderer Bedeutung sind.[51]
Diese lebenslange Entwicklung und der Durchlauf verschiedener Entwicklungsstufen erfolgt krisenhaft. In jeder Phase der Entwicklung verschärft sich eine Thematik der menschlichen Entwicklung zu einer potenziellen Krise, in welcher der Mensch zwischen den beiden thematischen Polen der Krise schwankt und sich für einen entscheiden muss (siehe Abbildung 2). Ausgelöst wird jede Krise durch die Erwartungen der sozialen Umwelt und gelöst wird sie erst, indem sich der Mensch aktiv für einen der beiden Pole entscheidet. Nur durch die eigene Verarbeitung und damit Lösung der jeweiligen Krise kann die Entwicklungsphase abgeschlossen werden.[52]
Das Bewältigen vorangegangener Krisen erleichtert dabei das Bestehen der noch bevorstehenden Phasen durch den Erwerb phasenspezifischer Fertigkeiten. Nach einer erfolgreich gelösten Krise erwirbt der Mensch Kompetenzen, die es ihm ermöglichen, Lösungen für die alltäglichen Aufgaben des Lebens zu finden.[53]
Wie in Abb. 2 zu sehen ist, zeigt Erikson neben den zu erwerbenden Kompetenzen auch die Fehlhaltungen auf, die durch ungelöste Krisen entstehen können.[54] Wichtig ist dabei, dass jede errungene Kompetenz lebenslang durch ihre negative Alternative, ihr dynamisches Gegenstück[55], beeinflusst und verändert werden kann.
Im Hinblick auf die Identitätsarbeit Jugendlicher ist die Adoleszenz in Eriksons Stufenmodell besonders relevant. Auch dort stellt die Identitätsbildung eine zentrale Entwicklungsaufgabe dar. Gemäß dem Modell vollzieht auch sie sich krisenhaft. Eriksons dynamisches Gegenstück zur Identitätsbildung ist die Identitätsdiffusion. Diese kann sich, so Erikson, auf zweierlei Weise äußern. Zum Ersten können Standardisierungen und die permanente Vorgabe gesellschaftlich gewünschter Rollenbilder dazu führen, dass sich Jugendliche nicht identifizieren können bzw. es auch nicht wollen. Die Folge ist die Flucht vor jeglichen Identitätsangeboten, die in einer misslungenen Identitätskonstruktion endet. Zum Zweiten kann sich, so Erikson weiter, Identitätsdiffusion in einer Überidentifikation mit Rollenvorbildern äußern. Durch sie kann Intoleranz gegenüber anderen Identifikationsmustern entstehen und es kann zu Simplifikationen und starken Vorurteilen kommen.[56]
Bezogen auf die heutige Realität ist Eriksons Stufenmodell der psychosozialen Entwicklung jedoch durchaus kritisch zu betrachten.
Vor allem im Hinblick auf die hier besonders relevante fünfte Entwicklungsphase scheinen die Überlegungen Eriksons kaum auf die Gegenwart übertragbar zu sein.
Denn die Adoleszenz unterscheidet sich in der Form von den anderen sieben Phasen, als dass dort keine bestimmte Kompetenz erworben werden kann, sondern die Antwort auf die Frage „Wer bin ich?“ gefunden werden muss. Das kritisiert auch Lothar Krappmann.[57] Er weist darauf hin, dass nach Erikson in der Jugendphase anstelle einer Kompetenz, die errungen werden kann, plötzlich eine Festlegung erfolgen muss.[58] Krappmann schreibt weiter, dass Erikson mit seiner Beschreibung von einheitlicher und kontinuierlicher Identität ein fast statisches und angepasstes Identitätsbild beschreibt, das sich in erster Linie vor dem Zerfall durch Diffusion zu schützen hat. Die größte Bedrohung der „erfolgreichen“ Identitätsbildung sieht Erikson darin, dass die im Laufe der Entwicklungsphasen erworbenen Identitäts-Bruchstücke kein von der sozialen Umwelt anerkanntes Ganzes bilden, sondern letztlich unverbunden bleiben.[59] Diese Gefahr entsteht, wenn Jugendliche die sozialen Angebote ihres Umfeldes nicht nutzen. Er betont die von Jugendlichen zu leistende Integration in die Gesellschaft. Die Antwort auf die Frage „Wer bin ich?“ ist für ihn eine soziale Definition, die den Jugendlichen einen Platz innerhalb des sozialen Gefüges verspricht.[60]
Bei allen seinen Vorstellungen von sozialer Integration und der Abwendung der Gefahr des Identitätszerfalls durch Diffusion bleibt jedoch von Erikson unbeachtet, dass Jugendliche sich vor diesem Hintergrund „möglicherweise [auch in] sehr inhumane Gegebenheiten einzufügen“[61] haben. Es scheint, so auch Krappmann, als sähe Erikson nur in der sozial angepassten Identität eine Idealform, die äußeren und inneren Widrigkeiten trotzt. Womöglich, so vermutet er weiter, wurzelt Eriksons Sichtweise auf gelungene Identitätsbildung als anpassungs- und integrationsfähige (Gruppen-)Identität in seinen eigenen historisch-politischen Erfahrungen.[62]
Dass aber historische, politische und kulturelle Umstände, unter denen eine Gesellschaft existiert, veränderbar sind und eine Anpassung und totale Integration in jedwede Gesellschaftsform oftmalig nicht wünschenswert sind, berücksichtigt Erikson in seinem Entwicklungsmodell nicht.
Grundsätzlich wird in der aktuellen Identitätsforschung nicht mehr davon ausgegangen, dass in der Jugendphase der Grundstein für das Ge- oder Misslingen von Identitätsbildung gelegt wird. Die Vorstellung, ein gleichbleibender, harmonischer Ich-Zustand könne erreicht und ein Leben lang konstant gehalten werden, ist längst überholt („unitäres Identitäts-Modell“[63] ). „[…]die Vorstellung von einem stabilen, widerspruchsfreien und überdauernden Ich, das sich zeitlebens an einem Lebensentwurf orientiert“, ist heute veraltet, so auch Angela Tillmann.[64] Es bleiben schlichtweg zu viele Fragen offen und zu viele Aspekte werden nicht berücksichtigt.
Ebenfalls wissen wir heute, dass das Konstrukt Identität und die damit einhergehende Identitätsarbeit unmöglich losgelöst von ihren historisch-gesellschaftlichen Rahmenbedingungen betrachtet werden kann. Jugendliche sind im Hinblick auf ihre Entwicklungsaufgaben in strukturellen und kulturellen Rahmen ihrer Zeit und den darin befindlichen Anforderungen und Möglichkeiten gebunden. Identität, so auch Wolfgang Kraus, ist ein Entwicklungsprozess, der eng mit der individuellen historischen Situation des Subjekts verflochten ist. Kraus geht sogar noch einen Schritt weiter mit der Behauptung, Identität würde überhaupt erst zur Aufgabe des Subjekts in einer spezifischen gesellschaftlichen Epoche.[65]
Heute wachsen Jugendliche in einer individualisierten Gesellschaft auf. Die Globalisierung verdrängt traditionelle Sozialformen und Sicherheiten. Prekäre Arbeitsverhältnisse schaffen biografische Unsicherheiten und die Lebensphase Jugend entgrenzt sich zusehends.[66] Bezug nehmend auf Erikson und vor dem Hintergrund der soziologischen Gegenwartsdiagnose, der Individualisierung und der Globalisierung entfernt sich die Forschung heute von normativen unitären Konzepten und konzentriert sich auf „multiple Identitäts-Modelle“[67], die Identitätsarbeit unter individuellen, soziologisch und kulturell gegebenen Bedingungen einbeziehen.
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass Modelle, in denen Identität als permanent kohärentes Ich konstruiert wird, dessen Hauptaufgabe die anerkannte soziale Integration ist, heute nicht mehr dem Stand der Forschung entsprechen.
Das nächste Kapitel gibt Einblick in die neue Identitätsforschung und erläutert exemplarisch für aktuelle Identitätstheorien das Patchwork-Modell Heiner Keupps.
[...]
1 Hurrelmann, Sozialisationstheorie 2006, S. 14.
2 Vgl. ebd., S. 20.
3 Vgl. ebd., S. 16.
4 Vgl. Hurrelmann, Sozialisationstheorie 2006, S. 28.
5 Vgl. ebd., S. 38.
6 Vgl. Keupp, Identitätsarbeit 1997, S. 74.
7 Ebd.
8 Keupp, Identitätsarbeit 1997, S. 68.
9 Hurrelmann, Sozialisationstheorie 2006, S. 175.
10 Ebd.
11 Keupp, Identitätsarbeit 1997, S. 75.
12 Vgl. Keupp, Identitätsarbeit 1997, S. 75.
13 Fritz, Sting, Vollbrecht, Mediensozialisation 2003, S. 7.
14 Vgl. JIM 2011, S. 5.
15 Vgl. Ebd.
16 Vgl. JIM 2011, S. 6.
17 Fritz, Sting, Vollbrecht, Mediensozialisation 2003, S. 7.
18 Vgl. JIM 2011, S. 5.
19 Vgl. Fritz, Sting, Vollbrecht, Mediensozialisation 2003, S. 7.
20 Ebd.
21 Vgl. ebd.
22 Vgl. ebd., S. 9.
23 Fritz, Sting, Vollbrecht, Mediensozialisation 2003, S. 8.
24 Vgl. ebd.
25 Vgl. Tillmann, Identitätsspielraum Internet 2008, S. 80 f.
26 Vgl. ebd., S. 83.
27 Vgl. Fritz, Sting, Vollbrecht, Mediensozialisation 2003, S. 23.
28 Vgl. Keupp, Identitätsarbeit 1997, S. 7.
29 Vgl. ebd, S. 7.
30 Döring, Sozialpsychologie des Internet 2003, S. 332.
31 Vgl. Keupp, Identitätsarbeit 1997, S. 7.
32 www.google.de - http://www.google.de/#hl=de&gs_nf=1&cp=13&gs_id=bm&xhr=t&q=selbstfindung&pf=p&sclient=psyab&oq=selbstfindung&aq=0&aqi=g4&aql=&gs_l=&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&fp=166609642ed9b7d1&biw=1280&bih=707] Stand, 04.06.2012.
33 Greverus, Über die Poesie 2009, S. 241.
34 Ebd.
35 Vgl. Döring, Sozialpsychologie des Internet 2003, S. 325.
36 Keupp, Identitätsarbeit 1997, S. 7.
37 Vgl. ebd., S. 16.
38 Eickelpasch, Rademacher, Identität 2004, S. 6.
39 Ebd., S. 8.
40 Vgl. ebd., S. 16.
41 Ebd., S. 18.
42 Vgl. Beck, Risikogesellschaft 1986.
43 Vgl. Eickelpasch, Rademacher, Identität 2004, S. 17.
44 Ebd., S. 8.
45 Eickelpasch, Rademacher, Identität 2004, S. 8.
46 Ebd.
47 Keupp, Identitätsarbeit 1997, S. 120.
48 Vgl. Keupp, Identitätsarbeit 1997, S. 121.
49 Vgl. ebd. S. 66.
50 Vgl. Erikson, Identität und Lebenszyklus 1966.
51 Vgl. Keupp, Identitätsarbeit 1997, S. 121.
52 Vgl. Keupp, Identitätsarbeit 1997, S. 121.
53 Vgl. ebd., S. 68.
54 Vgl. ebd., S. 70.
55 Vgl. ebd.
56 Vgl. ebd., S. 76.
57 Vgl. Keupp, Identitätsarbeit 1997, S. 77.
58 Vgl. ebd.
59 Vgl. ebd., S. 76
60 Vgl. ebd., S. 77.
61 Ebd.
62 Vgl. ebd., S. 78.
63 Döring, Sozialpsychologie des Internet 2003, S. 326.
64 Vgl. Tillmann, Identitätsspielraum Internet 2008, S. 63.
65 Vgl. ebd.
66 Vgl. ebd., S. 61 f.
67 Döring, Sozialpsychologie des Internet 2003, S. 326.
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Erstausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2012
- ISBN (Paperback)
- 9783955491680
- ISBN (PDF)
- 9783955496685
- Dateigröße
- 1.6 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Universität zu Köln
- Erscheinungsdatum
- 2015 (Februar)
- Note
- 1,3
- Schlagworte
- Identitätsforschung Sozialpsychologie Social Media Digital Natives Medienpädagogik
- Produktsicherheit
- BACHELOR + MASTER Publishing