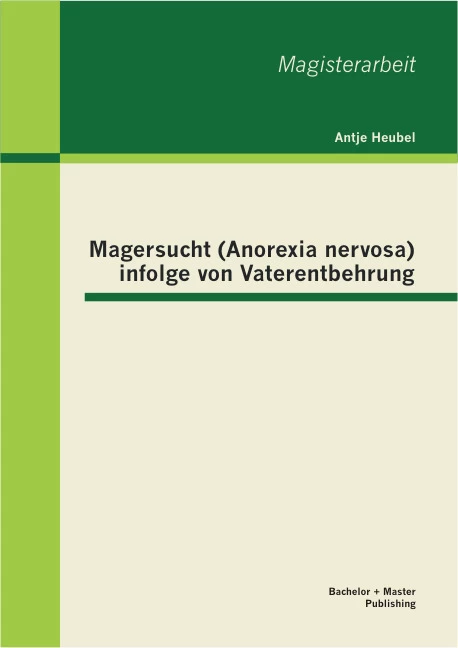Magersucht (Anorexia nervosa) infolge von Vaterentbehrung
Zusammenfassung
Die gewandelten Vorstellungen von Familie allgemein sowie Mutter- und insbesondere Vaterschaft und die damit verbundenen hohen Scheidungs- und Trennungsraten haben eine steigende Anzahl meist vaterlos aufgewachsener Kindergenerationen mit sich gebracht. Diese Vaterlosigkeit wird von den Kindern nicht selten traumatisch erlebt, umso früher sie dieser ausgesetzt worden sind, und hat dementsprechend Konsequenzen. Die Folgen der Vaterentbehrung sind oftmals psychosomatischer Natur und so ist es nicht verwunderlich, wenn die Anzahl der an Essstörungen erkrankten Kinder und Jugendlichen zunimmt.
In dieser Arbeit soll der Zusammenhang zwischen der Vaterentbehrung und der Genese der Magersuchterkrankung dargestellt werden. Allerdings muss erwähnt werden, dass diese spezifische Thematik bisher recht wenig erforscht und der Zusammenhang zwischen der Vaterlosigkeit eines Kindes in den frühen Entwicklungsjahren und der Ausprägung der Magersucht als Resultat dieses Verlustes empirisch kaum belegt ist.
Um sich diesem Thema anzunähern, beabsichtige wird der historische und gesellschaftliche Wandlungsprozess des Vaterbildes aufgezeigt und es werden die Erkenntnisse im Laufe der Vaterforschung dargestellt. Schließlich wird die Bedeutung des Vaters für die Persönlichkeitsentwicklung des Kindes herausgearbeitet. Erst auf dieser Grundlage ist es möglich, das Phänomen der Vaterabwesenheit, welches tatsächlich existiert, zu beschreiben und dessen Folgen zu charakterisieren.
Da auch die Magersucht (Anorexia nervosa) aus den traumatischen frühkindlichen Erlebnissen resultieren kann, werden diese und ihre Historie, weitere Ursachen und Ausprägungen im weiteren Verlauf der Arbeit beschrieben. Abschließend werden insbesondere Heilungschancen dieser schwerwiegenden Erkrankung, die tödlich enden kann, sowie […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
2.3 Wandlungen im psychoanalytischen Verständnis der frühen Vater-Kind-Beziehung
Die Medizinerin und Psychoanalytikerin Britta Heberle hat in ihrem zusammenfassenden Beitrag zum Stand der Vaterforschung gezeigt, dass sich nicht nur das Vaterbild im Laufe der Zeit verändert hat, sondern auch dass das psychoanalytische Verständnis der Vater-Kind-Beziehung nun ein anderes ist und der frühe bzw. präödipale Vater die Fachliteratur erobert hat. Während der ödipale Vater, welcher sinngemäß erst ab der ödipalen Entwicklung des Kindes eine Rolle zu spielen schien, bisher in den meisten Theorien der Vaterforschung analysiert wurde, rückt nun auch zunehmend der präödipale Vater ins Zentrum des psychoanalytischen Forschungsinteresses.
Nach Heberle existieren vier Modelle des präödipalen Vaters, welche dieser nach Möglichkeit alle in sich vereinen sollte. Es kommen ihm damit Funktionen zu, die für die Persönlichkeitsentwicklung des Kindes von enormer Bedeutung sind: „1) der Vater als Befreier und Förderer der Individuation; 2) der 'Vater in der Mutter', d.h. der symbolische, in der Mutter repräsentierte Vater; 3) der dyadische Vater [und, A.H.] 4) der triadische Vater oder der Vater der Mentalisierung“ (Heberle 2006, S. 22).
Der Vater der Progression, also der als Befreier und Förderer der Individuation des Kindes verstandene Vater, ist psychoanalytisch konzeptualisiert. Er hilft dem Kind, sich aus der bestehenden Dyade mit der Mutter zu lösen, ebnet dadurch den Weg zur Triade - der Dreierbeziehung Mutter-Vater-Kind - und fördert die individuelle Entwicklung des Kindes.
Für Freud schien der präödipale Vater unbedeutend, da sich ihm zufolge Dreierbeziehungen erst ab der ödipalen Phase entwickeln können, d.h. etwa ab dem vierten Lebensjahr und mit der Überwindung des Ödipuskomplexes[1]. In der ödipalen Triade wird der Vater wichtiger Repräsentant der Realität, dem die Aufgabe zukommt, die enge Symbiose zwischen Mutter und Kind aufzubrechen.
Die Psychoanalytiker Hans Loewald, Margrit Mahler und Bertram Gosliner haben bereits 1955 eine förderliche Vater-Funktion für die Entwicklung des Kindes betont. Loewald postuliert eine frühe, präödipale positive Beziehung zwischen Vater und Sohn, welche zur Ich-Entwicklung beiträgt, um den späteren Ödipuskomplex zu überwinden. Eine Identifikation der Tochter mit dem Vater wird nicht erwähnt. Mahler und Gosliner weiten diesen Standpunkt für beide Geschlechter aus. Der Vater wird ab dem zweiten Lebensjahr, ab der Übungs-Subphase, für den Ablösungs- und Individuationsprozess für das Kind als wichtig erachtet. Die väterliche Beziehung zum Kind ist weniger stark verflochten wie die Mutter-Kind-Symbiose, so dass der Vater bei der Separation von der Mutter behilflich sein kann (vgl. Heberle 2006, S. 22ff.).
Ernst Abelin, ein Schüler Mahlers, führt diese Beobachtungen weiter und verfasste 1971 sein Konzept zur frühen Triangulierung, welches von unermesslicher Bedeutung für die Vaterforschung ist. Die Beobachtungen der Arbeitsgruppe um Margrit Mahler machen deutlich, dass Kinder bereits in den ersten Lebensmonaten Vater und Mutter unterschiedlich erleben. Der Übergang von der präverbalen zur verbalen Verständigung wird dabei als krisenhaft bezeichnet, da das Kind in einen Konflikt zwischen dem Wunsch nach Autonomie und einem Bedürfnis nach Nähe und Geborgenheit - die es bei der Mutter findet - gerät. Einerseits strebt es nach Selbstständigkeit und will sich aus der engen Beziehung zur Mutter lösen, doch andererseits kann es sich nur schwer vom sicheren „Heimathafen“ (Metzger 2006, S. 316), den die Mutter darstellt, loseisen. Hier kommt nun der Vater ins Spiel; es ist seine Aufgabe das Kind aus diesem Konflikt herauszuführen und ihm die Welt jenseits des „mütterlichen Universums“ (Metzger 2006, S. 316) schmackhaft zu machen und das Kind aus der Mutter-Kind-Dyade in die Mutter-Vater-Kind-Triade zu überführen. Der Vater ist demnach von zentraler Bedeutung für die Ambivalenz während der Wiederannäherungsphase mit der Mutter und „dieses existentielle Dilemma am Beginn der individuellen Menschwerdung kann die Mutter allein kaum jemals befriedigend lösen, so weit ihre Fähigkeit zur Einfühlung und guten Bemutterung auch ausgebildet sein mag“ (Petri 2006, S. 31).
Dem Kind eröffnen sich mit der Triade neue Perspektiven. Es kann bereits sehr früh die Paarbeziehung der Eltern wahrnehmen, sich jeweils mit den Wünschen eines Elternteils identifizieren und damit ein Bündnis gegenüber dem anderen Elternteil eingehen und es nimmt vor allem sich - ausgeschlossen von der Elternbeziehung - wahr. Durch diese Selbstbezogenheit lernt sich das Kind gewissermaßen selbst zu erkennen und realisiert, dass ihm nun zwei Individuen zur Verfügung stehen, ein männlicher sowie ein weiblicher Elternteil. Das Kind kann somit zwei dyadische, voneinander unabhängige Beziehungen zu den jeweiligen Elternteilen aufbauen und eine triadische mit den Eltern zusammen gestalten (vgl. Matzner 1998, S. 35). Dadurch wird die Entwicklung der Selbstrepräsentanz entscheidend geprägt und das Kind kann ein männlich-weibliches Selbst konstruieren (vgl. Petri 2006, S. 32; vgl. Heberle 2006, S. 24).
Diese Triangulierung, die nach Abelin „die intrapsychische Entwicklung von den agierten sensomotorischen Beziehungen hin zu den repräsentierten, symbolischen Beziehungsbildern“ (Heberle 2006, S. 24) darstellt, gelingt nur, wenn die Eltern dazu imstande sind, „sich selbst und den jeweiligen Partner als eine ganze Person anzusehen, mit all ihren positiven und negativen Eigenschaften. [So, A.H.] können diese Individuen eine flexible Partnerschaft formen, die ohne verzerrte gegenseitige Wahrnehmungen auskommt“ (von Klitzing 2002, S. 793).
Demnach setzt der Triangulierungsprozess gewisse triadische Fähigkeiten bei den Eltern voraus. Der Kinder- und Jugendpsychiater Kai von Klitzing geht davon aus, dass diese Fähigkeiten bereits vor der Geburt des Kindes ausgeprägt werden und immer im Zusammenhang mit den vergangenen Beziehungserfahrungen, welche die Eltern in ihrer eigenen Kindheit, vorausgegangen Partnerschaften bzw. in der jetzigen gemacht haben, stehen, und es ermöglichen, das Kind imaginär als eigenständiges Wesen zu betrachten und „in die eigene Beziehungswelt zu integrieren, ohne sich selbst oder den Partner von der Beziehung zum Kind auszuschließen“ (von Klitzing 2002, S. 792). Insbesondere die Mutter trägt entscheidend dazu bei, welchen Platz der Vater im Leben seines Kindes einnehmen kann. Sie muss dazu den „Vater in der Mutter“ (Heberle 2006, S. 22) in sich verinnerlichen, d.h. sie muss den Vater des Kindes und seine Gesetze symbolisch in sich repräsentieren, um das Kind als eigenständiges Drittes zu betrachten und eine Lösung der Verschmelzung zwischen ihr und dem Kind zu ermöglichen (vgl. Heberle 2006, S. 26; vgl. Schon 2006, S. 17f.).
Der Vater als eine reale Bindungsperson des Kindes ist demzufolge wichtig für die Entwicklung zu einer eigenständigen Persönlichkeit und stellt als Förderer der Individuation eine willkommene Alternative zur Symbiose von Mutter und Kind dar. Er ermöglicht die Triade und somit die Mentalisierungsfähigkeit des Kindes, d.h. den Prozess, in dem Menschen realisieren, dass sie alle Wesen mit einem geistig-seelischen Innern sind, das sämtliche (Beziehungs-)Erfahrungen widerspiegelt (vgl. Heberle 2006, S. 34).
Es ist vor allem Dieter Bürgin und Kai von Klitzing zu verdanken, dass sie in ihren Untersuchungen zur Triangulierung belegen konnten, dass bereits vier Monate alte Kinder im Spiel mit ihren Eltern zwischen Vater und Mutter unterscheiden können (vgl. Metzger 2006, S. 318). Das Kind gestaltet die Triade aktiv mit, so dass es früh zwischen Vater und Mutter differenziert bzw. wahrnimmt, dass den Elternteilen unterschiedliche Bedeutungsqualitäten in der Befriedigung seiner Bedürfnisse zukommen. Während die Mutter eher das Bedürfnis nach Nahrung, Schutz, Wärme und Geborgenheit erfüllt, ist der Vater dabei behilflich Explorationsbedürfnisse zu befriedigen sowie motorische Fähigkeiten des Kindes zu fördern. Somit sammeln Kinder von Geburt an unterschiedliche Beziehungserfahrungen mit ihren Müttern und Vätern.
Insbesondere die zahlreichen Untersuchungen zum Spielverhalten der Eltern haben gezeigt, dass die Interaktions- und Versorgungsstile von Müttern und Vätern unterschiedlicher nicht sein könnten. Mütter versuchen sich ihren Kindern kontinuierlich anzupassen, während die Interaktionen zwischen Vätern und ihren Kindern intensiver - vor allem bezüglich des Körperkontaktes - verlaufen. Väter sind eher darauf bedacht, Fähigkeiten des Kindes zu fördern, die für den Umgang mit anderen Personen vonnöten sind. So bieten sie ihnen Spielmodi an, welche dem Kind Regeln und Achtung gegenüber anderen Spielpartnern vermitteln, die motorischen Fähigkeiten des Kindes hervorheben, und konfrontieren sie mit Situationen, die deren Handlungs- und Problemlösekompetenzen unter Beweis stellen bzw. einschlägig fördern und damit zur Selbstständigkeit und Individuation beitragen (vgl. Le Camus 2003, S. 45ff.; vgl. Kindler et al. 2002, S. 709f.). Außerdem differenzieren Väter im Gegensatz zu den Müttern sehr früh und deutlicher nach dem Geschlecht des Kindes. Laut Seiffge-Krenke insbesondere auf den Ebenen der „körperliche[n, A.H.] Entwicklung, [dem, A.H.] Spielverhalten und [der, A.H.] Disziplin“ (Seiffge-Krenke 2001b, S. 392f.).
Die spielerischen Aktivitäten des Vaters im Umgang mit ihren Töchtern sind wesentlich sanfter, weicher und vorsichtiger, während der Umgang mit ihren Söhnen wesentlich körperbetonter, rauer und strenger charakterisiert ist. Das Spiel des Vaters ist aufregend und affektintensiv und trägt dadurch wesentlich zur Affektregulierung des Kindes - insbesondere des Sohnes - bei und „verhelfe dem Kind zu mehr Sicherheit und Freiheit im Umgang mit der eigenen Triebhaftigkeit und mit den Anforderungen der Außenwelt“ (Heberle 2006, S. 30). Die Jungen reagieren mit Begeisterung auf die angebotenen Spielmodi, während die Mädchen eher dazu neigen, die Intensität der Affekte abzuschwächen (vgl. Metzger 2006, S. 318).
Auch bezüglich des geschlechtsrollenspezifischen Verhaltens differenzieren Väter nach Töchtern und Söhnen und tragen somit zur Individuation und Geschlechtsrollenidentifikation des Kindes bei. So betonen sie die Weiblichkeit ihrer Töchter und fördern weibliches Verhalten, indem sie ihnen gegenüber mehr Zuneigung und Nähe vermitteln. Bei ihren Söhnen legen sie weniger Wert auf Emotionalität, aber auf Disziplin, wodurch angemessenes männliches Verhalten vermittelt werden soll (vgl. Seiffge-Krenke 2001a, S. 57). Diese Funktion des Vaters wird für die Tochter insbesondere in der Adoleszenz von Bedeutung: indem sie sich mit ihrem Vater identifiziert und durch seine Bestätigung die männlichen Anteile verinnerlicht, konstruiert sie in sich ein positives Männerbild, was ihre späteren Beziehungserfahrungen beeinflussen wird. Ähnlich ist es auch beim Sohn: durch die Identifizierung mit dem Vater, konstruiert der Sohn seine eigene männliche Identität (vgl. Petri 2000, S. 152; vgl. Petri 2006, S. 41).
Der Vater spielt demnach über die gesamte Sozialisation des Kindes eine bedeutende Rolle und leistet seinen individuellen Beitrag zur Persönlichkeitsentwicklung des Kindes. Zusammenfassend hat er laut Seiffge-Krenke drei zentrale Funktionen:
„1. Er hilft, den Körper des Kindes vom Körper der Mutter zu separieren.
2. Er betont und trainiert Aktivitäten, die eine autonome Entwicklung und Bewegung und effiziente Kontrolle über den Körper erlauben.
3. Er wird eng assoziiert mit dem Erwerb der symbolischen Struktur des Körpers. Dies schließt die Betonung des Geschlechts des Kindes ein.“ (Seiffge-Krenke 2001b, S. 393)
In der frühen Triangulierungsphase legen sie den Grundstein für die Eigenständigkeit des Kindes, indem sie es aus der symbiotischen Beziehung zur Mutter herausführen und nun als eine zweite, männliche Bindungsperson zur Verfügung stehen, mit der sich das Kind verbünden bzw. identifizieren kann. Durch diese Triangulierung nimmt sich das Kind erstmalig als autonomes Wesen wahr.
Der Vater fördert den Erkundungsdrang des Kindes durch aufregende und affektintensive Spielmodi, vermittelt dem Kind die Umwelt durch die Konfrontation mit gesellschaftlichen Werten und Normen und trägt dadurch zur Erweiterung der Problemlösefähigkeiten des Kindes bei. Außerdem wird der Vater dadurch als Vorbild verinnerlicht, dessen Gesetze geachtet werden müssen.
Aber nicht nur in der frühen Kindheit ist der Vater ein einflussreicher Faktor, sondern auch insbesondere beim Übergang von der Kindheit ins Erwachsenenalter. Während Mütter ihre Kinder in der Adoleszenz weitaus unselbstständig wahrnehmen, trauen Väter ihren Kindern wesentlich mehr Unabhängigkeit zu (vgl. Seiffge-Krenke 2001a, S. 57). Der Vater stellt beim Übergang von der Familie ins öffentliche Leben eine wichtige Vorbildfunktion für seine Kinder dar; abhängig davon welche Rollen er ihnen vermittelt hat und wie er seinen Kindern mit Rat und Tat zur Seite steht, können sie die bevorstehenden Entwicklungsaufgaben[2] bewältigen (vgl. Petri 2000, S. 150ff.).
Auch wenn Väter heute noch größtenteils über die Ernährerfunktion in die Familienstruktur eingebunden sind, werden sie nun auch ähnlich der Mütter in einer Doppelrolle betrachtet: zum einen fungieren sie als Interaktionspartner und Sozialisationsfaktor für ihre Kinder und zum anderen als Teil des Familiensystems selbst (vgl. Kreppner 2002, S. 345f.). Eines bleibt dabei aber von zentraler Bedeutung: sie fördern die Autonomie ihres Kindes über alle Altersstufen hinweg. Kinder benötigen für ihre individuelle Entwicklung demnach Beziehungserfahrungen mit beiden Elternteilen.
3. Vaterabwesenheit – Väter rücken zunehmend ins Zentrum des Forschungsinteresses
Im vorhergehenden Kapitel dürfte die historisch gewachsene eminente Bedeutung des Vaters für die Persönlichkeitsentwicklung eines Kindes deutlich geworden sein. Doch welche Folgen sind zu erwarten, wenn ein Kind ohne Vater aufwachsen muss? In diesem Kapitel soll dem Einfluss eines abwesenden Vaters nachgegangen und die möglichen Konsequenzen erörtert werden.
Die Auswirkungen und Unterschiede zwischen anwesenden und abwesenden Müttern auf die kindliche Entwicklung wurden schon frühzeitig durch die „Hospitalismusforschung“[3] und deren Pionieren wie René Spitz, Anna Freud, Dorothy Burlingham sowie John Bowlby belegt (vgl. Petri 2006, S. 26). Während Väter zu Beginn der Vaterforschung - wenn ihnen denn Beachtung geschenkt wurde - noch als defizitär betrachtet worden sind, so rücken sie nun verstärkt ins Zentrum des Forschungsinteresses. Auffällig dabei ist, dass zunehmend der abwesende Vater und daraus resultierende Auswirkungen auf die Persönlichkeitsentwicklung des Kindes, das Familiensystem und die Gesellschaft thematisiert werden.
In der gegenwärtigen Fachliteratur sind die Termini „Vaterlosigkeit“, „Vaterdeprivation“ oder „Vaterabwesenheit“ immer häufiger vertreten. Unter dem Begriff der Vaterlosigkeit ist ganz allgemein „die Erziehung eines Kindes nur durch die Mutter“ (o.V. 2008d) zu verstehen, während die Vaterdeprivation einen Verlust oder Entbehrung dessen darstellt (vgl. o.V. 2008a).
Der deutsche Psychoanalytiker Horst Petri beschreibt diese Begriffe detaillierter:
„Vaterlosigkeit soll hier als ein Zustand definiert werden, in dem das Kind über keinerlei bewußte [!] Erfahrungen mit einem leiblichen Vater verfügt.“ (Petri 2006, S. 56) „Bei der Vaterabwesenheit handelt es sich um eine unbestimmte Form der Vaterentbehrung, die durch ihre zahlreichen Muster eine einheitliche Definition erschwert ... [und, A.H.] für alle Zustände von Vaterentbehrung steht und von der Vaterlosigkeit über den Vaterverlust bis zur ‚berufsbedingten Abwesenheit des Vaters während des Mittagessens’ reicht“ (Petri 2006, S. 71f.).
Die Entbehrung der Väter ist jedoch kein neues Phänomen, sondern schon die Kinder der Kriegs- und Nachkriegszeit wuchsen ohne einen Vater auf (vgl. Franz 2004, S. 22). Aus diesem Grund wurde in den 1950er Jahren auf die Folgen der kriegsbedingten Abwesenheit des Vaters, insbesondere der mangelnden Autorität, hingewiesen (vgl. Le Camus 2006, S.31f.).
Der Schweizer Psychotherapeut Peter Landolf setzt sich bereits 1968 empirisch mit den Konsequenzen der Vaterlosigkeit auseinander und macht die Differenz zwischen einem vaterverwaisten und volleltrigen Kind deutlich (vgl. Walter, H. 2002, S. 19). Er führt die Vaterlosigkeit, welche er einerseits als einen realen Verlust, andererseits allgemein als ein Charakteristikum der Gesellschaft definiert (vgl. Landolf 1968, S. 9f.), auf drei Ursachen zurück: „der Zerfall des Autoritätsbegriffs seit dem Mittelalter“, „die Folge der beiden Weltkriege“ sowie „die moderne Arbeits- und Lebensweise“ (Landolf 1968, S. 9).[4]
Die Vaterabwesenheit ist demzufolge ein gesamtgesellschaftliches Problem und ein Prozess, den das Kind in seiner Persönlichkeitsentwicklung durchläuft, aber:
„eine vaterlose Gesellschaft hat es, selbst unter den Bedingungen eines Matriarchats, zu keiner Zeit gegeben und wird es nicht geben, solange menschliche Gemeinschaften existieren“ (Petri 2006, S. 16).
Jeder Mensch hat, insbesondere biologisch betrachtet, einen Vater und konstruiert innerlich ein Vaterbild, selbst wenn er diesen nie kennen gelernt hat (vgl. Schon 2006, S. 24).
Die Ursachen der Vaterabwesenheit sind vielfältig: Tod bedingt durch Erkrankungen, Unfälle, Kriege oder Suizid; Haftstrafen des Vaters sowie berufliche Gründe. Allerdings stellen zeitweise oder dauerhafte Trennungen und Scheidungen der Eltern heutzutage den Hauptgrund der Vaterabwesenheit dar und haben damit den Tod durch Kriegsereignisse als Auslöser abgelöst (vgl. Erhard/Janig 2003, S. 8; vgl. Petri 2006, S. 25).
Auch im Hinblick auf die steigende Zahl gerichtlicher Ehelösungen wächst das Interesse an der Erforschung der - aus der Vaterabwesenheit resultierenden - Folgen. Immerhin stellt mittlerweile fast jede fünfte Familie eine so genannte Einelternfamilie dar und somit wachsen in etwa drei Millionen Kinder bei nur einem Elternteil auf, wobei der Anteil der Mütter bei ca. 90% liegt. Die Anzahl der Ehescheidungen und die der, in Einelternfamilien aufwachsenden Kinder nimmt stetig zu – mit weiterhin steigender Tendenz (vgl. Franz 2004, S. 23; vgl. VAMV 2007, S. 11).[5] Demnach ist heute davon auszugehen: „Beziehung mündet nicht immer in Ehe, Partnerschaft und Ehe nicht immer in Elternschaft, und Elternschaft sichert weder Ehe noch Partnerschaft“ (Walter, W. 2002, S. 107).
Die genauen Folgen der Vaterabwesenheit sind in Deutschland kaum empirisch erfasst, so dass diese in der Literatur bisher auch nur schemenhaft skizziert worden sind. Die Mannheimer Kohortenstudie zur Epidemiologie psychogener Erkrankungen hat im Langzeitverlauf an der Mannheimer Bevölkerung psychische und psychosomatische Erkrankungen untersucht und kam zu dem Ergebnis, dass die Kriegs- und Nachkriegskindergenerationen, welche in den ersten Lebensjahren durch einen Vatermangel geprägt waren, auch Jahre später deutlich anfälliger für das Auftreten psychischer Störungen sind (vgl. Franz et al. 1999, S. 261; vgl. Franz 2004, S. 22f.). Die Studie und deren Ergebnisse werden nun dargestellt.
3.1 Die Mannheimer Kohortenstudie
Die Mannheimer Kohortenstudie stellt eine psychosomatisch-epidemiologische Langzeitstudie an deutschen Erwachsenen aus Mannheim dar, welche von einer Forschergruppe rund um den deutschen Professor für Psychosomatische Medizin und Psychoanalyse, Heinz Schepank, durchgeführt wurde.
Forschungsschwerpunkt der Studie sind psychogene Erkrankungen. Durch eine Felduntersuchung in der Normalbevölkerung Mannheims sollte die Häufigkeit der Erkrankungen, deren Verlauf und Einflussgrößen sowie deren Verteilung auf die Altersgruppen, Geschlechter und Sozialschichten untersucht werden (vgl. Schepank 1987, S. 1 u. S. 44).
Das Forschungsteam beschränkte sich im Stichprobenumfang auf eine nach Zufall ausgewählte Probandengruppe von 600 Personen, welche sich auf die Altersgruppe der Mitte 20- bis Ende 40-Jährigen verteilt und ebenfalls nur auf die Geburtenjahrgänge 1935, 1945 und 1955 eingeengt wurde. Die Probanden wurden durch fachlich kompetente Interviewer wie Ärzte oder Psychologen mit Hilfe (halb-)standardisierter Methoden in etwa drei Stunden befragt. Da die Studie prospektiv angelegt war, wurden die Zielpersonen in einem Abstand von jeweils drei Jahren nachuntersucht (vgl. Schepank 1987, S. 44ff.).
1976 wurde das Projekt zwecks Finanzierung bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft vorgelegt und konnte im Juli 1978 in die erste Pilotstudie gehen, welche als „Pilot-(A-)Studie“ bezeichnet wird. Von November 1979 bis Dezember 1982 erfolgte die Felduntersuchung der A-Studie und im Frühjahr 1983 eine „Pilot-(B-)Studie. Von April 1983 bis Dezember 1985 widmete sich das Forscherteam der B-Studie, in der alle 600 Probanden der A-Studie nachuntersucht wurden. Drei Jahre später sollte dann die Nachuntersuchung der Probanden innerhalb der C-Studie erfolgen (vgl. Schepank 1987, S. 47).
Der für diese Arbeit relevante Teil der Studie thematisiert die Ergebnisse der ersten dreijährigen Querschnittsuntersuchung, also der A-Studie von 1979 bis 1982. Die Verteilung auf die Geschlechter und die Geburtenjahrgänge zeigt, dass von den 600 Probanden die männlichen Zielpersonen leicht überwiegen: 311 Männer und 289 Frauen.[6] Allerdings ist die Anzahl der Frauen bei den Fallraten signifikant. Von den 600 Probanden wurden 156 Personen (26%) als Fälle eingestuft, von denen 100 weiblich (34,6%) und 56 (18%) männlich sind (vgl. Schepank 1987, S. 111 u. S. 127).
Außerdem wurde durch die Felduntersuchung an der Mannheimer Bevölkerung analysiert, ob ein Zusammenhang zwischen väterlicher Anwesenheit während der ersten Lebens- und damit grundlegender Entwicklungsjahre des Kindes und dem Vorkommen späterer psychogener Störungen besteht bzw. inwiefern frühkindliche traumatische Erfahrung die Genese einer Erkrankung gefördert haben. Als Risikofaktoren wurden hier „a) gravierende äußere Begebenheiten oder Mängel sowie b) Störungen der emotionalen Beziehung zwischen primären Bezugspersonen und heranwachsenden Kindern“ (Schepank 1987, S. 159) angegeben.
Auch wenn nicht zwangsläufig davon auszugehen ist, dass frühkindliche Belastungen eine Erkrankung im späteren Erwachsenenalter zur Folge haben, so ist dennoch auffällig, dass Probanden, die den Kriterien der ICD-Diagnosen[7] 300-306 entsprachen, zu denen auch die Magersucht zählt, häufiger in der frühen Kindheit neurotische Symptome aufwiesen (vgl. Schepank 1987, S. 114).
Die drei zahlreichsten Diagnosen, in Abhängigkeit von der Häufigkeit des Vorkommens, waren Magen-Darm-Probleme (33%), Kopfschmerzen (12%) sowie Essstörungen (11%). Diese Diagnosen wurden wiederum in Relation zur Verteilung auslösender Konfliktsituationen gesetzt, wobei deutlich wurde, dass 18% der psychosomatischen Erkrankungen in Beziehung mit dem realen oder befürchteten Verlust einer vertrauten Bezugsperson stehen. 24% der essgestörten Probanden gaben die Entbehrung einer Beziehungsperson, wie eben den Vater, als auslösende Situation für die Erkrankung an (vgl. Schepank 1987, S. 192 u. S. 193).[8]
Die Mannheimer Kohortenstudie zeigt anhand ihrer Untersuchungen in der Großstadtbevölkerung, dass es einen möglichen Zusammenhang zwischen der Abwesenheit des Vaters während der kindlichen Entwicklung und der späteren Genese einer psychischen Störung gibt bzw. dass das Risiko, an einer solchen zu erkranken, durch frühkindliche Belastungen vielfach höher ist. Auch die Ergebnisse zum Auftreten von Essstörungen macht die Relevanz des anwesenden Vaters für eine positive Persönlichkeitsentwicklung des Kindes deutlich. Diese und weitere mögliche Folgen der Vaterabwesenheit werden nun beschrieben.
3.2 Vaterdeprivation und deren Folgen
Ein Mangel an väterlicher Präsenz in den grundlegenden Entwicklungsjahren eines Kindes führt nicht immer zu einer Beeinträchtigung im späteren Leben. Vielmehr wird das Auftreten der psychogenen Erkrankungen durch eine Kombination von vielfältigen Einflussfaktoren, wie beispielsweise jenen frühkindlichen Belastungen, sozialen und biologischen Faktoren sowie individuellen Persönlichkeitscharakteristika, begünstigt (vgl. Franz et al. 1999, S. 273).
Allerdings ist offensichtlich, dass Väter weniger aktiv an der Entwicklung ihrer Kinder teilhaben. Durch die historische Verlagerung von Privatheit und Öffentlichkeit sowie der außerhäusigen Berufstätigkeit des Vaters und einer damit einhergehenden Wandlung aller Lebens- und Arbeitsbereiche ist der Vater aus dem öffentlichen Leben verdrängt worden.[9] Kinder wachsen heutzutage verstärkt im Rahmen weiblicher Bezugspersonen auf. Dies umfasst die Betreuung in Kindergrippen, Kindergärten und später in den Schulen. Ein Überschuss an weiblicher Präsenz auf den Sozialisationsebenen ist signifikant (vgl. Franz 2004, S. 23).
Aufgrund von zahlreichen Trennungen und Scheidungen der Eltern gedeihen in unserer Gesellschaft vaterlos aufgewachsene Kindergenerationen. Für Petri stellt diese Vaterentbehrung ein primäres Trauma - sowohl für die zurückgebliebenen Kinder als auch deren Mütter - dar. Die Langzeitfolgen des Verlustes fallen unterschiedlich aus und hängen von verschiedenen Einflussfaktoren ab, insbesondere zu welchem Zeitpunkt der Vater entbehrt werden musste, ob dauerhaft bzw. über welchen Zeitraum. Die Wahrscheinlichkeit, dauerhafte Schäden des Verlustes davon zu tragen, ist bei Kindern, welche sehr früh ihren Vater entbehren mussten, wesentlich höher (vgl. Petri 2006, S. 57 u. S. 83).
Im Fall von Trennung oder Scheidung der Eltern erleben Kinder einen, dem Vaterverlust, vorangegangenen Konflikt bewusst mit, dies ist jedoch bei Kindern, die ihren Vater im Zeitrahmen zwischen Schwangerschaft der Mutter und dem 9. Lebensmonat verloren haben, nicht der Fall (vgl. Landolf 1968, S. 12; vgl. Petri 2006, S. 56). Jedoch, auf welche Art und Weise Kinder ihren Vater entbehren müssen, so lebt er in ihren Vorstellungen fort. Sie entwickeln ein imaginäres Vaterbild, welches durch innere Bedürfnisse und Mängel geprägt ist (vgl. Schon 2006, S. 24f.). Ob ein gutes oder böses Vaterobjekt verinnerlicht wird, ist davon abhängig, welche Rolle der Vater in der Restfamilie innehatte und dementsprechend, welches Vaterbild insbesondere die Mutter und andere nahstehende Familienmitglieder dem Kind vermitteln (vgl. Landolf 1968, S. 12f.).
Durch die Vaterabwesenheit verändert sich die gesamte Familienstruktur und jedem einzelnen Familienmitglied kommen neue Bedeutungsqualitäten zu. Bei unzureichender Bewältigung kann die Vaterentbehrung Gefahren in sich bergen und weitreichende Folgen für die Kinder, aber auch für die Mutter nach sich ziehen.
Bekanntermaßen ist der dramatischste und tragischste Effekt, den eine Elterntrennung für ein Kind dieser Beziehung haben kann, der regelrechte Verlust eines Elternteils, und dies bedeutet somit in nahezu allen Fällen eine tief greifende Krise, allein schon deswegen, weil das Trennungskind sich nun einer grundlegend verschiedenen Elternbeziehung gegenübergestellt sieht: es hat nun Vater und Mutter, die sich nicht länger lieben, gegebenenfalls regelrecht zu hassen scheinen. Außerdem führt der Verlust des Vaters in den meisten Familien zu einem finanziellen Einbruch bzw. einer wirtschaftlichen Notlage (vgl. Erhard/Janig 2003, S. 27). Der Mutter wird dadurch eine schwere Last aufgebürdet, sie muss primär die Bedürfnisse der Kinder befriedigen und eigene hinten anstellen. Außerdem sollte sie die Gefühlausbrüche der Kinder wie Wut und Trauer abfedern (vgl. Petri 2000, S. 154). Das einstige Dreieck Vater-Mutter-Kind wird auf eine Dyade Mutter-Kind reduziert, so dass die Mutter von nun an den einzigen Bezugspunkt darstellt, aber die Bindung zwischen Mutter und Kind auch verfestigt wird.
Allerdings birgt dies auch Gefahren in sich, nämlich wenn die Mutter unfähig ist, sich in die (Gemüts-)Lage und dem Leiden ihrer Kinder hineinzuversetzen. Die eigenen Schuldgefühle werden infolge eines Abwehrmechanismus auf den Vater projiziert und rechtfertigen dadurch eine Entwertung seiner Person. Die Kinder werden meist durch die Gefühle der Mutter überfordert, als Lebensersatz sowie als Bündnispartner gegen den Vater missbraucht, was sie nicht selten in einen Loyalitätskonflikt geraten lässt. Die extremste Variante dieser Stigmatisierung des Vaters stellt die Parentifizierung des Kindes dar[10] (vgl. Petri 2000, S. 155; vgl. Petri 2006, S. 95f.).
Bei beiden Geschlechtern kommt es zu einer exzessiven Mutterfixierung, wodurch sich die Tochter stark mit der Mutter identifiziert und eine Ambivalenz gegenüber dem anderen Geschlecht ausprägt, während der Sohn durch die fehlende Identifizierung mit dem Vater an einer Ablösung von der Mutter gehindert wird (vgl. Petri 2006, S. 95). Nicht selten werden dadurch ambivalente Gefühle der Mutter gegenüber gehegt, die es zu unterdrücken gilt, da die Mutter nun als einzige Bezugsperson zur Verfügung steht und auch deren Verlust befürchtet wird. Allerdings erschwert gerade diese starke Symbiose von Mutter und Kind einen späteren Ablösungsprozess sowie den Kontakt zur Außenwelt und ebnet den Weg für spätere, häufig psychosomatische Probleme (vgl. Landolf 1968, S. 17 u. S. 96ff.).
In der Forschung herrscht Einigkeit darüber, dass bei Kindern mit einem Vaterverlust beeinträchtigende psychogene Erkrankungen und Störungen vorkommen. Die Kinder alleinerziehender Mütter[11], sind erheblich in ihrem Selbstwerterleben beeinträchtigt, unsicher im Kontakt zur Außenwelt, neigen zu selbstzerstörerischem und aggressivem Verhalten gegen sich und andere, was in der Ausprägung einer Essstörung Ausdruck findet und in Suizid gipfeln kann. Des Weiteren neigen - durch den Verlust des Vaters - traumatisierte Kinder zu delinquentem Verhalten wie Schulleistungsstörungen, Substanzmittelmissbrauch, Kriminalität verstärkt bei den Jungen sowie Frühschwangerschaften bei den Mädchen (vgl. Petri 2000, S. 157; vgl. Franz 2004, S. 24; vgl. Franz 2005, S. 124).
Die Ausführungen machen deutlich, dass vaterlose Kinder mehr Schwierigkeiten im Sozialverhalten aufweisen als die mit einem Vater. Die Ausprägung der Störungen ist umso größer, je früher ein Vaterverlust erfahren worden ist. All diese Störungen sind das Resultat bisheriger Beziehungserfahrungen, die meist negativen Charakter hatten, und liegen demnach in einem „Misstrauen in die Verlässlichkeit menschlicher Bindungen“ (Petri 2000, S. 157) begründet. Je stabiler der Rückhalt durch die Familie und das soziale Umfeld nach einem solchen Verlust ist, desto eher wird das Trauma der Vaterentbehrung verarbeitet und weitreichende Folgen können vermieden werden.
Insbesondere Geschwister können für die Bewältigung der Vaterentbehrung hilfreich sein. Die Geschwister geben sich durch die Solidargemeinschaft gegenseitig Halt und Nähe sowie Schutz vor einem möglichen elterlichen Machtmissbrauch und können andererseits aber auch die Mutter in ihrem Leiden durch „Verteilung auf mehrere Schultern“ entlasten. Größere Geschwister, insbesondere ältere Brüder, können die Beschützerrolle übernehmen und schlüpfen sukzessive in die Fußstapfen des Vaters, was sich meist stabilisierend auf das gesamte Familiensystem auswirkt (vgl. Petri 2006, S. 98f.).
Bewältigende und heilende Einflussgrößen, wie der familiäre Zusammenhalt, sowie insbesondere Präventionsmaßnahmen sind demnach dringend notwendig, um das Trauma der Vaterentbehrung in seiner Verarbeitung zu erleichtern bzw. möglichst gänzlich einzudämmen (vgl. Petri 2006, S. 83).
[...]
[1] Der Freud’sche Ödipuskomplex, welcher in groben Zügen die Begehrung des gegengeschlechtlichen Elternteils durch das Kind sowie die Betrachtung des gleichgeschlechtlichen Elternteils als Rivalen darstellt, soll hier jedoch nicht weiter von Interesse sein, da der Schwerpunkt der Vaterforschung sowie dieser Arbeit auf dem präödipalen Vater liegt.
[2] Entwicklungsaufgaben stellen im Allgemeinen Entwicklungs- und Sozialisationsziele dar bzw. lassen sich darunter die kulturell und gesellschaftlich vorgegebenen Erwartungen und Anforderungen an die Personen einer bestimmten Altersgruppe zusammenfassen. In der Jugendphase beziehen sie sich im Wesentlichen auf die spätere Zukunft und dienen der Vorbereitung auf die Rolle des Erwachsenen (vgl. Montada 2002, S. 43f.).
[3] Hospitalismus bezeichnet den „Ausdruck, der seit den Arbeiten von René Spitz zur Bezeichnung aller somatischen und psychischen Störungen verwendet wird, die bei Kindern (während der ersten 18 Monate) durch einen verlängerten Aufenthalt in einem Anstaltsmilieu, in dem sie vollständig von ihrer Mutter getrennt sind, hervorgerufen werden“ (Laplanche/Pontalis 2002, S. 176).
[4] Die konkreten Folgen der Vaterabwesenheit, welche u.a. durch Landolf empirisch belegt worden sind, werde ich im Kapitel 3.2 darstellen.
[5] Eine konkrete Übersicht über die Entwicklung der gerichtlichen Ehelösungen und die Zahl der Alleinerziehenden in der Bundesrepublik ist dem Anhang durch die Abbildungen 1 und 2 beigefügt.
[6] Die Verteilung von Geschlecht und Geburtenjahrgang wird im Anhang graphisch durch Abbildung 3 dargestellt.
[7] ICD stellt die Abkürzung für die „International Classification of Disorders“ bzw. die Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme dar, durch deren Hilfe eine international einheitliche Systematik der Krankheiten möglich ist (vgl. o.V. 2008b).
[8] Eine Übersicht über die Häufigkeiten des Auftretens der Erkrankungen ist im Anhang als Abbildung 4 beigefügt, ebenso die Übersicht über die Verteilung der Krankheitsauslöser (Abb. 5).
[9] Die veränderten Vorstellungen von Vaterschaft und die damit verbundenen Wandlungsprozesse wurden bereits in Kapitel 2.1 beschrieben.
[10] Der Begriff des „Parental Alienation Syndrome“ (PAS), welcher 1984 durch den amerikanischen Psychiater Richard Gardner geprägt wurde, stellt die manipulative Entfremdung des Kindes einem Elternteil durch den anderen dar. Häufig wird der zu entfremdende durch den entfremdenden Elternteil dem Kind gegenüber entwertet und denunziert, um eine Unterbindung der Beziehung zu erwirken (vgl. Franz 2005, S. 117).
[11] Ich spreche hier bewusst nur von Müttern, denn diese stellen, wie bereits schon veranschaulicht wurde, den erheblich größeren Anteil der Alleinerziehenden in der Bundesrepublik dar.
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Erstausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2008
- ISBN (Paperback)
- 9783955492076
- ISBN (PDF)
- 9783955497071
- Dateigröße
- 242 KB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover
- Erscheinungsdatum
- 2015 (Februar)
- Note
- 1,8
- Schlagworte
- Magersucht Vater Deprivation Essstörung Vaterrolle
- Produktsicherheit
- BACHELOR + MASTER Publishing