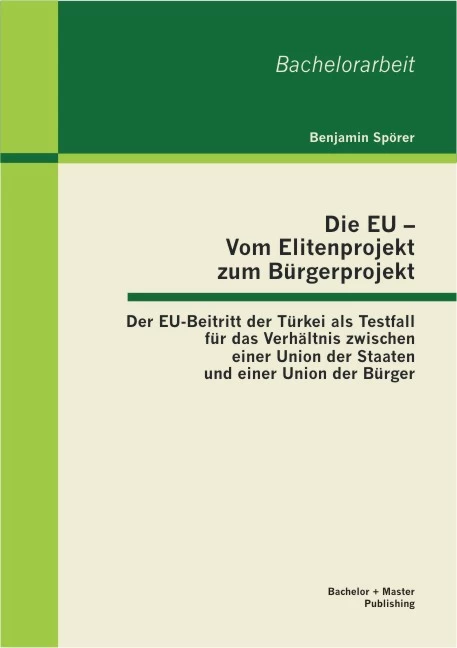Die EU – Vom Elitenprojekt zum Bürgerprojekt: Der EU-Beitritt der Türkei als Testfall für das Verhältnis zwischen einer Union der Staaten und einer Union der Bürger
©2011
Bachelorarbeit
71 Seiten
Zusammenfassung
Es besteht ein breiter Konsens, dass es sich bei der Europäischen Union (EU) um ein Gebilde sui generis handelt. Diese Unbestimmtheit der EU gilt es hier zu hinterfragen und das ambivalente Verhältnis zwischen einer Union der Staaten und einer Union der Bürger anhand des etwaigen EU-Beitritts der Türkei zu untersuchen.
Nachdem zunächst die Eignung des noch anhaltenden Prozesses des EU-Beitritts der Türkei als ein Testfall für die Untersuchung dieses Verhältnisses bestätigt wird, wird im Hauptteil die Frage fokussiert, welche Aussagen dieser Testfall über das Verhältnis ermöglicht.
Ausgehend vom aktuellen Forschungsstand zur politischen Auseinandersetzung rund um den EU-Beitritt der Türkei werden die Forschungsergebnisse für die hier vorliegende Fragestellung weiter verwertet und so der Untersuchungsgegenstand operationalisiert.
Schließlich folgt noch eine wissenschaftlich Einordnung dieses Verhältnisses. Unter Einbezug der Bedeutung des Moments der politischen Entscheidung werden die Ergebnisse in einen größeren Zusammenhang gesetzt. Es wird deutlich, dass sich bei genauerer Betrachtung eine verstärkte Entwicklung hin zu einer Union der Bürger abzeichnet.
Nachdem zunächst die Eignung des noch anhaltenden Prozesses des EU-Beitritts der Türkei als ein Testfall für die Untersuchung dieses Verhältnisses bestätigt wird, wird im Hauptteil die Frage fokussiert, welche Aussagen dieser Testfall über das Verhältnis ermöglicht.
Ausgehend vom aktuellen Forschungsstand zur politischen Auseinandersetzung rund um den EU-Beitritt der Türkei werden die Forschungsergebnisse für die hier vorliegende Fragestellung weiter verwertet und so der Untersuchungsgegenstand operationalisiert.
Schließlich folgt noch eine wissenschaftlich Einordnung dieses Verhältnisses. Unter Einbezug der Bedeutung des Moments der politischen Entscheidung werden die Ergebnisse in einen größeren Zusammenhang gesetzt. Es wird deutlich, dass sich bei genauerer Betrachtung eine verstärkte Entwicklung hin zu einer Union der Bürger abzeichnet.
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
2
Idealtypenbildung bilden, mittels derer der Untersuchungsgegenstand operationalisiert
wird. Nach einer ausgiebigen Analyse der politischen Auseinandersetzung werden die
zentralen Erkenntnisse in einem Zwischenfazit festgehalten.
Der dritte Teil der Arbeit widmet sich letztlich der Frage wie dieses Verhältnis wissen-
schaftlich einzuordnen ist. Dazu wird zunächst auf die Bedeutung der politischen
Entscheidung für das Verhältnis eingegangen, bevor das Verhältnis schließlich in einen
größeren Zusammenhang gesetzt wird. Davon ausgehend werden in der Schluss-
betrachtung die Ergebnisse nochmals kurz skizziert, weiterführende Forschungsansätze
vorgestellt und ein Ausblick hinsichtlich der politischen Entwicklung gegeben.
Als besonders hilfreiche Literaturgrundlage erwiesen sich hier vor allem die Publika-
tionen des Zentrums für Europäische Integrationsforschung (ZEI). Eine Vielzahl von
Wissenschaftlern betreibt unter dem Dach dieses Instituts eine vielseitige und breit
aufgestellte Forschung, welche bei der Bearbeitung eines europapolitischen Themas in
jedem Fall Beachtung finden sollte.
3
I. Ist der EU-Beitritt der Türkei ein Testfall für das Verhältnis
zwischen einer Union der Staaten und einer Union der
Bürger?
1. Die europäische Integration und das Verhältnis zwischen EU,
Mitgliedstaaten und Bürgern
Die europäische Integrationsgeschichte nahm ihre Anfänge bereits im späten 18.
Jahrhundert, doch bedurfte es weiterer eineinhalb Jahrhunderte bis die ersten
substanziellen Grundsteine der EU gelegt wurden.
1
Gezeichnet von zwei Weltkriegen
entstanden in den westeuropäischen Ländern verschiedene Bewegungen, die die Idee
einer europäischen Einigung konkretisierten und verbreiteten. Dabei wurden die
unterschiedlichsten Konzepte einer solchen Einigung entwickelt, welche von einer
primär zwischenstaatlichen Kooperation bis hin zu einer europäischen politischen
Einheit reichten. Ihnen allen gemeinsam war der Wunsch nach einem dauerhaften
Frieden in Europa. Anfang der 1950er Jahre schaffte die Idee einer europäischen
Einigung schließlich Eingang in die Realpolitik. Vorangetrieben von dem französischen
Politiker Robert Schuman entschlossen sich Frankreich, Deutschland, Italien und die
drei Beneluxstaaten durch eine wirtschaftliche Verflechtung zukünftige militärische
Konflikte zu verhindern. Die europäische Integration galt daher lange Zeit in erster
Linie als ein zwischenstaatliches Friedensprojekt, welches mit der Gründung der
Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl erste Formen annahm. In den
Gründungsstaaten wurde jedoch schon bald das Potenzial einer solchen Kooperations-
form erkannt und ambitioniertere Ziele aufgrund unterschiedlicher Motivationen
anvisiert. Nach den gescheiterten Versuchen einer politischen und militärischen
Integration konzentrierte man sich in erster Linie auf die ökonomische Integration (vgl.
Thiemeyer 2010: 71ff). Schon Ende der 1950er Jahre gründeten die genannten Staaten
die Europäische Atomgemeinschaft und die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft
(EWG), mittels derer ein gemeinsamer Markt und damit die wirtschaftliche
Entwicklung der Mitgliedstaaten gefördert werden sollte (vgl. Weidenfeld 2010: 61-66).
1
Eine dezidierte Darstellung des historischen Integrationsprozesses über fast drei Jahrhunderte
hinweg bietet Peter Krüger (2006).
4
In der Präambel des EWG-Vertrages vom 25. März 1957 bekundeten die sechs
Mitgliedstaaten jedoch bereits ihren Willen mit der EWG ,,die Grundlagen für einen
immer engeren Zusammenschluss der europäischen Völker zu schaffen" (Präambel
EWG-Vertrag).
Die EWG entpuppte sich schnell als ein erfolgreicher Integrationsmotor, der durch
,,spill-over-Effekte"
2
die Übertragung weiterer Politikbereiche auf die Gemein-
schaftsebene vorantrieb. Mit der supranationalen Kommission als Exekutivgewalt, dem
intergouvernementalen Ministerrat als Legislativgewalt und einem relativ schwachen
Europäischen Parlament (EP), welches zu Beginn eher eine Art Diskussionsforum
darstellte, entwickelte sich die Gemeinschaft zu einem Erfolgsmodell, welches nach
außen stetig an Attraktivität gewann. Die Innenwirkung war vorerst marginal, schließ-
lich beschränkte sich die europäische Politik zunächst auf wirtschaftliche Politik-
bereiche und war vor allem auf die Binnenmarktintegration beziehungsweise den Abbau
von Handelsbeschränkungen ausgerichtet. Die europäische Integration wurde länder-
übergreifend als ein Projekt gedeutet, das allen Beteiligten wirtschaftliche Vorteile
verschaffe und deswegen kaum öffentlicher Kontrolle unterliegen müsse (vgl.
Weidenfeld 2010: 68-80). Der ausgeprägte Ausbau des Wohlfahrtstaates sowie der
medial und politisch vermittelte wirtschaftliche Mehrwert aufgrund einer Mitgliedschaft
erzeugten seitens der Bürger eine stillschweigende Zustimmung (vgl. Thalmaier 2006:
6). So schritt die europäische Integration stetig voran. Probleme, die zuvor noch auf
nationaler Ebene gelöst wurden, erforderten im Zuge von sozialem, ökonomischem und
ökologischem Wandel mehr und mehr europaweite Lösungsansätze. Zur Kontrolle von
Externalitäten, aber auch zur Wiedererlangung teilweise durch fortschreitende Globali-
sierungs- und Denationalisierungsprozesse verlorener Steuerungskapazitäten, wurden
immer mehr zentrale Politikfelder auf die europäische Ebene verlagert. Um in einer
stetig wachsenden europäischen Gemeinschaft ein Mindestmaß an Handlungsfähigkeit
zu erhalten, wurde in den intergouvernemental organisierten Gemeinschaftsorganen
Schritt für Schritt von dem Einstimmigkeitsprinzip abgerückt und qualifizierte
Mehrheits-entscheidungen eingeführt. Die Schaffung demokratischer Strukturen, die
2
Dieser Begriff wird vor allem von Anhängern der neofunktionalistischen Integrationstheorie
verwendet. Ihnen zufolge kann die Überführung bestimmter Politikbereiche auf die Unionsebene dazu
führen, dass auch in anderen Bereichen sich eine Überführung anbietet oder gar notwendig wird (vgl.
Rosamond 2000: 50-60).
5
den Bürgern einen angemessenen Einfluss auf die Gestaltung europäischer Politik
ermöglichen, blieb indessen hinter dieser Entwicklung zurück (vgl. Thiemeyer 2010:
146-178). Doch spätestens seit dem Vertrag von Maastricht wird der Wandel von
europäischer Staatlichkeit hin zu vielschichtigen Regierungssystemen jenseits des
Nationalstaates aus demokratietheoretischer Perspektive zunehmend als problematisch
angesehen.
Es besteht die Sorge, dass hinter der supranational vollzogenen ökonomischen
Integration die nationalstaatlich verfassten demokratischen Prozesse zurückbleiben
könnten. Um die mit dem Vertrag von Maastricht geschaffene EU stärker zu
demokratisieren und damit zu legitimieren, wurden die Mitwirkungs- und
Mitgestaltungsrechte der einzigen direkt gewählten EU-Institution des EP stetig
ausgebaut (vgl. Weidenfeld 2010: 80-84, 109-116, Kohler-Koch; Conzelmann; Knodt
2004: 195-199).
Der direkte Einfluss der EU-Politik auf das Leben der Bürger wird spätestens seit der
Schaffung des Schengenraums
3
und der Einführung des Euro im Zuge der Wirtschafts-
und Währungsunion für die Menschen immer offensichtlicher. Dabei wird dieser
Einfluss nicht unkritisch gesehen, doch beschränkt sich ihre Partizipation weitestgehend
auf den öffentlichen Diskurs innerhalb der Nationalstaaten, der meist von einer
negativen Berichterstattung ausgelöst wird, während die Wahlbeteiligung zum EP eine
rückläufige Tendenz aufweist. Zunehmend wird erkannt, dass es einer stärkeren
Einbindung der Bürger bedarf um das Integrationsprojekt zu legitimieren und ein
Abwenden ihrerseits zu verhindern. Die Proteste und die gescheiterten Referenden über
den Europäischen Verfassungsvertrag in Frankreich und den Niederlanden im Mai und
Juni 2005 ließen die Problematik des Akzeptanz- und Legitimationsdefizits einer EU als
Elitenprojekt nur allzu deutlich werden (vgl. Oppelland 2010: 81-83, Weidenfeld 2010:
88-94, 112f).
3
Der Schengen-Raum und die entsprechende Zusammenarbeit stützen sich auf das Schengener
Abkommen von 1985. Der Schengen-Raum stellt ein Gebiet dar, in dem der freie Personenverkehr
gewährleistet ist. Die Unterzeichnerstaaten des Abkommens haben alle Binnengrenzen zugunsten einer
einzigen Außengrenze abgeschafft. Um die Sicherheit innerhalb des Schengen-Raums zu gewährleisten
wurden gleichzeitig die Zusammenarbeit und die Koordinierung zwischen den Polizeidiensten und den
Justizbehörden verstärkt. Die Zusammenarbeit im Schengen-Raum wurde durch den Vertrag von
Amsterdam von 1997 in den Rechtsrahmen der EU einbezogen. Allerdings gehören nicht alle Staaten, die
sich an der Schengen-Zusammenarbeit beteiligen, dem Schengen-Raum an (vgl. Weidenfeld 2010: 171-
176).
6
Seit dem Vertrag von Lissabon handelt es sich bei der auf 27 Staaten angewachsenen EU
um einen supranationalen Herrschaftsverband mit der Europäischen Kommission als
oberster Verwaltungsbehörde, dem Rat der EU (Rat) und dem EP als gemeinsamer
Legislative.
4
Durch das Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung und dem der
Subsidiarität, ist das Verhältnis zwischen den Mitgliedstaaten und der Union insofern
klargestellt, als dass der Union keine Kompetenz-Kompetenz zukommt. Sie verfügt nur
über begrenzte, von den Mitgliedstaaten übertragene Kompetenzen, deren Ausübung
wiederum unter der Kontrolle der Mitgliedstaaten steht. Mit der erheblichen Aufwertung
des Europäischen Rates (ER) im Lissabon-Vertrag, erhält das zentrale intergouverne-
mentale Beratungsorgan, in dem die Staats- und Regierungschefs zusammenkommen,
eine Reihe wichtiger institutioneller Befugnisse, die ihm eine Art Führungsfunktion
verleihen. Die mit dieser Aufwertung einhergehende Betonung der Staatenkompetenz
stellte in gewisser Hinsicht den Preis für den weiteren Ausbau demokratischer Strukturen
dar (vgl. Höreth 2010: 184-186, Langenfeld 2008: 14f). Es ist also nicht die Union,
sondern die Mitgliedstaaten, die die Herren der Verträge sind. Sie haben der EU in Gestalt
der Gesamtheit ihrer Mitgliedstaaten und in der Gesamtheit der EU-Bürger die jeweils
im Rat sowie im Europäischen Parlament vertreten sind zwei kollektive Souveräne
verliehen und so der Union eine doppelte Legitimationsbasis beschafft (vgl. Drescher
2010: 61f, Wagner 2010: 135). Folgt man dem Lissabon-Urteil des Bundesverfassungs-
gerichtes, handelt es sich bei der EU um einen Staatenverbund. Damit wird ausgedrückt,
dass die EU in den Bereichen, in denen die Mitgliedstaaten über kein Vetorecht mehr
verfügen, weit über einen Staatenbund hinausgeht. Aufgrund der zahlreichen Bereiche, in
denen es lediglich zwischenstaatliche kooperative Strukturen gibt, jedoch auch keinen
Bundesstaat darstellt (vgl. Oppelland 2010: 79f). Der Begriff, beschreibt eine ,,auf Dauer
angelegte Verbindung souverän bleibender Staaten, die auf vertraglicher Grundlage
öffentliche Gewalt ausübt, deren Grundordnung jedoch allein der Verfügung der
Mitgliedstaaten unterliegt und in der die Völker (...) der Mitgliedstaaten die Subjekte
demokratischer Legitimation bleiben" (BVerfG, 2 BvE 2/08 vom 30.06.2009).
4
Mit dem Vertrag von Lissabon wurde das ordentliche Gesetzgebungsverfahren eingeführt,
innerhalb dessen das EP als gleichberechtigter Gesetzgeber neben dem Rat steht. Doch gilt das
ordentliche Gesetzgebungsverfahren nicht für alle Politikbereiche. So bestehen weiterhin Bereiche in
denen das EP nur eingeschränkt beteiligt wird (vgl. Höreth 2010: 194-197). Für eine umfassende
Darstellung der Ergebnisse des Lissaboner-Vertrages siehe Marchetti; Demesmay (2010).
7
Es wird also deutlich, dass die beiden Legitimationsbasen, Mitgliedstaaten und Bürger,
nicht gleich ausgeprägt sind. Zwar sind die Bürger die Subjekte der demokratischen
Legitimation, diese vollzieht sich jedoch in erster Linie indirekt über die
Mitgliedstaaten. In Anbetracht der Politikfelder, an deren Mitwirkung das EP nicht voll
beteiligt wird, sowie den bestehenden Demokratiedefiziten, bleibt die direkte
Legitimation über das EP hinter der indirekten über die Mitgliedstaaten zurück.
5
2. Union der Staaten und Union der Bürger eine Begriffsbestimmung
Die Frage nach dem Verhältnis zwischen einer Union der Staaten und einer Union der
Bürger setzt eine genauere Begriffsbestimmung dieser beiden Unionen voraus. Die
beiden Begriffe werden hier in erster Linie hinsichtlich ihrer Bezugnahme auf die
Entscheidungsgewalt wie auch hinsichtlich ihrer Legitimationsquellen unterschieden.
Vor dem Hintergrund des europäischen Integrationsprozesses soll der Begriff Union der
Staaten an dem ursprünglichen Wesensgehalt der europäischen Gemeinschaft, welche
ursprünglich ein zwischenstaatliches Friedensprojekt darstellte, anknüpfen. In diesem
Sinne handelt es sich um eine Union, die auf dem Zusammenwirken souveräner Staaten,
repräsentiert durch die jeweiligen Regierungen, basiert und sich auch über diese
legitimiert. Die intergouvernementale Dimension steht hier im Vordergrund. Jegliche
Entscheidungen auf europäischer Ebene müssen im Einvernehmen mit den
Mitgliedstaaten getroffen werden. Ist dies nicht der Fall, so hat jeder Mitgliedstaat das
Recht nationale Interessen geltend zu machen. In diesem Fall kann er die Entscheidung
entweder mit einem Veto blockieren oder sich mittels der konstruktiven Enthaltung der
Betroffenheit entziehen. Auf der Grundlage des Lissabon-Vertrages ist der EU der
Charakter als eine Union der Staaten immer noch weitgehend immanent (vgl. Höreth
2010: 177-193). Wenn im Folgenden also von der Union der Staaten gesprochen wird,
so wird die EU in ihrer intergouvernementalen Dimension gemeint.
5
Aus demokratietheoretischer Perspektive ist eines der Hauptdefizite die Nichtverwirklichung des
demokratischen Gleichheitsgrundsatzes. Aufgrund dessen, dass sich die Größe der mitgliedstaatlichen
Abgeordnetenkontingente im EP nicht proportional an der Bevölkerungsgröße orientieren, sind kleine
Mitgliedstaaten verhältnismäßig überrepräsentiert, während große Mitgliedstaaten unterrepräsentiert sind.
In diesem Zusammenhang lässt sich die Funktion des EP, die europäischen Bürger zu repräsentieren,
durchaus anzweifeln (vgl. Höreth 2010: 196). Für eine dezidierte Auseinandersetzung mit dem
Demokratiegehalt der EU siehe Jared Sonnicksen (2010a).
8
Der Begriff Union der Bürger wird dem der Union der Staaten gegenübergestellt. Er
knüpft an den bereits in der Präambel des EWG-Vertrages bekundeten Willen der
Staats- und Regierungschefs, einen immer engeren Zusammenschluss der europäischen
Völker zu fördern, an (vgl. Präambel EWG-Vertrag). Inklusive dem Lissabon-Vertrag
zielten im Laufe der europäischen Integration verschiedene gemeinschaftspolitische
Maßnahmen auf die Stärkung der Identifikation der Bürger mit dem europäischen
Integrationsprojekt ab. So wurde neben unterschiedlichen Symbolen, wie Fahne und
Hymne
6
, auch die Unionsbürgerschaft eingeführt, welche die nationale Staatsbürger-
schaft zwar nicht ersetzen soll, dieser jedoch zur Seite gestellt wird. Mit der
Unionsbürgerschaft sind weitreichende Rechte verbunden. Zu diesen zählen das Recht
auf Freizügigkeit und Niederlassungsfreiheit innerhalb der EU, das Recht auf
diplomatischen und konsultarischen Schutz, das aktive und passive Wahlrecht bei
Kommunalwahlen und bei den Wahlen zum EP, das Petitionsrecht sowie schließlich die
Grundrechte, die in der Charta der Grundrechte der EU niedergeschrieben sind. Es
zeichnen sich schließlich Bestrebungen ab, analog zur stärkeren Demokratisierung der
EU, welche letztlich in der stetigen Stärkung des EP im Institutionengefüge Ausdruck
findet, einen dafür notwendigen europäischen Demos zu schaffen (vgl. Nielsen-Sikora
2008: 3-8, Wiesner 2007: 66ff). Der Begriff Union der Bürger baut auf diese
Entwicklung auf, führt sie weiter und weist schließlich gewisse Analogien zu
parlamentarischen Demokratiesystemen einiger Nationalstaaten, wie zum Beispiel der
Bundesrepublik Deutschland, auf. In diesen und so auch in einer Union der Bürger wird
die Volkssouveränität als grundlegendes Prinzip der Legitimation demokratisch
politischer Herrschaft über allgemeine, unmittelbare, freie, gleiche und geheime Wahlen
und Abstimmungen sicher gestellt. Das direkt gewählte Parlament, welches das Volk
repräsentiert, stellt die oberste Instanz der Legislative dar, gegenüber welcher die
Regierung verantwortlich ist. Dieses System wird durch die Möglichkeit der
Abstimmung zum Beispiel in Form eines Volksentscheids ergänzt, wodurch die
Entscheidungsgewalt auf das Volk zurückverlagert und ein Höchstmaß an Legitimation
angestrebt wird.
6
Mit dem Scheitern des Verfassungsvertrages durch die Referenden in Frankreich und den
Niederlanden, wurden staatsähnliche Symbole wie Fahne und Hymne zwar wieder aus den Verträgen
gestrichen, doch de facto als solche weiter genutzt.
9
Der Einsatz solcher direktdemokratischer Elemente ist wiederum nicht unumstritten. Die
Frage nach einem erhöhten Demokratiegehalt durch direkt-demokratische Elemente ist
schließlich elementarer Bestandteil einer seit langem anhaltenden Demokratiediskussion,
welche auch in den nationalen Kontexten geführt wird.
7
Ein Einstieg in die
Demokratiediskussion kann jedoch aufgrund des beschränkten Umfangs dieser Arbeit an
dieser Stelle nicht geleistet werden. Es sei aber darauf hingewiesen, dass sich nicht nur die
politischen Systeme der Mitgliedstaaten untereinander hinsichtlich der Existenz
direktdemokratischer Elemente unterscheiden, sondern in dieser Hinsicht auch
Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten und der EU bestehen. Das mit dem Lissabon-
Vertrag eingeführte Bürgerbegehren auf EU-Ebene stellt in diesem Zusammenhang ein
direktdemokratisches Element dar, dass es in dieser Form zum Beispiel in der
Bundesrepublik Deutschland auf Bundesebene nicht gibt (vgl. Sonnicksen 2010a: 149).
Ohne auf die Frage einzugehen, wann und in welchem Ausmaß direktdemokratische
Elemente zum Einsatz kommen sollten, muss die Definition des Begriffs Union der
Bürger in Bezug auf die systemische Ausgestaltung folglich relativ unkonkret bleiben.
Da hier die Unterscheidung zwischen einer Union der Staaten und einer Union der
Bürger in erster Linie anhand der Verortung der Entscheidungsgewalt wie auch
hinsichtlich ihrer Legitimationsquellen unterschieden werden, soll eine Union der
Bürger in dieser Arbeit mit einem demokratischen System assoziiert werden, welches
die Bürger maximal einbezieht, die Entscheidungsgewalt grundsätzlich bei dem direkt
gewählten Parlament verortet und sie bei schwerwiegenden Fragen auf die Bürger
zurückverlagert und somit schließlich ein Höchstmaß an Legitimation erhält (vgl.
Nielsen-Sikora 2008: 7f). Der Begriff beinhaltet indessen auch die Existenz eines für
eine solche Demokratie notwendigen Demos, welcher jedoch weitaus mehr als eine
Konzeption einer Unionsbürgerschaft, wie sie oben ausgeführt wurde, beinhaltet. Als
grundlegende Charakteristika eines solchen Demos werden auch die Existenz einer
gemeinsamen Identität sowie einer europäischen Öffentlichkeit, innerhalb derer die
Konstitution integrierter Selbstverständigungsdikurse ein wesentliches Merkmal
öffentlicher Kommunikation darstellen und entscheidend zur Legitimation der
politischen Gemeinschaft beitragen, genannt (vgl. Wiesner 2007: 15-20).
7
Einen umfassenden Einblick in die derartige Demokratiediskussion bietet Günther Rüther
(1996).
10
Seit dem Vertrag von Maastricht wurde die EU in ihrer Eigenschaft als eine Union der
Bürger stetig weiter ausgebaut und erreichte mit dem Lissabon-Vertrag einen
Entwicklungsstand, der durchaus zulässt die EU heute ansatzweise auch als eine Union
der Bürger zu charakterisieren. Wenn im Folgenden von einer Union der Bürger
gesprochen wird, so ist damit der gegenwärtige Entwicklungsstand der EU in dieser
Dimension gemeint sowie die hier beschriebene Assoziation als Entwicklungsziel.
3. Die Kopenhagener Kriterien und der Erweiterungsprozess der EU
Nach dem Artikel 49 Lissabon-Vertrag (EUV-L) kann jeder europäische Staat der die in
Artikel 2 EUV-L festgelegten Grundsätze achtet, die Mitgliedschaft der EU beantragen.
Das Beitrittsangebot ist demnach grundsätzlich auf europäische Staaten beschränkt. Was
,,europäische" genau bedeutet ist indessen nicht eindeutig festgelegt. Eine rein
geographische Betrachtung ist aufgrund der Zugehörigkeit Europas zur eurasischen
Kontinentalplatte, wodurch es an einer natürlichen geographischen Grenze gen Osten
fehlt, nicht ausreichend (vgl. Steinbach 2006: 2-4). Die Entscheidung, ob ein Staat als
europäisch gilt, fällt damit in den nicht evidenten Fällen letztlich auf der politischen
Ebene. Obwohl in der Regel einem Beitrittsgesuch eines Staates enge bilaterale
Beziehungen zur EU vorausgehen, wird erst mit dem vorgelegten Beitrittsantrag beim
Rat eine Reihe von EU-Beurteilungsverfahren in Gang gesetzt, die darüber entscheiden
ob ein Beitritt in Frage kommt. Neben dem EP werden auch die nationalen Parlamente
der Mitgliedstaaten über diesen Antrag unterrichtet. Auf Vorschlag der Kommission und
nach Einigung des ER verleiht der Rat durch einen einstimmigen Beschluss dem
Beitrittsbewerber den Kandidatenstatus.
Grundsätzlich ist der Beitritt zur EU an die hinreichende Erfüllung der Kopenhagener
Kriterien
8
durch den Beitrittsaspiranten geknüpft. Ob diese Kriterien bereits zum
8
Die Kopenhagener Kriterien wurden von dem ER 1993 auf dem EU-Gipfel in Kopenhagen in
Vorbereitung auf die anstehende Osterweiterung beschlossen. Es handelt sich dabei um einen
Kriterienkatalog den ein Bewerberland erfüllen muss bevor es der EU beitreten kann. Dieser wurde im
Laufe der Zeit stetig weiter entwickelt. Neben politischen und wirtschaftlichen Kriterien muss der
Beitrittskandidat vor allem die Fähigkeit haben, den ,,acquis communautaire" (gemeinschaftlicher
Besitzstand) komplett zu übernehmen. Des Weiteren muss aber auch das Kriterium der
Aufnahmefähigkeit der EU erfüllt sein, welches besagt, dass die Union mit einer Erweiterung nicht ihre
Fähigkeit, die Stoßkraft der europäischen Integration zu erhalten, verlieren darf. Dieses Kriterium ist im
Gegensatz zu den vorherigen keine von dem Beitrittsaspiranten zu erfüllende Bedingung, sondern ist eine
innenpolitische Angelegenheit der EU (vgl. Isak 2006: 353-356).
11
Zeitpunkt des Beitrittsantrages, bei der Aufnahme der Beitrittsverhandlungen oder erst
zum Zeitpunkt des Beitritts erfüllt sein müssen, ist nicht ganz eindeutig. Hinsichtlich
vergangener Erweiterungen wurde die Umsetzung der wirtschaftlichen Kriterien, die in
erster Linie auf eine funktionsfähige Marktwirtschaft abzielen, die dem Wettbewerb und
den Marktkräften in der Union standhalten kann, erst für den konkreten Beitritt als
notwendig angesehen. Wie die Vereinbarungen von Übergangsfristen in sämtlichen
Beitrittsverträgen zeigen, muss auch die Übernahme des gemeinschaftlichen
Besitzstandes zum Zeitpunkt des Beitritts nicht zwingend vollendet sein. Anderes gilt
jedoch für die politischen Kriterien, die sich in Artikel 2 EUV-L wiederfinden. Die dort
festgelegten Grundsätze stellen den gemeinsamen Wertekanon dar, auf den sich die EU
gründet. Dieser lässt sich mit den Begriffen Freiheit, Demokratie, Menschenrechte und
Rechtsstaatlichkeit zusammenfassen. Als Kriterien fordern sie von dem Beitritts-
kandidaten institutionelle Stabilität als Garantie für eine demokratische und
rechtsstaatliche Ordnung, innerhalb derer die Wahrung der Menschenrechte sowie die
Achtung und der Schutz von Minderheiten gewährleistet werden (vgl. Isak 2006: 353-
356). Offiziell ist die Erfüllung der politischen Kriterien Voraussetzung für die
Aufnahme von Beitrittsverhandlungen, doch handelt es sich dabei um politische
Bewertungen, die sich einer objektiven Überprüfung entziehen. In Anbetracht der
bisherigen politischen Praxis kann aber festgehalten werden, dass zur Aufnahme von
Verhandlungen die volle Erfüllung der politischen Kriterien spätestens zum Zeitpunkt
des Beitritts erwartet werden können muss (vgl. Langenfeld 2008: 5, Kohler-Koch;
Conzelmann; Knodt 2004: 302-316).
Die Feststellung der Erweiterungsfähigkeit beziehungsweise der Integrationsfähigkeit
lässt sich wiederum zeitlich nicht konkret verorten. In der Vergangenheit kam
wiederholt erst durch den Druck anstehender Erweiterungen der notwendige politische
Wille zu essentiellen Reformen zustande, wodurch die EU erweiterungsfähig wurde.
Letztlich stellt sich die Frage aufgrund der teilweise langwierigen Beitrittsverhand-
lungen erst beim Beitritt selber (vgl. Wessels 2008: 446-448, Lippert 2004: 31-37).
Erfüllt der Beitrittskandidat die für die Eröffnung der Beitrittsverhandlungen
notwendigen Kriterien, so erteilt der Rat, durch einen einstimmigen Beschluss, der
Kommission das Verhandlungsmandat. Die Verhandlungen werden zwischen dem
Kommissar für Erweiterung und dem Bewerberland geführt. Verhandelt wird nicht über
12
den ,,acquis communautaire" selber, sondern vor allem über den Zeitplan und die
genauen Bedingungen für dessen Einführung. Dafür wird der ,,acquis" in 35 Kapitel
unterteilt. Die Eröffnung der eigentlichen Verhandlung erfolgt für jedes einzelne Kapitel
durch einen einstimmigen Ratsbeschluss. Während der Verhandlungen kontrolliert die
Kommission im Rahmen ihres Monitoring die Reformfortschritte des Bewerberlandes
und informiert die anderen EU-Organe mittels ihrer Fortschrittsberichte über den Stand
der Verhandlungen. Der Abschluss eines Kapitels erfolgt auf Vorschlag der Kommission
und ebenfalls durch einen einstimmigen Beschluss des Rates. Sind die Verhandlungen
aller 35 Kapitel abgeschlossen, wird der Beitrittsvertrag aufgesetzt, welcher wiederum
durch einen einstimmigen Beschluss des Rates und unter der Zustimmung des EP
verabschiedet wird. Anschließend wird er von den Vertretern der EU-Mitgliedstaaten
und des Beitrittskandidaten unterzeichnet und gemäß ihrer verfassungsrechtlichen
Vorschriften ratifiziert (vgl. Art. 49 EUV-L). Diese Ratifikation erfordert in einigen
Mitgliedstaaten lediglich einen Parlamentsbeschluss, während in anderen Mitglied-
staaten eine solche Entscheidung eines Referendums bedarf oder ein Referendum
ermöglicht (vgl. Wessels 2008: 450-453, Aybey; Öztürk 2005: 1f).
Es wird deutlich, dass der Erweiterungsprozess vor allem in den Händen des Rates, also
der Mitgliedstaaten liegt, während das EP oder die nationalen Parlamente vergleichsweise
geringfügig mit einbezogen werden. Dennoch wird der EU-Beitritt eines Staates,
aufgrund der Folgewirkungen und der Vertragsänderungen, als eine solch schwer-
wiegende Entscheidung wahrgenommen, dass letztlich ein Höchstmaß an Legitimation
angestrebt wird. Diese vollzieht sich einmal über die Repräsentanten der Mitgliedstaaten
im Rat und im ER, über die Repräsentanten der Bürger im EP und schließlich teils über
die Repräsentanten der Bürger in den nationalen Parlamenten oder über die Bürger selber
in Form eines Referendums. Der Erweiterungsprozess ist demnach ein von der Union der
Staaten vorangetriebener und kontrollierter Prozess, in dem die Bürger lediglich bei der
Ratifizierung des Ergebnisses direkt mit einbezogen werden.
Im Folgenden wird nun der Weg der Türkei in die EU genauer betrachtet und
abschließend geprüft, ob es sich beim EU-Beitritt der Türkei um einen geeigneten
Testfall für die hier vorliegende Fragestellung handelt.
13
4. Der Weg der Türkei in die EU
Seit dem Zusammenbruch des Osmanischen Reiches und der Ausrufung der Türkischen
Republik durch Kemal Atatürk 1923 war die Westorientierung zentraler Bestandteil der
türkischen Staatspolitik. Die Türkei gehört zu den Gründungsmitgliedern der 1945
gegründeten Vereinten Nationen, trat 1948 der Organisation für europäische
wirtschaftliche Zusammenarbeit (OEEC), 1949 dem Europarat und 1952 der NATO bei.
Bereits im Juli 1959 bewarb sich die Türkei um die Mitgliedschaft der erst ein Jahr
zuvor entstandenen EWG. Doch aufgrund politischer Differenzen zwischen den
Mitgliedstaaten, dem Militärputsch vom 27.05.1960 und seinen unmittelbaren Folgen in
der Türkei sowie bestehenden Unsicherheiten und Meinungsverschiedenheiten in der
noch jungen Ausformung der europäischen Integration, zogen sich die Verhandlungen
über mehrere Jahre hin. Das Ergebnis war schließlich der Abschluss eines Assoziations-
vertrages, auch Ankara-Abkommen genannt, zwischen der EWG und der Türkei am
12.09.1963 in Ankara. Dabei erklärte der damalige Präsident der EWG-Kommission
Walter Hallstein, die Türkei sei ein Teil Europas und solle bei Zeiten voll berechtigtes
Mitglied der Gemeinschaft werden.
9
Im Ankara-Abkommen heißt es in Artikel 28, der Türkei wird die mögliche Prüfung eines
Beitritts zur EWG in Aussicht gestellt (vgl. Kramer; Reinkowski 2008: 154-158, Steinbach
2006: 382f). Weitere Abkommen folgten in den 1970er Jahren, darunter das Zusatzprotokoll
zum Assoziationsabkommen vom 23.11.1970, mit welchem über die Errichtung einer
schrittweisen Zollunion langfristig die Voraussetzungen für einen Beitritt geschaffen werden
sollten. In der Folgezeit bis Mitte der 1990er Jahre gerieten die Beitrittsbemühungen, nicht
zuletzt wegen der Zypernfrage
10
und der wiederholten Machtübernahme des türkischen
Militärs am 12.9.1980 ins Stocken (vgl. Seeger 2008: 89f).
9
Heinz Kramer und Marius Reinkowski verweisen in diesem Zusammenhang auf den historischen
Kontext. Denn ,,in jener Zeit [verstanden] Personen wie Hallstein unter Europa natürlich nur das freie
Europa (...), das [in Abgrenzung zum kommunistischen Machtbereich] ein fester Teil der westlichen
Allianz war und hier gehörte die Türkei selbstverständlich dazu"(Kramer; Reinkowski 2008: 156).
10
Die Zypernfrage beinhaltet einen Konflikt zwischen griechischen Zyprioten und türkischen
Zyprioten über die Staatsgewalt auf Zypern. In seinem Verlauf kam es unter Einmischung Griechenlands
und der Türkei zu einer Trennung der Insel zwischen einem türkisch-zypriotischen Norden und einem
griechisch-zypriotischen Süden.
14
Zu parlamentarischen Verhältnissen zurückgekehrt stellte die neu gewählte Regierung
unter Ministerpräsident Turgut Özal am 14.4.1987 erneut einen offiziellen Antrag auf
eine Mitgliedschaft in der europäischen Gemeinschaft. Dieser wurde jedoch von der
damaligen Kommission am 18.12.1989 abgelehnt. Sie stellte zwar die grundsätzliche
Beitrittsfähigkeit der Türkei nicht in Frage, ließ aber auch keinen Zweifel daran, dass
das Land weder politisch noch wirtschaftlich für eine Mitgliedschaft in der EG reif sei.
Man entschloss sich jedoch auf Grundlage des Ankara-Abkommens, die Beziehungen
mit neuem Leben zu füllen. Die Verwirklichung der Zollunion bot sich hierfür als kein
leichter aber praktikabler Schritt an. Ein gewaltiger türkischer Kraftakt machte es
schließlich möglich, dass der Assoziierungsrat EU-Türkei
11
am 6. März 1995 die
Zollunion beschließen konnte. Nach einer Ratifizierung noch im gleichen Jahr, trat diese
am 1. Januar 1996 in Kraft. Mit der Zollunion wurde eine Wirtschaftsbeziehung
etabliert, wie es sie zwischen der EU und keinem anderen Beitrittskandidaten gegeben
hat (vgl. Steinbach 2006: 385-387).
Obwohl der Assoziierungsrat EU-Türkei am 29. April 1997 feststellte, dass die Türkei
grundsätzlich für eine Mitgliedschaft in Frage komme, wurde sie vom ER in Luxemburg
im Dezember 1997 unmissverständlich von der nächsten Erweiterungsrunde
ausgeschlossen (vgl. Seeger 2008: 90f). Während mit zehn ehemaligen kommunistischen
Staaten Mittel- und Osteuropas sowie mit dem gespaltenen Zypern Beitrittsverhandlungen
aufgenommen wurden, bot man dem NATO-Partner Türkei ein Europa-Abkommen an,
mit dem der Prozess der Vorbereitung auf einen späteren Beitritt weiter vorangetrieben
werden sollte. Dieser Schritt wurde seitens der Türkei als eine ungerechte
Benachteiligung wahrgenommen und markierte einen erneuten Tiefpunkt der europäisch-
türkischen Beziehungen (vgl. Kramer; Reinkowski 2008: 164f, Madeker 2008: 24-26).
Nachdem sich jedoch vor allem die italienische und die 1998 neu ins Amt gewählte
deutsche Regierung unter Gerhard Schröder für einen türkischen Beitritt stark
machten, vergab der ER in Helsinki im Dezember 1999 der Türkei den offiziellen
Status eines Beitrittskandidaten.
12
Wiederholt wurde betont, dass für die Türkei wie
11
Der Assoziierungsrat EU-Türkei wurde im Zuge des Ankara-Abkommens ins Leben gerufen.
12
Das Umschwenken der EU von Luxemburg nach Helsinki hatte weniger mit Veränderungen
innerhalb der Türkei zu tun als mit der sicherheitspolitischen Einschätzung. So stand der ER in Helsinki
unter massiven Druck der USA, die den EU-Beitritt der Türkei aus geostrategischen Gründen
baldmöglichst vollzogen sehen wollte (vgl. Madeker 2008: 27).
15
auch für die anderen Beitrittskandidaten allein die Kopenhagener Kriterien gelten
sollten.
Die Überprüfung der Erfüllung und Einhaltung der Kriterien obliegt der Kommission,
die jährlich einen Bericht über die Fortschritte der Türkei auf dem Weg zum Beitritt
vorlegt. Zur Unterstützung der türkischen Reformanstrengungen wurde 2000 auf der
Nizza-Gipfelkonferenz eine sogenannte Beitrittspartnerschaft beschlossen, mittels derer
Ziele und Prioritäten festgelegt werden um die Kopenhagener Kriterien schneller zu
erfüllen. Wesentliche Forderungen an die Türkei waren bisher die Achtung und der
Schutz kultureller Minderheiten, eine Reformierung des Justizwesens, eine
Verbesserung des Rechtsschutzes sowie die Garantie sozialer, politischer, kultureller,
und wirtschaftlicher Rechte für alle Bürger.
Bereits im März 2001 präsentierte die Türkei ein Programm zur Übernahme des
,,acquis", welches den weiteren Fahrplan für den Reformprozess festlegte. Auch die
seit November 2002 amtierende Regierung, gestellt von der AKP (Partei für
Gerechtigkeit und Aufschwung), antwortete auf die Entscheidung des EU-Gipfels in
Nizza trotz anderslautender Befürchtungen um die islamische Herkunft der Partei, mit
der Verabschiedung weiterer Reformpakete und erklärte die Vollmitgliedschaft der
Türkei in der EU als oberstes außenpolitisches Ziel (vgl. Giannakopoulos; Maras
2005b: 32f).
Bis Ende 2004 verabschiedete das türkische Parlament umfassende Reformpakete die
den Erwartungen der EU in punkto Demokratisierung in starkem Maße entgegenkamen.
Die Kommission bescheinigte der Türkei bereits im Oktober 2002 erhebliche
Fortschritte hinsichtlich der Erfüllung der Kopenhagener Kriterien (vgl. Kramer;
Reinkowski 2008: 165-167, Wimmel 2006: 98). Auf Drängen der Türkei sollte der ER
in Kopenhagen im Dezember 2002 nun auch verbindlich über den Beginn von
Beitrittsverhandlungen entscheiden. Doch trotz der Anerkennung der beachtlichen
Fortschritte, sah die Kommission eine verbindliche Zusage an die Türkei als verfrüht an,
da immer noch einige schwerwiegende Defizite hinsichtlich der Garantie der
Grundfreiheiten, der Sicherstellung der zivilen Kontrolle über das Militär und bei der
faktischen Abschaffung der Folter bestanden. Die Staats- und Regierungschefs
verständigten sich schließlich aufgrund dieser Vorgaben auf den deutsch-französischen
Vorschlag diese Entscheidung auf den EU-Gipfel im Dezember 2004 zu vertagen. Wenn
16
laut Kommission die Kriterien bis dahin erfüllt sein sollten, könnten die Verhandlungen
ohne Verzug beginnen.
Im Vorfeld der Gipfelkonferenz in Brüssel im Dezember 2004 attestierte die
Kommission der Türkei schließlich die politischen Kriterien in ausreichendem Maße
erfüllt zu haben und empfahl dem ER die Aufnahme von Verhandlungen (vgl. Kramer;
Reinkowski 2008: 69f).
13
Dieser beschloss daraufhin, trotz einiger Turbulenzen um die
diplomatische Anerkennung der Republik Zypern durch die Türkei, einstimmig die
Verhandlungen am 3. Oktober 2005 zu beginnen. In dem Abschlussdokument wird der
Beitritt als gemeinsames Ziel genannt, gleichzeitig jedoch auch betont, dass die
Verhandlungen ein Prozess mit offenem Ende seien (vgl. Ermagan 2010a: 273). Auf
einem Sondergipfel der EU-Außenminister am 3. Oktober 2005 wurde das
Verhandlungsmandat nach einem gescheiterten Antrag der österreichischen
Außenministerin Ursula Plassnik (ÖVP) eine privilegierte Partnerschaft als alternatives
Verhandlungsziel vertraglich festzulegen, endgültig beschlossen (vgl. Wimmel 2006:
98-100).
Während die vorherigen Entscheidungen zur Annäherung der Türkei an die EU
einschließlich der Helsinki Konferenz 1999 auf der der Türkei der Status eines
Beitrittskandidaten verliehen wurde noch ohne großes öffentliches Aufsehen
verabschiedet wurde, änderte sich dieser Umstand mit der Kopenhagener
Regierungskonferenz vom Dezember 2002 schlagartig. Obwohl auf dieser Konferenz
eigentlich die Rahmenbedingungen der Osterweiterung beschlossen wurden, standen die
Konferenz und auch die parallel geführte öffentliche Debatte ganz im Schatten der
Türkei-Frage (vgl. Wimmel 2006: 100).
Diese öffentliche Debatte über den EU-Beitritt der Türkei entwickelte sich schließlich
zu einer hitzigen Auseinandersetzung, innerhalb derer ein Geflecht von Problemfeldern
angesprochen werden, die an den grundsätzlichen Fragen nach der Idee, dem Sinn und
dem Ziel der europäischen Integration rütteln. Dabei zeichnet sich eine zunehmend
13
Die Kommission nannte in ihrer Empfehlung jedoch eine Reihe weiterführender Überlegungen
und Bedingungen für die Verhandlungen, die in dieser Form mit Blick auf Beitrittsverhandlungen
einmalig waren. Dazu gehörten die Erwägung von dauerhaften Schutzklauseln in sensitiven Bereichen
wie der Freizügigkeit, die indirekte Nennung eines zeitlichen Verhandlungsrahmens von mindestens 10
Jahren, der aus finanziellen Gründen nicht unterschritten werden sollte oder auch die Möglichkeit die
Verhandlungen bei schwereren türkischen Verstößen gegen die Wertgrundlagen der EU auszusetzen (vgl.
Kramer; Reinkowski 2008: 170).
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Erstausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2011
- ISBN (Paperback)
- 9783955492465
- ISBN (PDF)
- 9783955497460
- Dateigröße
- 339 KB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn
- Erscheinungsdatum
- 2015 (Februar)
- Note
- 1,3
- Schlagworte
- Europäische Integration Europäische Öffentlichkeit Demokratie Zivilgesellschaft Identität EU-Erweiterung
- Produktsicherheit
- BACHELOR + MASTER Publishing