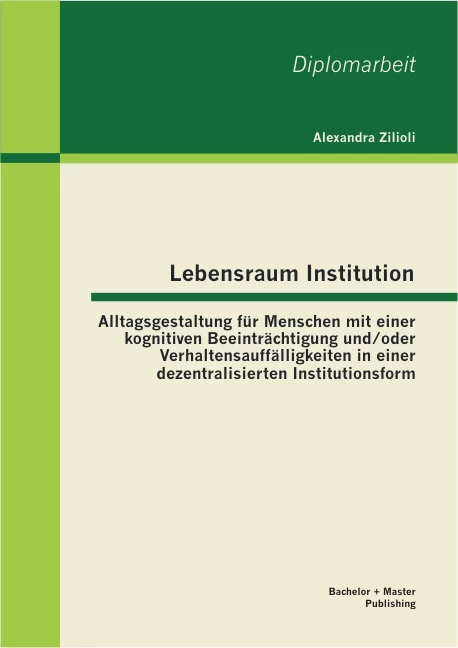Lebensraum Institution: Alltagsgestaltung für Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung und/oder Verhaltensauffälligkeiten in einer dezentralisierten Institutionsform
Zusammenfassung
In diesem Fachbuch werden Erklärungssätze über die Entstehung von Verhaltensauffälligkeit und ‘Behinderung’ beschrieben. Es wird gezeigt wie die Aufgabe von Fachleuten aussehen kann, die Gesellschaft zu sensibilisieren und dadurch eine zeitgemäße Wohnform zu ermöglichen, die den Menschen mehr Lebensqualität bringt und ihnen die Chance auf eine gesellschaftliche Integration bis zur Inklusion bietet.
Der ‘Lebensraum Institution’ wird anhand eines Beispiels aus der Praxis über eine dezentrale Wohnform dargestellt und die Alltagsgestaltung in den jeweiligen Bereichen (Wohnen/ Arbeit/ Freizeit) verdeutlicht.
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
2.6 Organisationsprinzipien:
Prinzip: Dezentralisation
Die Geschäftsführung führt die dezentralen Einheiten im Sinne einer Holdinggesellschaft. Der Chupferhammer ist dort, wo die Menschen mit Behinderung und ihre Betreuenden sind.
Der Verein hat seine Einheiten nicht in einem Dorf oder Ortschaft, sondern jede Einheit ist in einem andren Dorf, verteilt auf vier Kantone untergebracht. (vgl. siehe im Anhang „Konzeption“
Prinzip: Führen durch Delegieren
Die Wohneinheiten und die Abteilungen werden durch deren Leitung mit den benötigten Kompetenzen ausgestattet. Keine Leitungsebene fällt Entscheide, die ohne Schaden für die Gesamtorganisation nicht auf der hierarchisch nächst unteren Stufe gefällt werden können. Dieses Prinzip muss sich bis auf die konkrete Begleitung der Nutzerinnen und Nutzer erstrecken. Für Einheiten heißt dies, dass sie das Budget und den zugeteilten Stellenplan selbstverantwortlich einsetzen können. Die Einheiten und Abteilung sind kleine Institutionen, die Teil eines Institutionsverbundes sind. Verschiedene Lösungen und Lösungswege sind nicht nur toleriert, sondern erwünscht.
Die individuellen Wünsche und Bedürfnisse der Bewohnenden und der Mitarbeitenden in der Werkstatt ist zu berücksichtigen und ernst zu nehmen. (vgl. ebd.)
Prinzip: Globalbudgets
Jede Wohneinheit und Abteilung budgetiert jährlich für ihren Bereich. Anlässlich einer gemeinsamen Sitzung wird das Budget diskutiert und durch die Geschäftsführung festgelegt. Der Vorstand entscheidet dann über Budget und Gesamtrechnung des Vereins.
Die Trägerschaft handelt mit den Standortkantonen St.Gallen, Appenzell Ausserrhoden, Thurgau und Zürich Leistungsvereinbarungen aus, die den Handlungsspielraum definieren. (vgl. ebd)
Prinzip: Lean Management
„Der betriebliche Überbau besteht aus der Geschäftsführung sowie der teilzeitlichen Assistenz der Geschäftsführung, der Bereichsleitung Wohnen, der Bereichsleitung/Rechnungsführung Werkstatt, der Rechnungsführung Wohnbereich/Verein/Gesamtrechnung und dem Sekretariat (Ausführung im Auftragsverhältnis durch Werkstatt). Nur eine konsequente Auftragserteilung an die einzelnen Einheiten, eine klare Zuweisung der Betriebsmittel und die Bereitschaft der Leitungen der Wohneinheiten und der Abteilungsleitungen der Werkstatt zur Übernahme der zugewiesenen Verantwortung erlaubt einen einfachen Überbau.“ (zitiert siehe im Anhang, Konzeption)
Zwischenzeitlich hat durch die Kantonalisierung der Betriebsbeiträge und die Komplexität der Rechnungsstellungen der administrative Aufwand derart zugenommen, dass eine Geschäftsstelle mit einer höheren Personaldotation eingerichtet werden musste. (vgl. siehe im Anhang, Konzeption)
Prinzip: Normalisierung
Dadurch, dass die Wohneinheiten höchstens acht Plätze umfassen und in verschiedenen Dörfern oder Quartieren sind, wird dem Normalisierungsprinzip schon weitgehend entsprochen. Durch die Berücksichtigung der verschiedenen Bedürfnisse und Wünsche der Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung, ist die Vielfalt und Eigenartigkeit der Wohneinheiten schon gegeben.
Normalität gilt als gesellschaftliche, kulturelle Gewohnheit, welche hinterfragt, durchbrochen und verändert werden kann.
Maßnahmen, die vom landesüblichen Verhalten und von normalen Umgangsformen abweichen, erfordern eine hinlängliche Begründung, sonst sind sie als konzeptwidrig zu betrachten und zu unterlassen. (vgl. ebd)
Prinzip: Privatheit
Im Verein Chupferhammer sind die Wohngemeinschaften und die Wohnungen das Zuhause der Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung und erst sekundär die Arbeitsplätze des Betreuungspersonals. Es gilt den Wohnbereich als Privatbereich zu respektieren und zu schützen. Die Räume der Wohngemeinschaft haben privaten Charakter und sind keine halböffentliche Räume. Die Nutzerinnen und Nutzer haben den Status von Bewohnerinnen und Bewohnern einer Wohnung und sind hier weder Kunden noch Klienten und auch keine Gäste, sie sind hier zu Hause. (vgl. ebd
Prinzip: Professionelle Begleitung
Im Mittelpunkt für das Betreuungspersonal steht die Gratwanderung zwischen den Rollen als angenehme und umgängliche Mitbewohnende und der Rolle der professionell tätigen Angestellten der Institution.
In der Gemeinschaft gilt das Recht der Bewohnenden auf weitgehende Selbst- und Mitbestimmung sowie auf Privatheit, um ein gutes Leben führen zu können. Die Professionellen haben sich in diesem Kontext taktvoll aufzuführen.
Die Professionalität erfordert von den bezahlten Angestellten aber auch ein reflektiertes, fachlich fundiertes und zu verantwortendes agogisches Handeln.
Der agogische Prozess wird nach der Vorgabe „Struktur agogischen Handelns“[1] strukturiert und nach vorgegebenen Kriterien dokumentiert. Zielsetzungen werden mit den Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung gemeinsam erarbeitet. Eine Rechenschaftspflicht über die agogische Arbeit besteht aber auch der Institutionsleitung und der gesetzlichen Vertretung gegenüber. (vgl. ebd)
Prinzip: Effektivität
Die Effektivität fragt nach der Zielerreichung der Institution. Der wichtigste Effekt ist „das gute Leben“ für die Nutzerinnen und Nutzer, das heißt auch die Umsetzung des Normalisierungsgedankens. Dann ist auch ein Ziel, dass die Einheiten und damit die Menschen mit Behinderung in Quartieren und Dörfern integriert leben können.
Der Verein ist überzeugt, unter dem Begriff der „institutionell abgesicherten Privatheit“ Räume anzubieten, die echten privaten Charakter haben. (vgl. ebd)
Prinzip: Effizienz
Die Effizienz besagt, ob das angestrebte Ziel mit klugem Mitteleinsatz, sachdienlicher Organisation, möglichst günstig und zeitgerecht erreicht wird. Die klare Organisation, die auf Delegation beruhende Führung und der haushälterische Umgang mit den finanziellen Mitteln führt zu einer hohen Effizienz und der Chupferhammer will damit jedem Vergleich mit anderen Institutionen standhalten. (vgl. ebd)
Prinzip: Qualitäts-Überprüfung
Es besteht ein differenziertes Qualitäts-Management-System (QMS), das den Kriterien des zuvor zuständigen Bundesamtes für Sozialversicherung entspricht, regelmäßig auditiert wird und von den Standortkantonen anerkannt wird.
Auch die jährlich stattfindenden Standortgespräche mit den Bewohnenden, gesetzlichen Vertretungen und gegebenenfalls Angehörigen dienen der Überprüfung der Qualität der erbrachten Dienstleistungen. (vgl. ebd)
2.6 Konzeption einer dezentralen Wohnform
[2] Auf Grund der unguten Erfahrungen in der Schweiz und weit darüber hinaus, die uns aufgezeigt haben, dass Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen und starken Verhaltensauffälligkeiten solange von Institution zu Institution geschoben wurden bis nur noch ein Platz in der Psychiatrischen Klinik offen blieb, entstand für die Wohngemeinschaft, in der ich arbeite, eine spezielle Konzeption. Sie steht auch in einem direkten Bezug zum Thema der Enthospitalisierung.
Der Verein wurde 2004 mit dem Schicksal von Angehörigen eines gut 30 Jahre alten Mannes mit einer kognitiven Beeinträchtigung und starken Verhaltensauffälligkeiten konfrontiert. Der junge Mann lebte bereits über den Kündigungstermin hinaus in einem Wohnheim auf dem Areal einer Psychiatrieklinik. Es fand sich auch unter Einbezug höchster kantonaler Stellen kein Platz in einer Institution der Behindertenhilfe. Alle lehnten ab.
Der Geschäftsführer und die Bereichsleiterin des Vereins Chupferhammer, besuchten den Mann im Wohnheim auf dem Areal der Psychiatrieklinik. Der behinderte Mensch lebte in einem zellenartigen Zimmer mit wenig Inventar. Er verfügte im Zimmer über einige Zeitschriften, die ihm wichtig waren. (vgl. im Anhang, Konzept WG Stofel)
„Der Mann verbrachte in der Regel zwanzig und mehr Stunden pro Tag allein in seinem Zimmer. Er führe dort teils laute und intensive Selbstgespräche in aggressivem Ton. Essen und Trinken werde in Plastik-Geschirr im Zimmer serviert. Auf die gelegentlichen Spaziergänge werde ein Rollstuhl mitgenommen, da es immer wieder zu epileptischen Anfällen komme. Immer wieder komme es zu verbalen und körperlichen Angriffen auf Mitbewohnende und Mitarbeitende. Freie Bewegung auf der Gruppe sei nicht möglich, da er auch Gegenstände behändige, die ihm nicht gehörten und die er nicht mehr herzugeben bereit sei.“ (zitiert im Anhang, Konzept WG Stofel, S.3)
Die Leitung der Institution Chupferhammer entschloss sich, diesem Menschen einen nicht verlierbaren Wohnplatz anzubieten. Dazu musste zuerst im Rahmen des Chupferhammer Konzepts ein spezielles Konzept für diese Wohneinheit erarbeitet und ein Haus gefunden werden. In einem nächsten Schritt wurde ein Team eingestellt und auf die spezielle Aufgabe vorbereitet. Den enormen finanziellen Aufwand konnte der Verein durch interne Quersubventionierung bewältigen.
Die konzeptionelle Setzung bestand im Zentrum aus der Haltung, dass der besagte Mensch trotz seines enorm normabweichendem Verhalten aufgenommen wird und er seinen Wohnplatz unabhängig von seinem Verhalten wird behalten können. Wenn jemand gehen muss, dann das Personal und nicht der behinderte Mann. Alle neu eintretenden Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen und/oder Verhaltensauffälligkeiten akzeptieren das Bleiberecht dieses Mannes. Im unlösbaren Konfliktfalle müssten sie sich einen alternativen Wohnplatz suchen. Sie haben eine Wahl, er nicht. (vgl. im Anhang, Konzept „ Stofel“)
„Die Strategie:
Die wichtigsten Punkte bestanden darin:
- Der Mann wird als erster Bewohner aufgenommen.
- Wir verzichten sehr weitgehend auf die Anwendung von Gewaltmitteln.
- Wir schließen den Mann weder im Zimmer noch im Haus ein.
- Wir gehen nicht zu ihm ins Zimmer, ohne anzuklopfen und zu fragen, ob unser Eintreten genehm sei.
- Wir führen keine Körperpflege gegen seinen Willen durch.
- Wir bieten ihm Essen an, bestehen aber nicht darauf, dass er bei Tisch erscheint und auch isst.
- Wir bieten ihm die vielen Medikamente gegen Epilepsie und zur Beruhigung an, verabreichen sie aber nicht gegen seinen Willen.
- Wir laden ihn zu Aktivitäten ein, zwingen ihn aber nicht daran teilzunehmen.
- Wir respektieren, wenn er im Bett und im Zimmer bleiben will.
- Wir sprechen den Mann per Sie an und geben unsererseits, auch in Situationen, in denen wir angegriffen, beschimpft, beleidigt und bedroht werden, den anständigen Umgangston unter Erwachsenen nicht auf.
- Wir verzichten auf pädagogisch motivierte Belehrungen und Bestrafungen, behandeln ihn als erwachsene Person. Nach Konfliktsituationen wird aufgeräumt und möglichst bald „normal“ weiter gelebt.
- Aus Gruppenräumen, das heißt aus Küche, Esszimmer und Stube, lassen wir uns von ihm weder durch Drohen, Schimpfen oder Schlagen hinausdrängen.“ (zitiert im Anhang, Konzept „Stofel“, S.5)
Die strategischen Setzungen werden laufend mit der Leitung reflektiert und allenfalls angepasst.
3. Begriffsverständnisse „Geistige Behinderung“ und „Verhaltensauffälligkeiten“
3.1 Begriff: „Geistige Behinderung“
Das, was unter „Geistiger Behinderung“ verstanden wird, kann sehr verschieden definiert werden. Zudem behalten sich verschiedene wissenschaftliche Disziplinen je eigene Definitionen vor. Ich beschreibe vier verschiedene Sichtweisen, die psychiatrisch-nihilistische, die heilpädagogisch-defizitorientierte, die entwicklungspsychologische und die IQ-bezogene Sichtweise mit je verschiedenen Schwerpunkten:
In der psychiatrischen-nihilistischen Sichtweise, ist der Oberbegriff für „angeborenen Schwachsinn“ der der „Oligophrenie“ (Geistesschwäche). Sie wird in drei verschiedene Stufen unterteilt: „Debilität“ als leichteste Form geistiger Behinderung, „Imbezillität“ als mittlerer Grad geistiger Behinderung und „Idiotie“ als sehr schwere Form geistiger Behinderung. „Unter dieser Sichtweise erscheint geistige Behinderung als unheilbare Krankheit und sie wird auf der Grundlage eines IQ-bezogenen Klassifikationssystems nach Schweregraden unterteilt.“ (Frank 1993, S.188; Gleixner, Müller und Wirth 1999, 338f.; Haring 1996, S. 216 und S. 211; Huber 1999, Möller 1994, S. 366; Vetter 1995, 50ff, zitiert in Theunissen 2011, S.12)
Zur heilpädagogisch-defizitorientierten Sichtweise ist zu sagen, dass wie im Namen schon enthalten, die Begrifflichkeit „Geistige Behinderung“ mit „auf Hilfe angewiesen sein“ beschreibt. Das Fehlende wird betont.
Der geistig Behinderte ist mehr oder weniger unfähig
- Zusammenhänge logisch zu erfassen und in ein altersgerechtes, für ihn durchschaubares System einzuordnen,
- Erfahrungen auf ähnliche Situationen zu übertragen (Transfer),
- zwischen logischem und chronologischem Zusammenhang sicher zu unterscheiden,
- langfristig, manchmal auch kurzfristig zu planen. (vgl. Theunissen, 2011, S.13)
In der entwicklungspsychologischen Sicht wurde der Schwerpunkt in der Definition des Begriffs „Geistige Behinderung“ auf die Erkenntnis über die Entwicklung des Menschen gelegt. Die Entwicklungstheorien gehen davon aus, „dass geistige behinderte Kinder und Jugendliche prinzipiell die gleichen Entwicklungsstadien wie nicht-behinderte Heranwachsende durchlaufen. Allerdings würde die Entwicklung erheblich langsamer verlaufen, was zur Folge hätte, dass ältere geistig behinderte Kinder in etwa dasselbe Verhalten zeigen würden, wie nicht-behinderte Kinder jüngeren Alters. Ein solcher Vergleich wird heute kritisch gesehen und wegen der Gefahr einer ‚Infantilisierung geistig behinderter Menschen im Erwachsenenalter zu recht abgelehnt’.“ (zitiert Theunissen, 2011, S.14)
In der IQ-bezogenen Sichtweise ist verbreitet, die kognitive Leistungsfähigkeit beim Menschen in den Mittelpunkt zu stellen. Geistige Behinderung wird oft als intellektuelle Retardierung bezeichnet. Diese IQ-bezogene Sichtweise wird oft kritisiert, da der Intelligenz-Quotient (IQ) anhand von Tests festgestellt wird. Ein Mensch mit einer geistigen Behinderung kann mit einem Test nur bedingt angemessen eingeschätzt werden. Sei dies wegen verbundenen Wahrnehmungsstörungen, Autismus oder andern sozialen Faktoren.
„Nichtdestotrotz wird bis heute geistige Behinderung häufig nur unter IQ-bezogenen Aspekten als Intelligenzminderung betrachtet.“ (Theunissen 2011, S.16 zitiert, Schanz, 2007)
Die Begrifflichkeit „Geistige Behinderung“ sollte bei seiner Einführung durch die deutsche Lebenshilfe 1958 die abwertenden Begriffe wie Geistesschwäche, Schwachsinn, Blödsinn, Idiotie oder Oligophrenie ablösen. Zwischenzeitlich ist „Geistige Behinderung“ aber seinerseits zur stigmatisierenden Bezeichnung geworden und die Lebenshilfe hat sich ihrerseits wieder von dieser Begrifflichkeit distanziert.
Wie man sieht, werden jedoch noch in verschiedenen Fachgebieten unterschiedliche Begrifflichkeiten verwendet. (vgl. Theunissen 2011, S.17)
In der heutigen Sozialpädagogik verwendet man meist Begriffe wie: kognitive Einschränkung, kognitive Beeinträchtigung, kognitives Anderssein oder kognitive Behinderung.
Ich persönlich bevorzuge den Begriff „kognitive Beeinträchtigung“. Meiner Ansicht nach ist ein Mensch mit einer kognitiven Beeinträchtigung nur bedingt behindert; jedoch ist ein Mensch mit einer kognitiven Behinderung tendenziell eher beeinträchtigt.
3.2. Begriff „Verhaltensauffälligkeiten“
Der Begriff der „Verhaltensauffälligkeit“ ist heute in der Behindertenarbeit etabliert. Er steht für deutlich von der Norm abweichende Verhaltens- und Erlebensweisen.
In den fünfziger Jahren wurde der Fachterminus „Verhaltensstörungen“ an einem Kongress in Paris eingeführt, dieser Begriff fand damals nur für Kinder, Jugendliche und Heranwachsende Verwendung.
„Verhaltensstörung ist ein von den zeit- und kulturspezifischen Erwartungen abweichendes maladaptives Verhalten, das organogen und/oder milieureaktiv bedingt ist, wegen der Mehrdimensionalität, der Häufigkeit und des Schweregrades die Entwicklungs-, Lern- und Arbeitsfähigkeit sowie das Interaktionsgeschehen in der Umwelt beeinträchtigt und ohne besondere pädagogische-therapeutische Hilfe nicht oder nur unzureichend überwunden werden kann.“ (Myschker zitiert in, Hillenbrand, 2008, S.31)
Um 1980 wurde dann der Begriff „Verhaltensauffälligkeiten“ in den Fachdiskussionen als Leitbegriff zum Thema. Man versteht darunter „beklagte Verhaltens- und Erlebensweisen, die zumeist eine Lerngeschichte aufweisen, aus sozialen Bedingungen hervorgegangen sind und/oder pädagogische Situationen betreffen und daher durch pädagogische und soziale Maßnahmen positiv beeinflusst, beziehungsweise im Einzelfall (bezogen auf bestimmte Auffälligkeiten) wieder verlernt werden können.“ (Theunissen, 2011, S.48)
Theunissen hat zu dieser Erklärung sieben verschiedene Bereiche unterteilt, in dem Verhaltensauffälligkeiten vorkommen.
- Auffälligkeiten im Sozialverhalten
- Auffälligkeiten im psychischen (emotionalen) Bereich
- Auffälligkeiten im Arbeits- und Leistungsbereich
- Auffälligkeiten gegenüber Sachobjekten
- Auffälligkeiten im somato-physischen (körperlichen) Bereich
- Selbstverletztende Verhaltensweisen
- Irritierendes Verhalten
Diese Aufzählung macht deutlich, wie viele verschiedene Erscheinungsformen in sehr komplexem Kontext unter dieser Begrifflichkeit subsummiert werden.
Parallel zu dem Begriff „Verhaltensauffälligkeit“ gibt es viele andere, wie zum Beispiel den Begriff des „originelles Verhaltens“, welcher vor allem in der deutschsprachigen Schweiz und in Süddeutschland verbreitet gebraucht wird. Auch der Begriff „herausforderndes Verhalten“, der aus dem angloamerikanischen Sprachraum eingeführt wurde, findet eine gewisse Verbreitung.
Ich werde in dieser Arbeit von dem Begriff „Verhaltensauffälligkeit“ sprechen, weil meiner Ansicht nach der Begriff bekannter ist und ich diesen in der Praxis auch benutze.
3.3 Erklärungsansätze für Verhaltensauffälligkeiten
Die Geschichte der Entstehung über das Verständnis der Verhaltensauffälligkeit ragt weit zurück. Ich möchte mich jedoch auf das aktuelle Verständnis beschränken.
In der gegenwärtigen Diskussion darüber, was Ursachen und Erklärungen zur Entstehung von Verhaltensauffälligkeiten sind oder welches Risikofaktoren für Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung und einer Verhaltensauffälligkeiten sind, gibt es drei verschiedene Sichtweisen, welche im Fachdiskurs zum Tragen kommen. Diese drei Ansätze kommen aus der Psychiatrie, der Sozialwissenschaft und der system- oder sozioökologischen Wissenschaft.
Die Psychiatrie geht davon aus, dass Verhaltensauffälligkeiten durch eine grundlegende psychiatrische Krankheit entstehen. Da die Verhaltensauffälligkeiten nach psychiatrischer Sichtweise einen organischen Ursprung haben, ist man der Überzeugung, dass die Behebung und/oder die Behandlung von Verhaltensauffälligkeiten oft nur in psychiatrischer Betreuung und in gesonderten psychiatrischen Einrichtungen stattfinden kann.
Die Sozialwissenschaft beschäftigt sich vor allem mit psycho-sozialen Risikofaktoren, welche die Entstehung von Verhaltensauffälligkeiten begünstigen können sowie den entsprechend möglichen Schutzfaktoren. Die Sozialwissenschaft geht davon aus, dass dynamische Zusammenhänge zwischen familiärer Lebenswelt, insbesondere menschlichen Beziehungen, Interaktionen und Erziehungspraktiken bestehen. Dies ist bedeutsam im Hinblick auf mögliche Ursachen oder auslösende Momente von Verhaltensauffälligkeiten. In diesem Kontext werden Fragen diskutiert, inwieweit Verhaltensauffälligkeiten Ergebnisse von defizitären Sozialisationsbedingungen sind.
In der systemökologischen Sichtweise erfassen aus verschiedenen Disziplinen wie Psychiatrie, Heilpädagogik, Sozialarbeit und klinischer Psychologie Denkansätze. Der gemeinsame Bezugspunkt sind Erkenntnisse aus der Systemtheorie und der sozioökologischen Verständnisweise. Im Fokus sind nicht die linear-kausal gehaltenen Fragestellungen, sondern die Beschreibung von Wechselwirkungen, in denen Zusammenhänge von Verhaltensweisen als „Störungen“ erscheinen.
Theunissen sagt: „Verhaltensauffälligkeiten sind nicht einzig und alleine an einer Person festzumachen, sondern stets Ausdruck einer Störung des Verhältnisses zwischen Individuum und Umwelt (Person, Dinge, Begebenheiten), die die betreffende Person durch spezifische problemlösende Verhaltensweise zu bewältigen versucht, die von Anderen als normabweichend oder sozial unerwünscht gekennzeichnet (beklagt) werden.“ (Theunissen, 2011, S.61)
4. Lebensraum: Wohnen, Freizeit und Arbeit
Zur Verdeutlichung sei zuerst ein heute vorstellbares Leben eines Mannes im Alter von 34 Jahren, welcher in der Schweiz lebt, skizziert.
Der Mann ist sich gewohnt achteinhalb Stunden pro Tag zu arbeiten, sich nach Feierabend vielleicht mit seinen Freunden in der nahe gelegenen Bar zu treffen und danach mit eigenem Auto in seine gemietete dreieinhalb Zimmer Wohnung zu fahren. Samstag und Sonntag hat dieser Mann meistens frei und er kann mit seinem Handy seine Freunde anfragen, ob sie Zeit hätten, mit ihm gemeinsamen Freizeitbeschäftigungen, wie Joggen, Fußballspielen oder Tanzen nachzugehen. Wenn er eine Frau kennenlernt, die ihm gefällt, trifft er sich mehrmals mit ihr. Er lädt sie zu sich nach Hause ein, kocht für sie und wenn es gefunkt hat und die zwei ein Paar werden, stellt er sie eventuell seinen Eltern vor. Nach der gemeinsamen Wohnungssuche wohnt das Paar einige Zeit zusammen und wenn die Beziehung sich festigt, heiraten sie und gründen eine eigene Familie mit Kindern.
Im Vergleich dazu ein gleichaltriger Mann, der in unserer Wohngemeinschaft lebt.
Als Bewohner unserer Wohngemeinschaft ist er vielleicht vier oder fünf Stunden pro Tag am Arbeiten. Vielleicht nicht fünf Tage die Woche, wie bei einem Menschen ohne kognitive Beeinträchtigung, sondern nur drei Tage. Die anderen zwei Wochentage verbringt er in der Wohngemeinschaft und übt sich im Haushalt oder arbeitet mit der Betreuungsperson an seinem Jahresziel. Nach dem Arbeiten in der geschützten Werkstatt wird er meist vom Tixi Taxi wieder in seine Wohngemeinschaft gefahren. Dort wird er willkommen geheißen und es wurde für ihn gekocht. Nach dem Abendessen hört er vielleicht ein wenig Musik in seinem Zimmer oder er wird vom Betreuungspersonal animiert, ein Spiel zu machen. Am Wochenende ist es üblich, wenn er zu Hause in der Wohngemeinschaft bleibt, mit den anderen Mitbewohnerinnen und Mitbewohnern zusammen einen Ausflug, Spaziergang oder Bastelarbeiten zu machen. Jedes zweite Wochenende kann der Mann seine Eltern besuchen, schläft dort, isst dort und hat noch sein Zimmer aus der Kinderzeit. Drei bis viermal jährlich geht der Mann in eine „Behinderten-Disco“ wo er animiert wird Frauen kennenzulernen, welche auch eine kognitive Beeinträchtigung haben. Der Mann mit einer kognitiven Beeinträchtigung möchte jedoch am liebsten eine Frau ohne Beeinträchtigung So verliebt er sich meistens in eine Betreuerin. Um seine Sexualität auszuleben, stellt das Betreuungspersonal beim Beistand ein Gesuch, dass ihn eine Sexuallassistenz besuchen kommt. Die Eltern des Bewohners wollen jedoch genau Bescheid wissen, was diese Sexuallassistenz mit ihrem Sohn macht; sonst wird dies kaum toleriert. Der Mann wünscht sich eine Familie, Frau und Kinder, sowie eine eigene Wohnung. Es wird ihm jedoch immer wieder gesagt, dass dies für ihn nicht möglich sei.
Diese zwei Männer führen nach meiner Wahrnehmung zwei grundsätzlich verschiedene Leben, was ihre Möglichkeiten bezüglich Selbstbestimmung, Autonomie und Integration anbelangt. Ich habe dies kurz zu erläutern versucht, um einen Input und/oder Gedankenanstoß für meine weiteren Ausführungen zu erhalten.
4.1 Meine Definition von Lebensqualität
Ich gehe davon aus, dass Lebensqualität für einen Menschen im engen Zusammenhang mit Selbstbestimmung, beziehungsweise mit einer möglichst großen Autonomie im Alltag steht. Auch die Integration in ein soziales Umfeld spielt eine wichtige Rolle.
Dohrenbush schreibt: „Wahlmöglichkeiten zu haben ist entscheidend, was natürlich letztlich eine politische Forderung ist, denn ohne individualisierte Angebote sowie entsprechende Finanzierungsmöglichkeiten ist Selbstbestimmung nicht möglich.“ (Dohrenbush, 2005, S. 101) Durch die Abhängigkeit der Lebensqualität von den finanziellen Möglichkeiten, ist es umso wichtiger, alle Aspekte einer guten Lebensqualität in Betracht zu ziehen. Die Hauptaspekte sehe ich in der selbstbestimmten Gestaltung des eigenen Lebensraumes und in der Integration in das soziale Umfeld. Kurz gefasst: Beim Wohnen, in der Freizeit und während der Arbeit wählen zu können und mitgestalten zu dürfen, ist für mich Lebensqualität. Sich die Freunde selbst wählen zu können, erscheint mir von besonderer Bedeutung.
4.2 Bedingungen einer Institution, um Lebensqualität zu ermöglichen
Eine Institution für Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung sollte meiner Vorstellung von Lebensqualität gemäß den Bewohnenden ein wirkliches Zuhause bieten können. Die beeinträchtigten Menschen sollten im institutionellen Angebot möglichst so wohnen können „wie man in der Schweiz eben wohnt“.
Bekanntlich gibt es in der Schweiz verschiedene Arten von Institutionen. Ich verfüge über Erfahrungen als Angestellte einer Grossinstitution, einer Kleininstitution und einer dezentrale Institution. Die Großinstitution ist für mich ein großes Wohnhaus mit mindestens 80 Wohnplätzen für Menschen mit einer Beeinträchtigung, mit einer geschützten Werkstatt und therapeutischen Angeboten, welche intern zu Verfügung stehen, sowie einer Kantine oder Cafeteria. Die Infrastruktur wirkt wie ein eigenständig funktionierendes Dorf.
Eine Kleininstitution kann für mich bis zu 80 Wohnplätze anbieten für Menschen mit einer Beeinträchtigung; ähnlich wie die Großinstitution. Es kann jedoch sein, dass die Therapieangebote extern wahrgenommen werden müssen und/oder die Arbeitsstellen extern sind. Auch die Infrastruktur ist sicherlich kleiner gehalten.
Die dezentrale Institutionsform ist eine Institutionsform, welche viele kleine eigenständige Wohnformen anbietet, die in verschiedenen Örtlichkeiten liegen. Pro Wohnhaus leben maximal acht Menschen mit Beeinträchtigung.
Nun ist die Frage wichtig, wie sich die Lebensqualität der Bewohnenden in den oben erwähnten Institutionsformen unterscheidet. Für diese Frage gehe ich vertieft auf die dezentrale Institutionsform ein.
Die Bedingungen, welche in der Institution in der ich arbeite, geschaffen wurden, orientieren sich am Ziel, den Bewohnenden eine bestmögliche Lebensqualität zu ermöglichen. Die Konzeption ist eng verbunden mit dem Normalisierungprinzips von Bengt Nirjie.
Eine konsequente Umsetzung des Normalisierungsprinzips mit Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung zeigt sich an der „räumlichen Integration“, der „sozialen Integration“ und der „gesellschaftlichen Integration“. (vgl. Nirjie in Eisenberg, 1999. S.4 )
Hahn hält fest: „Auf die Wohnsituation übertragen heißt dies: kleine Wohneinheiten, welche die Merkmale des Normalisierungsprinzips aufweisen, dezentral in die Wohnbevölkerung eingestreut, in etwa der Häufigkeit des vorkommens der geistigen Behinderung im sozialen Umfeld entsprechend, Abkehr vom zentralisierten Wohnen in Großeinrichtungen.“ (zitiert in Eisenberg, 1999, S.4)
Die Rahmenbedingungen für die Infrastruktur einer Institution sind stark von den gesellschaftlichen Vorstellungen eines gewünschten Lebensstandards geprägt. Das heißt für unsere Wohngemeinschaft formuliert: Jedem Bewohnenden steht auf Wunsch ein eigenes Zimmer zu, welches er gemäß eigenen Wünschen einrichten und gestalten kann. Alle Schlafzimmer verfügen über Fernseh- und Telefonanschlüsse. Die Badezimmer sind individuell eingerichtet. Jeweils zwei Bewohnende teilen sich das Badezimmer. Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung, welche in der Körperpflege viel Unterstützung brauchen, haben ein eigenes Badezimmer. Zwei Bewohnende haben nicht nur je ein Schlafzimmer, sondern auch ein gemeinsames Wohnzimmer. Das Wohnzimmer enthält eine Spielkonsole, ein hochwertiges Sofa und einen großen Fernsehapparat. Im Gebäude hat es auch zwei Ateliers, in denen die Bewohnenden kreativ gestalten können. Eine Werkstatt, die vor allem für Reparaturarbeiten genützt wird, gehört ebenfalls zur Infrastruktur. Der große Umschwung des Hauses umfasst einen Garten mit Gemüse- und Kräuterbeeten, einen Grill und mehrere Sitzplätze, sowie eine selbst erstellte Bocciabahn. Dieses Wohnhaus wird immobilientechnisch als großes Familienhaus; eingestuft.
Das Erleben von struktureller Gewalt, das heißt von negativ erlebten Impulsen wegen organisatorischen und strukturellen Setzungen dieser Wohnform sind mit denen in einer Großfamilie vergleichbar.
In unserer Wohngemeinschaft umfasst der Personalschlüssel für 6 Bewohnende, 720 Stellenprozente. Es wird eine 24 Stunden Betreuung an 365 Tagen pro Jahr angeboten. Beim Betreuungspersonal ist unabdingbar wichtig, dass es sich mit dem Leitbild der Institution identifizieren kann. Die Betreuung unterstützt die Bewohnenden unter anderem bei den lebenspraktischen Aufgaben, wie zum Beispiel dem Kochen und dem Einkaufen. Die agogische Arbeit legt den Schwerpunkt darauf, dass sich die Bewohnenden gegenseitig unterstützen können um so als Gemeinschaft die Defizite der Einzelnen gegenseitig durch entsprechende Ressourcen zu kompensieren. Das „gute Leben“ ermöglichen ist ein Leitsatz der Institution. Das „gute Leben“ können aber nur die Bewohnenden selbst realisieren; beeinträchtigungsbedingt aber mit angemessener Unterstützung durch die Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen. Das Austarieren zwischen Selbst-, Mit- und Fremdbestimmung ist eine höchst komplexe Gratwanderung und muss im Alltag von allen Beteiligten immer wieder neu gesucht und gefunden werden.
Wenn man Bewohnende in der oben beschriebenen, dezentralen Institution fragt, was sie von einer Institution benötigen um ein „gutes Leben“ zu führen, ist die Antwort bei der Mehrheit geprägt von der Vorstellung von „einem schönen Zuhause“. Daher ist für mich zentral, dass die Institution ein Zuhause und nicht lediglich ein Aufenthaltsort ist. Um sich zuhause fühlen zu können, muss man sich mit der Wohngemeinschaft identifizieren können, sich selbstwirksam in dieses Gebilde einbringen können, die Nachbarn, sowie das Dorf kennen und vor allem in die Gestaltung der Infrastruktur und des Alltags involviert sein.
4.3 Normalisierungsprinzip und die Umsetzung im sozialpädagogischen Alltag
Das Normalisierungsprinzip entstand in den 60er Jahren weitgehend für die Arbeit mit Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung. Bank-Mikkelson hat den Normalisierungsgedanken in der dänischen Gesetzgebung verankert und Bengt Nirjie hat in Schweden das Normalisierungsprinzip in acht Punkten formuliert. Der Normalisierungsgedanke wurde in den USA und in Kanada bei vielen Kongressen und in verschiedenen Ausprägungen maßgeblich weiterentwickelt. Nebst Bengt Nirjie übernahm Wolf Wolfensberger dabei in den USA eine tragende Rolle. Er setzte sich für Verbesserungen der Bedingungen in den Institutionen, Einrichtungen und Anstalten durch Aufnahme des Normalisierungsgedankens ein. Dadurch wurden verschiedene Verbesserungen erzielt. Parallel zu den Kongressen in den USA wurde auch in den deutschsprachigen Ländern der Gedanke des Normalisierungsprinzips in den Fachdiskurs aufgenommen. In den verschiedenen Ländern wurde im Zusammenhang mit dem Normalisierungsprinzip der Prozess der Deinstitutionalisierung angestoßen.
Pointiert auf den Punkt gebracht hat es Bengt Nirjie:
„Das Normalisierungsprinzip beinhaltet, allen Menschen mit geistiger Behinderung Lebensmuster und Alltagsbedingungen zugänglich zu machen, die den üblichen Bedingungen und Lebensarten der Gesellschaft soweit als möglich entsprechen [...].“ (Nirjie, zitiert in Eisenberger, 1999, S.3)
Bengt Nirjie hat das Normalisierungsprinzip in acht Punkten formuliert. Diese werde ich in der Folge an Beispielen aus der Wohngemeinschaft erläutern, in der ich arbeite.
1. Ein normaler Tagesablauf
Normalisierung bedeutet, Gelegenheit zu einem normalen Tageablauf zu haben.
Wir verstehen unter einem normalen Tagesablauf, dass die Wohngemeinschaft regelmäßige Essenszeiten hat. Dies heißt nicht, dass die Bewohnenden nicht früher oder später essen können. Mittags- und Abendmahlzeiten werden jeweils auf 12:00 Uhr und 18:00 Uhr mit Bewohnenden zusammen zubereitet. Die Betreuung beginnt morgens um 07.30 Uhr. Auch nachts ist immer jemand auf Pikett im Haus. Die Arbeitszeit für die Bewohnenden beginnt intern um 09:00 Uhr. Die extern Arbeitenden machen sich um 09:00 Uhr auf den Arbeitsweg. Die Zeiten für Znüni, Mittagessen, inklusive Mittagspause und Zvieri sind als Tagesstruktur gegeben.
Die extern Arbeitenden kommen gegen 17:00 Uhr zurück und auch die interne Arbeit wird um diese Zeit beendet.
Nach der Arbeit gibt es verschiedene Freizeitangebote; wie bspw. im Dorf eine Gaststätte aufsuchen, Spiele spielen, Musik hören, Filme schauen, abendliche Spaziergänge ect. Die Bewohnenden werden aufgefordert, selbständig auszuwählen. Der Rückzug ins eigene Zimmer ist außerhalb der Arbeitszeit immer möglich.
Für zwei Bewohnende, eine ältere Frau und ein Bewohner, welche die Tagesablauf-Strukturen nicht einhalten können oder wollen, besteht die Möglichkeit, diese so zu gestalten, wie sie das wünschen. Von uns werden jedoch die verschiedenen Angebote nur in den festgelegten Zeiten gemacht. Das Sicheinfügen in die angebotenen Strukturen ist für alle Bewohnenden grundsätzlich offen. Dies bedeutet zum Beispiel, dass wenn der Bewohnende nicht rechtzeitig zum Mittagessen erscheint, das Mittagessen nicht abgeräumt wird und es besteht für den Bewohnenden die Möglichkeit, selbst etwas zu kochen oder sich aus dem Kühlschrank zu bedienen. An den Wochenenden werden oft nur Freizeitangebote gemacht.
Der Zeitpunkt des Zu-Bett-Gehens wird von der Betreuung nicht vorgeschrieben, sie empfehlen es aber gelegentlich. In der Wohngemeinschaft gibt es keine Nachtwache, sondern es besteht ein Pikett Dienst. Nachtruhe gilt unter der Woche ab 22:00 Uhr, in dem Sinne, wie es das Gesetz grundsätzlich vorschreibt.
2. Ein normaler Wochenablauf
Das Normalisierungsprinzip bedeutet auch, Gelegenheit zu einem normalen Wochenablauf zu haben.
Die örtliche oder räumliche Trennung von Arbeitsplatz und Wohnplatz schaffen wir, in dem wir eine Tagesstruktur anbieten, welche in den unteren Räumen (Atelier/Werkstatt) oder im Garten stattfindet. Bei den extern Arbeitenden wird besonders darauf geachtet, dass Probleme aus dem Arbeitsbereich nicht in die Wohngemeinschaft getragen und vermischt werden. Nirjie geht davon aus, dass für Menschen „normalerweise“ das Wohnen und das Arbeiten an einem jeweils anderen Ort stattfinden.
Zum normalen Wochenablauf gehört auch die klare Trennung zwischen Wochentagen und Wochenenden. Wochentage sind bei uns Montag bis Freitag, Samstag und Sonntag sind Wochenende.
Wir sind bemüht, dass alle Bewohnenden den Arbeitsort selbstbestimmt wählen können. Dies ist jedoch nicht immer umsetzbar, da externe Arbeitsstellen einzelne unserer Bewohnenden als „nicht tragbar“ eingestuft haben. Deshalb wurde mit diesen Bewohnenden zusammen eine individuell angepasste, interne Arbeitstagestruktur ausgearbeitet.
3. Ein normaler Jahresablauf
Das Normalisierungsprinzip bedeutet, den Jahresablauf durch Einhaltung von Feiertagen, Ferien- und Familientagen von persönlicher Bedeutung erleben zu können.
Wir versuchen einen normalen Jahresablauf zu leben, indem wir die traditionellen Feiertage wie Weihnachten, Ostern oder auch Fasnacht unter Einbezug der Bewohnenden aktiv gestalten. Zum Beispiel färben wir vor Ostern Eier oder basteln im Advent Weihnachtsschmuck. Auch unser eigener Kräuter- und Gemüsegarten zeigt den Jahresablauf bestens auf. Die Bewohnenden führen verschiedene Arbeiten, zu den verschiedenen Jahreszeiten passend aus und können dann die saisonalen Gerichte zubereiten und kosten. Die Organisation der saisonalen Kleiderbesorgung gehört auch zum normalen Jahresablauf der Bewohnenden.
Seit ein paar Jahren organisiere ich im Sommer „Wohngemeinschaftsferien“ in der Toskana. Dort ist der Tagesablauf so normal wie es sich gehört, wenn man eben Ferien macht. Diese Ferien sind für alle beteiligten Bewohnenden immer wieder ein Höhepunkt im Jahresverlauf.
4. Die normalen Erfahrungen eines Lebenszyklus’
Normalisierung ist auch eine Gelegenheit, die normalen Entwicklungserfahrungen eines Lebenszyklus’ machen zu können.
Genauso wie alle anderen Menschen entwickeln sich auch Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung. Sie sind Kinder, werden Jugendliche, Erwachsene und später Alte und Betagte. Wichtig ist, die Umgangsformen dem Alter und nicht dem Entwicklungsstand entsprechend zu wählen. Erwachsene Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung aufgrund ihrer Hilfsbedürftigkeit oder ihres Verhaltens wie Kinder zu behandeln, widerspricht dem Normalisierungsprinzip klar.
Für die Eltern gibt es zwei generell schwierige Phasen während der Elternschaft für ein Kind mit Beeinträchtigung. Die eine Phase stellt die Geburt des Kindes mit der Bestürzung und der Trauer über die Beeinträchtigung des Neugeborenen bei den Eltern dar. Die andere Herausforderung stellt sich mit dem Erwachsenwerden, dem Ablösungsprozess und den Ängsten, dass ihr Kind außerhalb des Elternhauses nicht genug gefördert werden könnte.
Deshalb gehört es zu den wichtigsten Aufgaben der Institutionen oder anderen Einrichtungen, sich dessen bewusst zu sein und die Eltern verständnisvoll zu unterstützen.
Meine Erfahrung zeigt mir, dass auch ein erwachsener Mensch mit einer kognitiven Beeinträchtigung, der aber die Fähigkeit besitzt zu kommunizieren was er gerne möchte und was nicht, von den Eltern weitgehend fremdbestimmt wird. Wie er sich kleidet, wie er seine Sexualität gestaltet, wo er Weihnachten feiert und ob er in seiner Wohngemeinschaft bleiben will, sollte ein erwachsener Mensch selbst bestimmen können.
Diese Thematik ist wohl allen bekannt, nur ist es mit der Umsetzung nicht gut bestellt. Oft sind die Eltern gleichzeitig auch die gesetzlichen Vertreter der Bewohnenden. Dadurch kann es zu einer Vermischung der Rollen einerseits als Eltern eines erwachsenen Kindes, und andererseits als gesetzliche Vertreter für eine erwachsene Person kommen. Die Angst, das Kind „verlieren“ zu können, kann Eltern darin hemmen, einen Ablösungsprozess einzuleiten oder anzustreben. Um diese Thematik wirkungsvoll anzugehen, braucht es ein Bewusstsein dessen und eine transparente Kommunikation mit allen Beteiligten. Es ist wichtig, die Entwicklung des betreffenden Menschen bestmöglich zu unterstützen. Doch aus Furcht vor der Verletzbarkeit der Eltern ist das Betreuungspersonal oft gehemmt, diese Fragen anzusprechen.
Mir stellt sich die Frage, welches die besten Gefäße sind um einen solchen gegenseitigen Entwicklungsprozess einzuleiten. Ist es meine Aufgabe als Sozialpädagogin, diesen einzuleiten, oder lege ich den Fokus darauf, dass ich die Bewohnenden unterstütze, um die aktuelle Entwicklungsphase gut zu bewältigen?
Ich denke, es gehört beides zu meiner Aufgabe; jedoch kann und soll ich je nach Situation durch Familienberatung, Institutionsleitung, Fachberatungen, etc., fachliche Unterstützung einfordern.
[...]
[1]
[2] Bestanteile dieses Inhalts ist aus dem Entwurf der Konzeption WG Stofel
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Erstausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2013
- ISBN (Paperback)
- 9783955492632
- ISBN (PDF)
- 9783955497637
- Dateigröße
- 239 KB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Agogis - Berufliche Bildung im Sozialbereich
- Erscheinungsdatum
- 2015 (Februar)
- Schlagworte
- Inklusion Industrialisierung Gesellschaft Sozialpolitik Denzentralisierung
- Produktsicherheit
- BACHELOR + MASTER Publishing