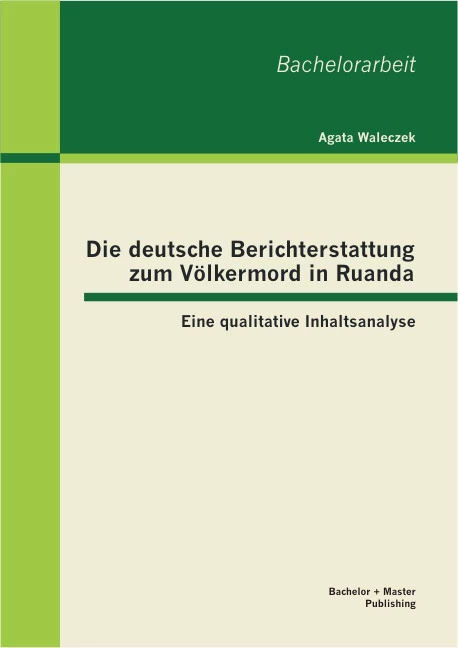Die deutsche Berichterstattung zum Völkermord in Ruanda: Eine qualitative Inhaltsanalyse
Zusammenfassung
Sowohl den Medien, als auch den Vereinten Nationen wurde im Zusammenhang mit dem Genozid in Ruanda vorgeworfen, im Angesicht der Krise versagt zu haben. Die multiple Unfassbarkeit dieses Völkermordes - als Menschenrechtsverbrechen und kommunikative Niederlage - fordert eine kommunikationswissenschaftliche Auseinandersetzung umso mehr heraus, als dass der Forschungsstand zur deutschen Berichterstattung zum Genozid in Ruanda nicht umfangreich ausfällt. Die vorliegende Studie fasst die gegebenen Umstände als Chance auf, einen Beitrag zu einem wenig erforschten Gebiet zu leisten.
Die Studie versucht nachzuvollziehen, wie sich das Genozid 1994 in Ruanda abgespielt hat und wie darüber in Deutschland und international berichterstattet wurde. Eine zentrale Bedeutung wird hier bei der Berichterstattung zum Genozid in der Süddeutschen Zeitung zukommen. Wie hat deren Afrikakorrespondent Michael Birnbaum über den Völkermord berichtet?
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
3. Die Vorgeschichte des Völkermordes
Will man das Genozid in Ruanda verstehen, so muss man sich der Spannungen bewusst werden, die im Land lange vor Ausbruch der Massaker an den Tutsi herrschten. Es handelt sich um eine Vorgeschichte, die bis in die Zeit der Besiedlung Ruandas zurückreicht.
3.1. Hutu, Tutsi und Twa
Ruandas Geschichte ist geprägt von einer „[…] Furcht, die in fest verankertem, wenngleich mißverstandenem [sic!] Gedankengut über die Vergangenheit Ruandas wurzelte“ (Des Forges 2002: 55). Ruanda wurde zunächst von Pygmäen besiedelt, deren Nachkommen, die Twa, nicht ganz ein Prozent der heutigen Bevölkerung Ruandas ausmachen (vgl. Gourevitch 2008: 57). Erst später wurde das Land von Hutu und Tutsi besiedelt, wobei ihre genaue Herkunft und die Reihenfolge ihrer Ankunft in Ruanda unbekannt sind (vgl. Gourevitch 2008: 57).
„Im Laufe der Zeit benutzten Hutu und Tutsi die gleiche Sprache, hatten die gleiche Religion, heirateten untereinander, lebten ohne territoriale Abgrenzung auf den gleichen Hügeln zusammen und teilten die gleiche soziale und politische Kultur in kleinen Lehen“ (Gourevitch 2008: 57).
Aufgrund der weitgehenden Vermischung beider Gruppen können Hutu und Tutsi nicht als getrennte ethnische Gruppen gesehen werden (vgl. Gourevitch 2008: 57), sondern eher als soziopolitische Klassen, Kasten oder Ränge – somit war die Bezeichnung Tutsi gleichzusetzen mit den Land und Vieh besitzenden Machthabern, Hutu waren die mittleren und unteren Gruppen der Gesellschaft und Twa waren Parias, die den Tutsi manchmal bei Hofe dienten (vgl. Honke/Servaes 1994: 344). Hierbei war der Auf- und Abstieg zwischen den Gruppen durchaus möglich, wobei dieser Umgang mit soziopolitischen Grenzen vor allem im Einflussgebiet der zentralruandischen Königsmacht galt (vgl. Honke/Servaes 1994: 344), an deren Spitze ein gottgleicher König, mwaami genannt, stand. Problematiken ergaben sich aus der Ausweitung dieses Systems auf ganz Ruanda durch die Kolonialmächte „[…] sowie in der ethnischen oder rassischen Fundierung der vorgefundenen Gruppen“ (Honke/Servaes 1994: 344). Das zu Anfang bezeichnete Missverständnis bezieht sich auf die Herkunft der beiden größeren Bevölkerungsgruppen Ruandas: Oft heißt es, die Hutu seinen ein Bantu-Volk, das zuerst von Süden und Westen her das Land besiedelte – die Tutsi hingegen seien ein aus dem Norden und Osten kommendes nilotisches Volk (vgl. Gourevitch 2008: 57). Dieser eher auf Legenden als auf Fakten basierende Mythos wurde im Folgenden mit der europäischen Rassentheorie der Kolonialzeit in Verbindung gebracht – die von John Hanning Spekes 1863 aufgestellte, vollkommen unbewiesene hamitische Hypothese besagt, dass:
„Kultur und Zivilisation in Zentralafrika von den größeren Menschen mit schärferen Gesichtszügen eingeführt worden [sei], die [Spekes] für einen kaukasischen Stamm äthiopischen Ursprungs hielt. Dieser leite sich ab vom biblischen König David und sei folglich eine den eingeborenen Negroiden überlegene Rasse“ (Gourevitch 2008: 61).
Mit den eingeborenen Negroiden waren unter anderem die Hutu gemeint. Obwohl Speke selbst den meisten Ruandern namentlich nicht bekannt sein mag, merkt Gourevitch an, dass das Gedankengut der hamitischen Hypothese tief in die ruandische Wirklichkeit hineinwirkte: So hielt ein Ideologe der extremistischen Hutu-Power- Bewegung, Leon Mugasera, 1992 eine Rede, in der er die Hutu dazu aufrief, die Tutsi über den Fluss Nyabarongo zurück nach Äthiopien zu schicken – im April 1994 wurden zehntausende Leichen über genannten Fluss am Victoria-See angeschwemmt (vgl. Gourevitch 2008: 64).
Die Vorfahren der Hutu und Tutsi haben sich über einen Zeitraum von 2000 Jahren in der Region angesiedelt und lebten ursprünglich in Clans oder als Anhänger eines Anführers – später vereinigten sie sich und bildeten den Staat Ruanda (vgl. Des Forges 2002: 55).
„Sie schufen eine einheitliche, hochentwickelte Sprache, Kinyarwanda, gemeinsame religiöse und philosophische Überzeugungen sowie eine Kultur, in der Gesang, Tanz, Poesie und rhetorischen Fähigkeiten große Wertschätzung zukam“ (Des Forges 2002: 55).
Im 18. Jahrhundert entwickelte sich Ruanda unter Beteiligung von Ackerbauern und Hirten zu einem vollwertigen Staat (vgl. Des Forges 2002: 56) mit kapitalistischen Zügen. Die im Land herrschenden Machtstrukturen waren bestimmt von einem Denken, das die Zahl der Untergebenen als Zeichen für Macht und die Zahl der Rinder als Zeichen für Reichtum verstand, wobei man durch den Verleih oder die Schenkung von Vieh Anhänger gewinnen konnte und umgekehrt eine große Zahl von Anhängern die Gewinnung weiterer Viehbestände sichern konnte – beispielsweise durch Krieg (vgl. Des Forges 2002: 56). Unter Rwabugiri erlebte Ruanda zu Ende des 19. Jahrhunderts den Höhepunkt seiner Macht, hierbei regierte der Herrscher Zentralruanda in einem komplexen Hierarchiesystem aus miteinander konkurrierenden Beamten; die Randgebiete des Landes wurden von aus Bauern und Viehzüchtern bestehenden Clans dominiert und es gab auch mehrere Kleinstaaten innerhalb Ruandas (vgl. Des Forges 2002: 57). Mit der Zeit kam es zur Bildung einer sich überlegen fühlenden, regierenden Elite, deren Mitglieder Tutsi, was zuvor reiche Menschen bezeichnete, genannt wurden – Hutu, zuvor ein Begriff für Untergebene oder Gefolgsmänner, wurde zu einem Wort für die Masse der gewöhnlichen Leute und da die meisten Ehen innerhalb von Gruppen geschlossen wurden, wurden gemeinsame Kennzeichen der Viehzüchter schmale Gesichter und eine große, schmale Statur, Bauern hingegen waren eher kleiner, kräftiger und hatten breitere Gesichtszüge (vgl. Des Forges 2002: 57).
3.2. Kolonialisierung
Das politische System des Landes und das Verhältnis zwischen Hutu und Tutsi wurde grundlegend durch die Kolonialisierung um die Jahrhundertwende vom 19. zum 20. Jahrhundert zunächst durch die Deutschen und nach dem Ersten Weltkrieg durch Belgien verändert (vgl. Prunier 1998: 25/26). Tutsi-Viehzüchter als Machthaber und Hutu-Bauern als Untertanen – diese Struktur hatte sich zu diesem Zeitpunkt noch nicht überall durchgesetzt, da durch die komplexen politischen Strukturen beispielsweise Herrscher der Einzelstaaten große Autorität genossen, obwohl sie Hutu waren (vgl. Des Forges 2002: 57). Die Grenze zwischen beiden Gruppen war durchlässig (vgl. Des Forges 2002: 58). Die Kolonialmächte empfanden die komplexen Strukturen innerhalb des Landes als störend und begannen Anfang der zwanziger Jahre das Land im Sinne einer verwaltungsmäßigen Effizienzsteigerung umzugestalten, um Ruanda mit dem größtmöglichen Profit für die Kolonialmacht Anschluss an die Weltwirtschaft zu verschaffen (vgl. Des Forges 2002: 59/60). Die Tatsache, dass die Machthaber des Landes im Wissen um mögliche, aus einer Ausnutzung resultierende Nachteile ihre Forderungen an die Untergebenen begrenzt hatten, änderte sich mit den neuen durch die Belgier herbeigeführten Strukturen: Es wurde für repressive Beamte einfacher, die Schwachen zu unterdrücken (vgl. Des Forges 2002: 60). Eine weitere Konsequenz war die systematische Bevorzugung von Tutsi für die Besetzung von Machtpositionen (vgl. Des Forges 2002: 61).
„The introduction in 1933 of a mandatory identity card system deepened social divisions” (Keane 1995: 16).
Ab diesem Zeitpunkt war jeder Ruander zum Tragen eines Ausweises verpflichtet, auf dem sein Name und die ethnische Zugehörigkeit vermerkt waren – eine Regelung, die Identität als unveränderliche Kategorie festlegte (vgl. Keane 1995: 17). Mit der in Afrika einkehrenden Unabhängigkeitsbewegung, die bald auch Ruanda erreichen würde, mussten die Belgier einsehen, dass mit einer Demokratisierung des Landes die Herrschaft der Tutsi-Minderheit und die eigene Einflussnahme ein Ende hätten und unterstützten von nun an verstärkt die Hutu, was dazu führte, dass als 1959 der Tutsi-König Mwaami Rudahigwa starb und die Hutu zur Rebellion aufriefen, die Tutsi ihren Landsleuten praktisch ausgeliefert waren (vgl. Keane 1995: 18). In den Massakern starben zehn bis hunderttausend Tutsi und Zehntausende flüchteten (vgl. Keane 1995: 18).
3.3. Unabhängigkeit und die Zeit bis 1994
Am 1. Juli 1962 wurde Ruanda nach einem Referendum unabhängig (vgl. Behrendt 2005: 13) und neue Eliten führten die koloniale Ethnisierung des öffentlichen Lebens fort, wobei sie nicht vor Gewaltakten und Massakern zurückschreckten (vgl. Scherrer 1999: 101). Der mit der Zeit zunehmend autoritäre Präsident Kayibanda regierte in einem Herrschaftssystem, das dem der traditionellen Tutsi-Könige stark ähnelte und verlangte bedingungslosen Gehorsam, womit er eine Tugend förderte, der im Genozid 1994 eine entscheidende Rolle zukam (vgl. Behrendt 2005: 13). Nach dem Einfall von Tutsi-Guerillas aus Burundi in Südruanda im Dezember 1963 veranlasste die Regierung Massaker an den ruandischen Tutsi, woraufhin eine Viertelmillion Tutsi ins Exil ging (vgl. Gourevitch 2008: 78/79). Aufgrund der extremen Gewalt gegen Tutsi, die ihren Angriffen folgte, lösten die Exil-Tutsi ihre erfolglose Armee auf, was die die ruandische Regierung jedoch nicht davon abhielt 1973, als Reaktion auf die Massaker des burundischen Tutsi-Militärregimes an Hutu, die Tutsi im eigenen Lande abermals zu diskriminieren und abzuschlachten (vgl. Gourevitch 2008: 80-82). Oberbefehlshaber der ruandischen Armee, die die Pogrome verübte, war damals Generalmajor Juvénal Habyarimana, der am 5. Juli 1973 gegen Präsident Kayibanda putschte und sich selbst zum Präsidenten ernannte (vgl. Gourevitch 2008: 82). Er erließ ein Moratorium für Angriffe gegen Tutsi, das der Gewalt zeitweise ein Ende setzen sollte – die Diskriminierung beispielsweise bei der Ausbildung und Arbeitssuche fuhr allerdings fort (vgl. Gourevitch 2008: 84). In den nächsten Jahren baute Habyarimana seine Macht diktatorisch auf der Basis eines Ein-Parteien-Systems aus, das er Mouvement Révolutionnaire National pour le Développement (MRND) nannte (vgl. Behrendt 2005: 14). Außenpolitisch von immer größerer Bedeutung wurde die Flüchtlingsproblematik, da es Mitte der 1980er-Jahre in den Nachbarstaaten Ruandas mehr als eine halbe Million Flüchtlinge gab, denen die Rückkehr aufgrund der Überbevölkerung von der ruandischen Regierung verwehrt wurde (vgl. Behrendt 2005: 14). Aus den Reihen der Exil-Tutsi, die sich in Uganda der Armee um Museveni angeschlossen und zur Machtergreifung durch den Revolutionär 1986 beigetragen hatten, formierte sich später die militärische Bewegung Rwandese Patriotic Front (RPF) (vgl. Behrendt 2005: 14). Die RPF setzte sich eine notfalls gewalttätige Rückkehr der in Uganda unerwünschten, exilierten Ruander in ihr Heimatland zum Ziel (vgl. Behrendt 2005: 15). Wirtschaftlich ging es Ruanda unter Habyarimana anfangs besser, das Bruttosozialprodukt stieg in den ersten zehn bis 15 Jahren stark an, sodass es das der Nachbarländer weit übertraf, wofür vor allem Einkünfte auf dem Kaffee-, Tee- und Zinnmarkt verantwortlich waren, die etwa 80 Prozent des Außenhandelserlöses ausmachten (vgl. Behrendt 2005: 15). Ab Mitte der achtziger Jahre verschlechterte sich jedoch die wirtschaftliche, politische und soziale Lage zusehends (vgl. Behrendt 2005: 15). Die Preise für Kaffee, Tee und Zinn fielen auf dem internationalen Markt und die Folgen machten sich in allen sozialen Schichten bemerkbar, wobei die Ungleichverteilung des Wohlstandes vor allem die Landarbeiter frustrierte (vgl. Behrendt 2005: 15). Hinzu kamen eine Dürre im Süden des Landes, ein sehr schlechtes Krisenmanagement der Regierung im Jahr 1989 und die mit jährlich 3,7 Prozent ohnehin höchste Bevölkerungswachstumsrate Afrikas, die eine Hungersnot auslösten (vgl. Behrendt 2005: 16). 1989 akzeptierte die Regierung unter Habyarimana daher ein wirtschaftliches Strukturprogramm des Internationalen Währungsfonds (IMF) sowie der Weltbank und erhielt dafür ein Darlehen (vgl. Behrendt 2005: 16). Die folgende starke Inflation und das Versagen dieses Programms der internationalen Gemeinschaft verschlimmerte die ohnehin desaströse Lage zusätzlich (vgl. Behrendt 2005: 16).
Als Sündenbock, auf den die allgemeine Unzufriedenheit projiziert werden konnte, mussten die Tutsi umso mehr herhalten, als die RPF am 1. Oktober 1990 unter Generalmajor Rwigema und Major Kagame aus Uganda im Norden Ruandas einfiel (vgl. Behrendt 2005: 16). Entgegen ihrer Erwartungen wurden die politischen Verbesserungsvorschläge der RPF von der durch Anti-Tutsi-Propaganda verängstigen Hutu-Bevölkerung mit Massenfluchten ins Landesinnere und Massakern beantwortet (vgl. Behrendt 2005: 17). Die Invasion verfehlte ihr Ziel und mündete in einen vierjährigen Bürgerkrieg. Es mag widersprüchlich anmuten, dass gleichzeitig Friedensgespräche vorbereitet wurden, die ab Juni 1992 verhandelt wurden und am 4. August 1993 schließlich in der Unterzeichnung des Friedensvertrages von Arusha mündeten (vgl. Jones 2000: 131), denn:
„Seit dem Angriff der Rwandischen Patriotischen Armee (RPA) im Oktober 1990 aus dem Nachbarland Uganda und während der monatelangen Friedensverhandlungen in Arusha wurden planmäßig irreguläre Milizen und Todesschwadrone aufgebaut, bewaffnet, trainiert und instruiert“ (Scherrer 1999: 104).
Als Drahtzieher dieser Vorbereitungen zum Genozid wird das Akazu, die Clique um Habyarimana und seine Frau Agathe angesehen (vgl. Keane 1996: 23). Die Ressentiments gegen Tutsi verstärkten sich: Auf nationaler Ebene wurde Volksverhetzung durch die Medien betrieben, die Hutu zum Morden an ihren Mitbürgern, die längst nicht mehr als Elite bezeichnet werden konnten (vgl. Keane 1996: 23), aufforderten (vgl. Kap 4.1.).
“By 1994, Tutsi in Rwanda, much like Jews in Nazi Germany, were 'socially dead' people, whose murder was as acceptable as it became common” (Uvin 1997: 113).
4. Der Völkermord in Ruanda
Die heute von vielen Autoren (vgl. Des Forges 2002, Fujii 2009, Hintjens 1999, Keane 1996, Jefremovas 1997) zur Erklärung des Völkermordes herangezogene These lautet:
„Der Genozid in Rwanda 1994 war ein angekündigter und von langer Hand vorbereiteter Versuch einer verbrecherischen Staatsklasse, zur Erhaltung ihrer Macht und ihrer Privilegien eine Minderheit gänzlich auszulöschen“ (Scherrer 1999: 104).
Am 6. April 1994 wurde das sich im Landeanflug auf den Klughafen Kigali befindende Flugzeug des ruandischen Diktators Juvénal Habyarimana von einer Rakete abgeschossen (vgl. Behrendt 2004: 17). Der Präsident sowie sein burundischer Kollege Cyprien Ntaryamira befanden sich auf dem Rückweg von Friedensverhandlungen in Arusha – beide kamen ums Leben (vgl. Behrendt 2004: 17). Die Reaktion auf den Absturz der Präsidentenmaschine kam auffällig schnell, denn ihr war eine bemerkenswerte Organisation durch die Gruppe um Präsident Habyarimana vorangegangen (vgl. Scherrer 1999: 104). Somit konnten unmittelbar nach dem Flugzeugabsturz 1500 bis 2000 Elitekräfte der ruandischen Armee und 2000 ausgebildete Milizen mithilfe von vorgefertigten Namenslisten das Morden beginnen (vgl. Behrendt 2005: 21). Die Systematik des Vorgehens wird hierbei an der Reihenfolge der betroffenen Opfergruppen in den ersten Tagen deutlich: So wurden zunächst die Mitglieder von Oppositionsparteien – am 7. April wurde die liberale Hutu-Oppositionelle und Premierministerin Agathe Uwilingiyimana ermordet (vgl. Hintjens 1999: 274), von Menschenrechtsorganisationen, der kritischen Presse und der Bildungselite getötet (vgl. Honke/Servaes 1994: 364). Die Beseitigung der Tutsi folgte, wobei aus den Mordplänen an der Gruppe im Voraus kein Geheimnis gemacht worden war – die Vernichtung war vom Mouvement Républicain National pour le Développement et la Démocratie (MRND) angekündigt worden (vgl. Scherrer 1999: 102). In den drei Monaten nach dem Absturz wurde somit der gesamte Staatsapparat, insbesondere durch staatliche und private Medien (vgl. Scherrer 1999: 104), zur Ausrottung der Tutsi angestachelt. Die katholische Kirche schwieg nicht nur und versagte kläglich, was Massaker an Menschen, die in Kirchen wie der von Nyarubuye (vgl. Gourevitch 2008: 19) Zuflucht gesucht hatten, belegen – der Klerus war sogar in manchen Fällen Komplize des Regimes (vgl. Des Forges 2002: 300). Die Massaker wurden aufgrund der dörflichen Struktur der ruandischen Lebensweise oft von gewöhnlichen Bauern an ihren Nachbarn vollzogen (vgl. Hatzfeld 2004: 72). Hatzfeld zitiert einen der Mörder:
„Wir erledigten die Arbeit so, wie man es halt macht, außer selbstverständlich bei denen, die davonliefen und uns mit diesem Gerenne unnötig ins Schwitzen brachten“ (Hatzfeld 2004: 140).
Circa hundert Tage (vgl. Behrendt 2005: 17) dauerte das Morden an den Tutsi:
„Trotz einer alles andere als perfekten Organisation und archaischer Mordinstrumente war [der Völkermord in Ruanda] jedoch wirkungsvoll wie kein anderer. Seine Mengenleistung erwies sich als ungleich höher als die des Völkermordes an den Juden sowie den Sinti und Roma, denn in zwölf Wochen wurden ungefähr 800.000 Tutsi umgebracht“ (Hatzfeld 2004: 75).
4.1. Die Rolle der nationalen ruandischen Medien
Einen nicht zu unterschätzenden Beitrag zur Eskalation der Situation haben die nationalen Medien in Ruanda geleistet. Insbesondere die Tageszeitung Kangura hat Hutu aktiv gegen Tutsi aufgewiegelt und bereits ab Oktober 1990 Stimmung gegen die RPF und Tutsi gemacht (vgl. Des Forges 2002: 96). Noch mehr Einfluss als meinungsmachendes Medium wird das Radio gehabt haben, da 66 Prozent der Ruander weder lesen noch schreiben können (vgl. Des Forges 2002: 96). 1991 hatten 29 Prozent der Haushalte ein Radio; Des Forges vermutet sogar, dass die Zahl der Radiogeräte zu Beginn des Völkermordes bedeutend höher war, da die Regierung im Vorfeld kostenlos Radios an die örtlichen Behörden verteilt hatte (vgl. Des Forges 2002: 96/97). Eine berüchtigte Rolle hat das Radio Télévision Libre des Milles Collines (RTLM) gespielt, das im August 1993 auf Sendung ging und dem trotz seiner Position als Privatsender Verbindungen zum Staat nachgesagt wurden (vgl. Des Forges 2002: 98).
„Als während des Völkermordes der Austausch von Informationen und das Reisen Einschränkungen unterworfen waren, wurde der Sender für die meisten Menschen zur einzigen Nachrichtenquelle und somit zur einzigen Instanz für die Interpretation ihrer Bedeutung. Zu diesem Zeitpunkt verbreiteten RTLM und Radio Rwanda gemeinsam nur noch eine Botschaft: Der ‚Feind‘ muß [sic!] vernichtet werden“ (Des Forges 2002: 100).
4.2. Internationale politische Reaktionen
Dem Völkermord waren nicht nur national, sondern auch international Warnungen vorausgegangen, an denen sich das Zustandekommen einer brutalen Krisensituation hätte erahnen lassen können. Zu diesen Warnungen zählen mehrere Meldungen des Befehlshabers der UN -Friedenstruppen Roméo Dallaire, in denen dieser zum Handeln aufruft. In einem Telegramm an seine Vorgesetzten vom 11. Januar 1994 setzte er diese davon in Kenntnis, dass ein Blutbad vorbereitet wird (vgl. Des Forges 2002: 38) und dass er die Beschlagnahmung von Waffen durchführen wird – dies jedoch wurde ihm vom Stab des Generalsekretariats der Vereinten Nationen untersagt, da dieser Gewaltausbrüche wie in Somalia nach Waffenbeschlagnahmungen befürchtete (vgl. Des Forges 2002: 211). Die Telegramme Dallaires waren nicht die einzigen Warnungen gewesen: In der Zeit zwischen November 1993 bis April 1994 gab es diverse Anzeichen für den sich zuspitzenden Konflikt; dazu zählt ein Anfang Dezember 1993 von ranghohen Militärs an Dallaire gesandter Brief, in dem vor geplanten Massakern gewarnt wurde und die Pressemitteilung eines Bischofs, in der davon die Rede war, dass Waffen an die zivile Bevölkerung ausgegeben würden (vgl. Des Forges 2002: 38). Weitere Hinweise lieferten die Berichte von Nachrichtendiensten, die über geheime Treffen informierten, bei denen Angriffe gegen Tutsi, Hutu-Oppositionelle und UN -Friedenstruppen besprochen wurden und nicht zuletzt die offensichtliche und für jedermann, der ein Radio besaß nachweisbare Aufwiegelung der ruandischen Bevölkerung zum Mord in Presse und Rundfunk (vgl. Des Forges 2002: 38).
„Ausländische Beobachter gingen nicht jedem Hinweis nach, doch die Vertreter Belgiens, Frankreichs und der USA waren über die meisten Vorgänge gut informiert“ (Des Forges 2002: 38).
Der Völkermord war für diese Staaten vorhersehbar. Wie wurde darauf reagiert? Dallaire forderte Anfang 1994 mehrmals ein erweitertes Mandat, eine Vergrößerung der Truppen sowie mehr Ausrüstung (vgl. Des Forges 2002: 38). Seinen Forderungen wurde nicht nachgekommen, was daran liegt, dass das UN -Sekretariat, vielleicht um nicht ein Missfallen seitens der USA zu riskieren, es unterließ, dem Sicherheitsrat den Ernst der Lage und die Dringlichkeit von Dallaires Bitte zu vermitteln (vgl. Des Forges 2002: 38). Des Forges merkt an, dass diese Informationen für die ohnehin gut informierten Staaten USA und Frankreich keinen Unterschied gemacht hätten, jedoch zu einer falschen Beurteilung der Situation in Ruanda durch andere Mitglieder des UN -Sicherheitsrates führten (vgl. Des Forges 2002: 38/39). Sowohl die den Völkermord bagatellisierende Ansicht des angeblich regierungsfreundlichen Sonderbeauftragten des UN -Generalsekretärs Roger Booh-Booh, als auch Dallaires verstärkte Forderungen nach einem Einschreiten wurden dem Sicherheitsrat durch die UN -Mitarbeiter in einer beruhigenden Version präsentiert (vgl. Des Forges 2002: 39). Trotz all dieser die Lage verklärenden Umstände, gaben sich Ende April die Tschechische Republik, Spanien, Neuseeland und Argentinien mit den vom Sekretariat vorgelegten Informationen nicht zufrieden (vgl. Des Forges 2002: 39). Eine gründlichere Recherche ergab, dass es sich um Völkermord handelte, sodass der Sicherheitsrat von diesen Ländern zu einer neuen Friedensmission mit erweitertem Mandat gedrängt wurde (vgl. Des Forges 2002: 39). Am 8. Juni wurde schließlich die UNAMIR-II- Mission genehmigt (vgl. Des Forges 2002: 763), die sich jedoch durch mangelnde finanzielle Mittel in einer bürokratischen Verzögerungstaktik erschöpfte. Im Juni, als die meisten Tutsi bereits tot waren, schickte Frankreich schließlich im Rahmen der Opération Turquoise Soldaten ins Land – nach eigenen Angaben zu humanitären Zwecken, in Wirklichkeit jedoch auch, um einen Sieg der anglophonen RPF zu verhindern (vgl. Des Forges 2002: 786).
Des Forges vertritt die These, dass eine frühere und bessere Informierung der nichtständigen Mitglieder des Sicherheitsrates die Gewalt vielleicht hätte abwenden können (vgl. Des Forges 2002: 39). Es wird darüber gestritten, ob der Völkermord als „[…] schwärzeste[r] Punkt in der Geschichte der Vereinten Nationen“ (Bitala 2004) vermeidbar gewesen wäre.
„Although some lives could have been saved by intervention of any size at any point during the genocide, the hard truth is that even a large force deployed immediately upon reports of attempted genocide would not have been able to save even half the ultimate victims” (Kuperman 2000: 94/95).
Dass ausgerechnet dieser Gedanke die informierten Staaten von einer Intervention abhielt, ist äußerst fragwürdig. Immerhin war Ruanda als aufstrebendes Entwicklungsland durchaus auf ein gutes Image im Westen angewiesen. Des Forges spricht von einer Wachsamkeit der ruandischen Regierung auf internationale Reaktionen, begründet durch die Abhängigkeit Ruandas von ausländischen Finanzhilfen (vgl. Des Forges 2002: 125). Dass das Habyarimana-Regime allerdings kein Eingreifen der Geberländer im sich zuspitzenden Konflikt befürchten müsste, zeichnete sich bereits 1991 ab, als der Rat unabhängiger Berater an die Geberländer ignoriert wurde, darauf zu drängen, die ethnische Klassifizierung aufgrund von Ausweispapieren zu unterlassen (vgl. Des Forges 2002: 125).
Für eine Intervention der Vereinten Nationen sprach außerdem die geringe Fläche des Landes von nur 29.338 km² (vgl. Prunier 1998: 1) und die Informiertheit mancher westlicher Mächte im Voraus, die diesen einen monatelangen Planungsspielraum für eine Intervention hätte einräumen können. Außerdem ist Kupermans Argument schon aus einer ethischen Sichtweise unhaltbar, da man, wenn es um Menschenleben geht, nicht quantitativ denken darf (vgl. Generalversammlung der Vereinten Nationen 1948) – selbst, wenn nicht einmal die Hälfte der Opfer hätte gerettet werden können, wäre ein Einsatz menschenrechtlich notwendig gewesen. So gesehen ist Grills Begründung des Verhaltens der Weltgemeinschaft mit der Zwecklosigkeit einer Intervention aufgrund der Unzugänglichkeit und Unübersichtlichkeit Ruandas, eine Ausrede (vgl. Grill 1994: 11). Wichtiger ist folgendes Zitat des Journalisten:
„Was sollte die Weltgemeinde da schon tun, vorausgesetzt, sie hätte überhaupt Interesse daran?“ (Grill 1994: 11).
Der Grund für das mangelnde Interesse wird gewesen sein, dass ein Engagement politisch und ökonomisch nicht notwendig oder reizvoll genug erschien und dass die Weltgemeinschaft immer noch an den Fehlschlag der Somalia-Friedensmission (vgl. Livingston/Eachus 2000: 209) dachte. Mangelndes Interesse ist hierbei ein zu schwacher Ausdruck im Fall der gut informierten Staaten USA, Belgien und Frankreich, bei denen man eher von Ignoranz sprechen sollte. Obwohl Belgien durch die Verantwortung für die eignen Truppen vor Ort mehr, wenn auch immer noch zu wenig Initiative zeigte, um das Morden zu verhindern (vgl. Des Forges 2002: 215). Im Fall von Frankreich, das selbst Waffenlieferungen an die Génocidaires unternahm (vgl. Hintjens 1999: 275), scheint der Grund für das Hinauszögern einer Intervention in einer diplomatischen Loyalität gegenüber der frankophonen ruandischen Regierung, die sich im Kampf mit anglophonen Rebellen befand, zu liegen (vgl. Des Forges 2002: 215). Die Presidential Decision Directive 25, die die Teilnahme US-amerikanischer Streitkräfte an Friedensmissionen stark einschränkte (vgl. Livingston/Eachus 2000: 209) und die UNOSOM II -Mission in Somalia mit 18 Todesfällen und der Schlacht von Mogadischu (vgl. Wolf 2010) waren der Hauptgrund für das zögerliche Eingreifen der USA beim Völkermord. Die USA waren höchstens bereit, diplomatisch zu intervenieren, waren aber nicht Willens, mehr Ausgaben zu tätigen, was im Falle einer Erweiterung des UNAMIR -Mandats notwendig gewesen wäre (vgl. Des Forges 2002: 216). Anstatt den Völkermord zu bekämpfen, wurde er totgeschwiegen:
“President Clinton failed to use the term 'genocide' with regard to the events in Rwanda until after cholera began spreading through the camps of Goma […]. It was not until 1998 during his Africa tour that President Clinton acknowledged and apologised for failing to recognise the political genocide that was occurring” (vgl. Karnik 1998: 616).
Dies alles sind Gründe dafür, warum die Vereinten Nationen Mitschuld am Völkermord tragen (vgl. Dallaire 2003, Des Forges 2002: 36).
[...]
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Erstausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2011
- ISBN (Paperback)
- 9783955492731
- ISBN (PDF)
- 9783955497736
- Dateigröße
- 248 KB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Freie Universität Berlin
- Erscheinungsdatum
- 2015 (Februar)
- Note
- 1,3
- Schlagworte
- Ostafrika Massaker Genozid Menschenrecht Vereinte Nationen
- Produktsicherheit
- BACHELOR + MASTER Publishing