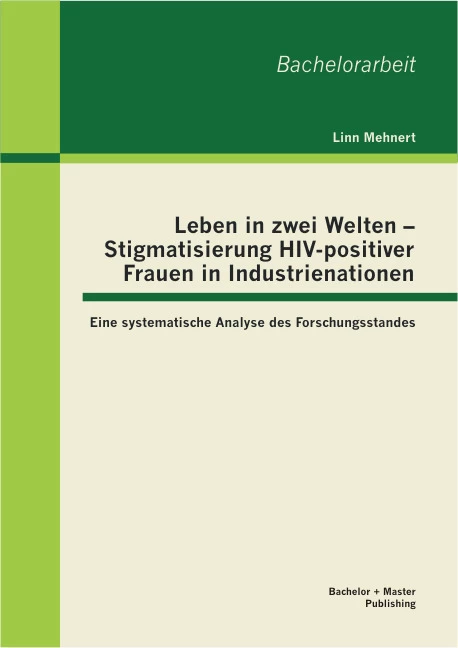Leben in zwei Welten - Stigmatisierung HIV-positiver Frauen in Industrienationen: Eine systematische Analyse des Forschungsstandes
Zusammenfassung
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
2.2 HIV/AIDS und Stigma
Kaum eine andere Krankheit ist mit so einem großen Stigma versehen wie HIV und AIDS. Schaut man sich die Geschichte und das Wesen der Krankheit an, ist dies nicht verwunderlich. Die ersten Fälle traten 1981 in Los Angeles unter homosexuellen Männern auf, die mit einer seltenen Hautkrebsart und einer besonderen Form der Lungenentzündung diagnostiziert wurden. Die daraus geschlussgefolgerte erworbene Immunschwäche wurde zunächst allgemein als GRID (Gay Related Immune Deficency) bekannt, bis festgestellt wurde, dass sie sich auch auf Haitianer, Hämophile und Heroinsüchtige ausweitete. Offiziell wurde sie als AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) bekannt. 1983 wurde das auslösende Virus entdeckt, welches man später Humanes Immundefizienz- Virus (HIV) nannte. Bereits 1985 wurde der HIV-Test für die Öffentlichkeit entwickelt. Es konnte nachgewiesen werden, dass das Virus die T-Helferzellen zerstört, die für die Immunabwehr verantwortlich sind und dadurch zunehmend den Körper in der effektiven Bekämpfung von Krankheitserregern schwächt. Es können sich dadurch opportunistische Infektionen und Krankheiten entwickeln, die unter dem Krankheitsbild AIDS zusammengefasst werden und ohne medizinische Behandlung in den meisten Fällen tödlich enden (Venrath, 1994).
AIDS wurde von Beginn an mit Personengruppen assoziiert, die aufgrund ihres abweichenden Verhaltens bereits stark stigmatisiert wurden. In den Medien wurde AIDS als „Schwulenseuche“ oder „Schwulenpest“ mit apokalyptischen Folgen dargestellt, die auch die „normale“ heterosexuelle Bevölkerung gefährdete. Es kam zu einer moralischen Schuldzuweisung, da eine Infektion mit HIV infolge von Geschlechtsverkehr oder dem Benutzen von infiziertem Spritzbesteck auftrat. AIDS wurde zum Synonym für sexuelle Ausschweifungen und Kriminalität. Hinzu kam der damals oft schnelle tödliche Krankheitsverlauf bei relativ jungen Menschen, was in der Bevölkerung Angst und Schrecken verursachte. Von vielen Menschen wurde die Krankheit als Gottes gerechte Strafe für abweichendes moralisches Verhalten interpretiert. HIV wurde in den Medien mit AIDS gleichgesetzt und Infizierte als Totkranke wahrgenommen. Die Definition von AIDS wurde immer wieder geändert und angepasst. Der Fakt, dass es in Folge einer HIV-Infektion nicht innerhalb kürzester Zeit automatisch zu einer Kombination aus tödlichen Symptomen, die AIDS bilden, kommen muss, fand keine Beachtung (Sontag, 1989). Das negative Bild von HIV/AIDS wurde sozial konstruiert und durch die Medien immer wieder verstärkt. Es legitimierte den gesellschaftlichen Ausschluss und die Ausgrenzung von bereits stigmatisierten Minderheiten (Stürmer & Salewski, 2009).
Nach Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation leben derzeit über 34 Millionen Menschen weltweit mit dem HI-Virus. 25 Millionen fielen ihm in den letzten drei Jahrzehnten zum Opfer. HIV/AIDS tritt auf allen Kontinenten auf, es betrifft Männer, Frauen und Kinder jeden Alters. Hauptinfektionsgebiet mit über 60 % aller mit HIV lebenden Menschen ist die Sub-Sahararegion Afrikas (WHO, 2012).
Der Verlauf der Krankheit ist individuell sehr unterschiedlich. Die Latenzzeit, in der das Immunsystem den Virus in Schach hält und die Person teilweise symptomlos leben kann, variiert und kann bis zu 15 Jahre oder länger betragen. Als nachgewiesene Übertragungswege gelten ungeschützter analer oder vaginaler Geschlechtsverkehr mit einem HIV-infizierten Partner; die Mutter-Kind-Übertragung während Schwangerschaft, Geburt und Stillzeit; die Transfusion mit HIV-infiziertem Blut sowie die Übertragung durch verunreinigte Injektionsnadeln oder nicht sterilisiertes Chirurgiebesteck (WHO, 2012). Selbst nach über 30 Jahren intensiver Forschung ist eine Infektion mit HIV immer noch nicht heilbar. Die medikamentösen Therapien haben sich jedoch seit 1995 stark verbessert und ermöglichen ein Leben mit HIV als chronische Krankheit, in der das Vollbild AIDS erfolgreich hinausgezögert oder verhindert werden kann. Doch auch die neuen antiretroviralen Kombinationstherapien können immer noch zu stark beeinträchtigenden Nebenwirkungen führen, und die Langzeitfolgen einer dauerhaften Einnahme der Medikamente sind noch nicht abzusehen (Stürmer & Salewski, 2009).
Menschen, die mit dem HI-Virus leben, sind Belastungen ausgesetzt, die einzigartig für diese Krankheit sind. Sie müssen nicht nur ihre komplexe medizinische Behandlung navigieren, sondern leben häufig auch in Sorge, mit ihrer Krankheit entdeckt zu werden oder den Virus an Kinder oder Partner weiterzugeben. Sie leiden bis zu fünfmal häufiger unter Depressionen und sogar achtmal mehr unter Angststörungen als HIV-negative Menschen. Dieser anhaltende zusätzliche Stress für den Körper kann den Verlauf von AIDS beschleunigen (Bing et al., 2001; Logie & Gadalla, 2009; Ndlovu, Ion & Carvahal, 2010).
Das mit HIV/AIDS assoziierte Stigma stellt eine besondere psychologische Belastung zu den Herausforderungen einer chronischen Erkrankung und dem bereits geschwächten Immunsystem dar (Vanable, Carey, Blair & Littlewood, 2006; Weiss et al., 2006). In der Forschungsliteratur wird immer wieder kritisiert, dass es für das Stigma im HIV/AIDS-Kontext keine spezielle einheitliche Definition gibt (Deacon, 2006; Mahajan et al., 2010; Weiss et al., 2006). Herek (1999), ein Forscher, der das Stigma von HIV/AIDS schon frühzeitig in den USA untersuchte, definiert das AIDS-Stigma als:
(…) prejudice, discounting, discrediting, and discrimination directed at people perceived to have AIDS or HIV, and the individuals, groups, and communities which they are associated. AIDS stigma has been manifested in discrimination, violence, and personal rejection of people with AIDS. (S. 1106)
Für Deacon (2006) muss Stigma im Kontext von HIV/AIDS nicht automatisch in Diskriminierung und Benachteiligung münden. Auch wenn es keine aktive Diskriminierung gibt, kann sich Stigma negativ auf das Selbst-Konzept auswirken. Menschen können sich aus Angst vor Stigmatisierung oder Diskriminierung zurückziehen und isolieren. Sie können aufgrund ihres Stigmas jedoch auch an Gruppenidentität und Status dazugewinnen, indem sie beispielsweise eine Führungsrolle innerhalb der benachteiligten Gruppe einnehmen. Deacon definiert das HIV/AIDS-Stigma als einen sozialen Prozess, in dem:
1. Krankheit als vermeid- und kontrollierbar konstruiert wird;
2. unmoralisches Verhalten identifiziert wird, welches die Krankheit hervorruft;
3. dieses Verhalten mit Krankheitsträgern einer Fremdguppe, den „anderen“, assoziiert wird;
4. bestimmte Personen für ihre Krankheit eigenverantwortlich beschuldigt werden; und
5. ein Statusverlust auf die „anderen“ projiziert wird, der in Benachteiligung enden kann, jedoch nicht muss. (2006, S. 421, Übers. v. Verf.)
Auch die Organisation UNAIDS trennt das HIV-Stigma klar von Diskriminierung ab. Sie betont, dass eine Person zwar eine stigmatisierende Einstellung gegenüber einer anderen haben kann, es jedoch nicht zu einem unfairen oder diskriminierenden Verhalten kommen muss. Stigmata bilden aber oftmals die Basis für Diskriminierung. UNAIDS gibt eine umfassende Definition des HIV-Stigmas und schließt auch internalisiertes Stigma mit ein:
HIV-related stigma refers to the negative beliefs, feelings and attitudes towards people living with HIV and/or associated with HIV. Thus, HIV-related stigma may affect those suspected of being infected by HIV; those who are related to someone living with HIV; or those most at risk of HIV infection, such as people who inject drugs, sex workers, men who have sex with men and transgender people. (….) It is expressed in stigmatizing language and behaviour, such as ostracization and abandonment; shunning and avoiding everyday contact; verbal harassment; physical violence; verbal discrediting, blaming and gossip. Stigma often lies at the root of discriminatory actions. Stigma may also be internalized by stigmatized individuals in the form of feelings of shame, self-blame and worthlessness. (2010b, S. 2)
Die Krankheit ist nicht nur mit negativen Stereotypen über abweichendes Verhalten von Subgruppen verknüpft; sie wird aufgrund ihres Ansteckungspotentials auch als Bedrohung für die Allgemeinbevölkerung wahrgenommen. Hinzu kommt, dass sie heutzutage in den meisten Fällen nicht direkt sichtbar und aufgrund der langen Latenzzeit dem Betroffenen nicht immer selbst bewusst ist. Für Menschen kann dies und vor allem der unheilbare Aspekt von HIV/AIDS bedrohlich wirken. Durch Ausgrenzung und Vermeidung wird versucht, sich vor der Möglichkeit einer Ansteckung zu schützen (Deacon, 2006; Kurzban & Leary, 2001). Dass eine HIV-Infektion als selbst verschuldet wahrgenommen wird, erhöht die Stigmatisierung zusätzlich. Es löst im Vergleich zu anderen Krankheiten, wie Krebs, bei Mitmenschen negative Reaktionen, wie Ärger und Wut, anstatt Mitgefühl und Anteilnahme aus (Weiner et al., 1988).
Reidpath und Chan (2005) überprüften die Theorie der layers of stigma. Das HIV-Stigma besteht nach ihrer Ansicht aus verschiedenen aufeinandergelegten Stigmata. Es nimmt dann zu, wenn das HIV-Krankheitsstigma auf andere Stigmata bezüglich des selbstverschuldeten Übertragungsweges oder persönlicher Charakteristika stößt. So wird beispielsweise ein heterosexueller Mann, der sich über eine Blutkonserve mit HIV infiziert hat, trotz seines Unverschuldens stigmatisiert, jedoch deutlich weniger als ein bisexueller Mann oder ein intravenöser Drogenkonsument, die zusätzlich zu ihrer Erkrankung auch noch für ihre Andersartigkeit und Normabweichung stigmatisiert werden.
Auch wenn schon kurz nach der Entdeckung des Virus die Übertragungswege von HIV bekannt waren, halten das Misstrauen und die Angst in der Bevölkerung vor einer Ansteckung im alltäglichen Umgang hartnäckig an (Herek, Widaman & Capitanio, 2005; Vanable et al., 2006). In einer deutschen Studie von 2010 konnte festgestellt werden, dass falsche Vorstellungen, wie z. B., dass eine HIV-Übertragung durch die Benutzung einer öffentlichen Toilette stattfinden kann, die stigmatisierende Einstellung gegenüber HIV-Positiven im Wesentlichen bestimmen können (Von Collani, Grumm & Streicher, 2010).
Wie wirkt sich das Stigma, das HIV/AIDS umgibt, aber auf die Betroffenen aus? Ein wichtiger Punkt, der bereits in der Stigmaforschung bei nicht sichtbaren Stigmata immer wieder genannt wurde, ist disclosure, die Offenlegung des Merkmals bzw. das Stigma-Management, das kognitive Ressourcen kostet und emotionalen Stress verursacht (Goffman, 1994; Pachankis, 2007; Quinn, 2006). Wenn jemand seinen positiven HIV-Status preisgibt, besteht für ihn immer die Gefahr, zurückgewiesen, abgelehnt, gemieden oder benachteiligt zu werden. Viele Menschen verheimlichen ihren HIV-Status bzw. teilen ihn nur engsten Verbündeten mit, um sich und ihre Familien keiner möglichen Stigmatisierung und Diskriminierung auszusetzen. Den eigenen HIV-Status zu verheimlichen, kann ein Konstrukt aus Lügen involvieren und extrem kraft- und energieaufwendig sein (Persson, Barton & Richards, 2006). Gleichzeitig verhindert es die Chancen auf emotionale und soziale Unterstützung, die als wichtiger Puffer gegen den Stress von Stigmatisierung fungieren kann (Andrinopoulos et al., 2011; Logie & Gadalla, 2009; Stutterheim et al., 2011; Vanable et al., 2006). Eine HIV-positive Frau vergleicht das Verheimlichen ihres HIV-Statuses mit einem Grenzübergang, der zwei Welten voneinander trennt:
The hardest thing (…) is the energy that it takes to maintain this two-lives thing of, ‘I’m a person in the world and there’s nothing different about me and then there’s this other world I go home to every night.’ It’s like crossing through a passport check every day. No one else can see the border. But I know, every day I go out to work I’m crossing the border out into the world where no one knows about the HIV. And everything I do or say has to be filtered through this, by now, highly automated filtration process, censoring process, which adjusts the image of me, and modulates it and tints it, so that I’m always presenting a picture to the world that is as closely as I can safely take it to the real thing, to keep the pressure off me. (Persson et al., 2006, S. 22 f.)
Die Wahrnehmung von Stigmatisierung der Krankheit hat einen negativen Effekt auf das psychosoziale Wohlbefinden der Betroffenen. Vor allem dann, wenn vermeidende Bewältigungsstrategien eingesetzt werden. Den Gesundheitsstatus konsequent zu verheimlichen, kann den Krankheitsverlauf von HIV beschleunigen (Logie & Gadalla, 2009; Sanjuán, Molero, Fuster & Nouvilas, 2012). Sich aus Angst und Scheu erklären zu müssen oder die Angst vor weiteren stigmatisierenden Erlebnissen kann auch zur Unterbrechung der Medikamenteneinnahme oder der regelmäßigen Arztbesuche führen. Bei einer unregelmäßigen oder unterbrochenen Einnahme der HIV-Medikamente bzw. der Abnahme von Blutproben können sich leichter Resistenzen des Virus bilden. Er kann nicht mehr effektiv kontrolliert werden, und es kann zum Ausbruch von AIDS führen (Vanable et al., 2006).
In einer explorativen Faktorenanalyse zur Messung von Stigma an HIV-positiven und an AIDS erkrankten Menschen konnten Berger, Ferrans und Lashley (2001) neben dem Faktor der Offenlegung des Stigmas, der Items bezüglich der Informationskontrolle und Angst vor ungewolltem disclosure beinhaltet, noch drei weitere Faktoren feststellen, die das psychosoziale Wohlbefinden einschränken. Der Faktor personalisiertes Stigma umfasst persönliche Erlebnisse und erwartete Reaktionen anderer auf das Stigma, wie Ablehnung oder Vermeidung. Im Faktor negatives Selbstbild werden Gefühle, wie Scham, Schuld und Unreinheit, aufgrund der HIV-Infektion erfasst. Der vierte Faktor Bedenken über die öffentliche Meinung bezüglich Menschen mit HIV beinhaltet Items darüber, wie die breite Masse negativ bezüglich HIV denken und reagieren könnte (Berger et al., 2001).
Ein Großteil der HIV-Positiven internalisieren ihr Stigma und fühlen sich beschämt aufgrund der Krankheit (Lawless et al., 1996; Persson et al., 2006). Eine junge Frau reflektiert, wie es ihr nach der HIV-Diagnose erging: „ (…) when I was first diagnosed I felt so dirty, like everything about me was (…) unsafe and unclean and my blood was just full of crap. Just the whole thing was very internalized“ (Persson et al., 2006, S. 10). Vor allem kurz nach der HIV/AIDS-Diagnose kann eine hohe Selbststigmatisierung und ein Mangel an unterstützenden Netzwerken zu einem höheren Erleben von Depression, Angst und Hoffnungslosigkeit führen (Lee, Kochman & Sikkema, 2002). Internalisiertes Stigma wirkt sich auch negativ auf disclosure aus und verhindert den Aufbau von sozialer Unterstützung, die das negative Erleben mindern könnte. Es bildet so einen Teufelskreis, indem sich die HIV-positive Person mehr und mehr zurückzieht (Clum, Chung & Ellen, 2009).
Wie belastend sich die HIV-Stigmatisierung auf die Betroffenen auswirkt, ist stark abhängig von dem situationsbedingten Kontext, in dem sie auftritt. So wird vor allem Ablehnung innerhalb der eigenen Familie mit starkem psychologischem Stress wahrgenommen. Auch negative soziale Interaktionen mit Personen aus dem Gesundheitswesen, die eigentlich über die Krankheit informiert sein sollten, tragen stark zu einer Verschlechterung des psychosozialen Wohlbefindens bei (Stutterheim et al., 2009; Wagner et al., 2010).
Doch auch auf politischer Ebene macht sich das HIV-Stigma bemerkbar. In ihrer persönlichen Freiheit kann eine HIV-Infektion die Betroffenen auch beim Reisen und Leben im Ausland einschränken. So ist beispielsweise eine Auswanderung mit einer HIV-Infektion in viele Länder (z. B. Australien, Neuseeland oder Kanada) nicht oder nur unter sehr erschwerten Bedingungen möglich. Auch wenn Länder, wie die USA oder China, 2010 ihre Einreiseverbote für HIV-Positive aufgehoben haben, verbieten derzeit noch 39 Länder eine Einreise aufgrund einer HIV-Infektion (Wiessner & Lemmen, 2012).
Die Messung des HIV-Stigmas und vor allem der Vergleich der Ergebnisse verschiedener Studien stellen sich in der Forschung als problematisch und als Herausforderung dar. Es werden weder konsistente Definitionen noch einheitliche Messinstrumente verwendet. Zusätzlich ist es durch die verschiedenen Schichten schwer, das HIV-Stigma von anderen Stigmata, wie z. B. gegenüber Homosexuellen, Drogenabhängigen oder Menschen anderer Herkunft, abzugrenzen. Auch der Mehrebenenansatz muss berücksichtig werden. Das HIV-Stigma wirkt sich nicht nur auf persönlicher und interpersonaler Ebene aus, sondern anhand sozialer Normen auch auf die Gemeinschaft sowie durch Gesetze und Richtlinien ebenso auf die Makroebene von Ländern und Gesellschaft (Logie & Gadalla, 2009; Logie, James, Tharao & Loutfy, 2011; Mahajan et al., 2010; Sandelowksi, Barosso & Voil, 2009).
2.3 Frauen mit HIV/AIDS
Obwohl 1981 unter den ersten bekannten AIDS-Fällen auch Frauen waren, begann ein Fokus auf Frauen in der Forschung erst über ein Jahrzehnt später. Frauen waren zu Beginn von HIV/AIDS eine wachsende Randgruppe, der keine oder nur wenig Beachtung geschenkt wurde. Die Aufmerksamkeit lag zunächst auf Prostituierten und weiblichen Heroinabhängigen. Sie wurden als „Virusüberträger“ von den Medien hart beschuldigt, ihre Kinder und die Gesellschaft einer tödlichen Gefahr auszusetzen. Frauen, die keiner definierten Risikogruppe angehörten, wurden anfangs weder routinemäßig auf HIV getestet noch mit AIDS diagnostiziert. Ärzte waren oftmals überrascht, wenn sich nach einem viel zu spät erfolgten Test herausstellte, dass die Frauen mit HIV infiziert waren und bereits AIDS entwickelt hatten (Hackl, Somlai, Kelly & Kalichman, 1997; Lawless et al., 1996; Meulen, 2007; Sacks, 1996; Wiener, 1991). Eine HIV-positive Frau berichtet darüber: „I was sick for about three months … and because I was white middle-class heterosexual no history of IV drug use or sex work they didn’t test me for HIV“ (Lawless et al., 1996, S. 1373).
In den heutigen wissenschaftlichen und klinischen Untersuchungen sind Frauen immer noch stark unterrepräsentiert, auch wenn sie mittlerweile mehr als die Hälfte aller HIV-positiver Menschen weltweit ausmachen und einem höheren Risiko ausgesetzt sind, sich über Geschlechtsverkehr mit HIV zu infizieren als Männer. Frauen werden in der Forschung hauptsächlich unter biologischen Aspekten untersucht. Ein Schwerpunkt liegt auf den Ansteckungsrisiken und der Mutter-Kind-Übertragung mit HIV. Soziale Aspekte und das Erleben der Frauen stehen im Hintergrund. In medizinischer Hinsicht besteht in der Forschung ein großer Nachholebedarf in Studien, die die spezielle Konstitution von HIV-positiven Frauen in Hinblick auf das Altern, die physischen Veränderungen im Krankheitsverlauf und die Reaktionen auf HIV-Medikamente untersuchen (Carvalhal, 2010; Meulen, 2007; Sandelowski et al., 2009; Wilcock & Lennon, 2009). Die Gleichberechtigung der Frauen in der HIV/AIDS-Epidemie wird in den letzten Jahren zwar immer wieder als wichtiger Punkt genannt und gefordert, die Praxis sieht jedoch immer noch anders aus. Nur jedes zweite Land in Nordamerika, West- und Zentraleuropa integriert Frauen in die HIV-Strategien der Regierung, und nur in jedem fünften Land wird dafür auch ein finanzielles Budget bereitgestellt (UNAIDS, 2010a).
Frauen werden häufig während des medizinischen Screenings innerhalb der Schwangerschaft mit HIV diagnostiziert oder, wenn sie bereits die ersten Symptome der Krankheit aufzeigen. Eine HIV-Diagnose ist für sie zunächst ein Schock, da sich viele von ihnen keiner Ansteckungsgefahr ausgesetzt gesehen haben. Die Mehrheit von ihnen hat sich über einen sexuellen Kontakt und nicht über Spritzbesteck oder Prostitution infiziert (Anderson & Doyle, 2004; Bruning, 2009; Carr & Gramling, 2004; Enriquez et al., 2010; Lawless et al., 1996; Wilcock & Lennon, 2009). Neben den medizinischen Anforderungen, die eine HIV-Erkrankung mit sich bringt, müssen sich die Frauen auch vielen sozialen Herausforderungen stellen. Da sie häufig ökonomisch schlechter gestellt sind als Männer, bilden sich zusätzliche Hürden für sie. Vor allem dann, wenn sie nicht nur für sich selbst, sondern auch für ihre Kinder zu sorgen haben. Im Vergleich zu HIV-positiven Männern stehen viele HIV-positive Frauen unter einer Doppelbelastung, da sie zusätzlich auf die verantwortungsvolle Rolle als Mutter festgelegt sind. Trotz der Krankheit und dem damit einhergehenden Energieverlust kümmern sie sich weiter um ihre Familie und erfüllen das gesellschaftliche Erwartungsbild als Mutter, ihre Kinder zu versorgen. Die Folgen für die Frauen sind hier zweigeteilt: Entweder opfern sie sich für ihre Kinder auf und vernachlässigen die eigene Gesundheit, oder sie leben aufgrund ihrer Diagnose gesünder und versuchen, gut für sich selbst zu sorgen. Es sind oft die eigenen Kinder, die dem Leben der Frauen nach ihrer HIV-Diagnose Kraft und Sinn geben (Broun, 1999; Carvalhal, 2010; Hackl et al., 1997; Ndlovu et al., 2010; Walker, 2002).
Frauen mit einer HIV-Infektion leiden signifikant häufiger an Depressionen und Angststörungen als HIV-negative Frauen, und sie fühlen sich weniger von Partnern, Freunden und Familie unterstützt als HIV-positive Männer (Bing et al., 2001; Carvalhal, 2010; Gordillo et al., 2009; Morrison et al., 2002). Auch ihre Lebensqualität leidet. In der U.S. amerikanischen Studie von Siegel, Schrimshaw und Lekas (2006) berichtet jede dritte Frau nach ihrer HIV-Diagnose über sinkende Partizipation und Freude am Sex. Als Gründe nennen sie: Sorge, den Partner mit dem Virus zu infizieren, den Verlust an Freiheit und Spontanität sowie die Angst vor emotionalen Verletzungen. Viele der Frauen werten ihre Chancen auf Sex und eine glückliche Partnerschaft aufgrund ihres HIV-Statuses ab und fühlen sich sexuell nicht mehr attraktiv für andere.
HIV-positive Frauen sind oftmals mit ihrer Diagnose auf sich allein gestellt. Von anderen HIV-positiven Frauen, mit denen sie sich austauschen können, fühlen sie sich häufig isoliert: „I know I’m not the only one, but it feels like I am“ (Hackl et al.1997, S. 5). Dies unterscheidet HIV-positive Frauen wesentlich im Vergleich zu HIV-positiven homosexuellen Männern in der westlichen Welt, die durch die Gay Community stärker miteinander vernetzt sind und für die es aufgrund ihrer hohen Zahl mehr Unterstützungsangebote gibt (Logie et al., 2011; Wiener, 1991).
Die große Mehrheit der HIV-positiven Frauen ist in einem gebärfähigen Alter oder hat bereits Kinder. Viele von ihnen leben ohne Partner und allein mit ihren Kindern. Für die Frauen ist das Management der eigenen Krankheit und die Rolle als versorgende Mutter ein Balanceakt, in dem es schwer ist, neben den Kindern auf die eigenen Bedürfnisse einzugehen. Ein besonders häufiger Stressfaktor für die Frauen ist die Sorge um die eigenen, bereits geborenen Kinder. Den Frauen stellt sich oftmals die Frage, wer sich um ihre Kinder kümmert, wenn sie selbst erkranken. Aber auch die Reaktionen der Kinder auf die HIV-Diagnose und ihre mögliche Isolation und Stigmatisierung durch andere belasten die Frauen stark (Enriquez et al., 2010; Hackl et al., 1997; McDonald, 2012; Ndlovu et al., 2010). Besonders schwer trifft es Frauen, die ihre HIV-Infektion, oft aus Unwissenheit, bei der Geburt oder durch das Stillen an ihr Kind weitergegeben haben. Eine Mutter drückt ihren Schmerz darüber so aus: „A mother should be able to protect her child. Not only can I not do that, I have killed him just by bringing him into that world“ (Broun, 1999, S. 122).
Durch die neuen Therapiemöglichkeiten haben sich für HIV-positive Frauen im Vergleich zu den Anfangsjahren der Krankheit aber auch positive Zukunftsperspektiven ergeben. Bis 1996 bedeutete ein positiver HIV-Test für viele Frauen, Männer und Kinder ein leidvolles Leben auf kurze Zeit. Seit der Einführung der hochwirksamen antiretroviralen Therapie hat sich die Lebenserwartung HIV-Positiver jedoch stark verlängert und das Risiko, dass eine Mutter den Virus an ihr Kind weitergibt, konnte auf unter 2 % verringert werden. Auch HIV-positive Frauen haben den Wunsch und das Bedürfnis, selbst Kinder zu bekommen. Durch die medizinische Prävention ist mittlerweile eine relativ sichere Familienplanung auch für sie möglich (De La Cruz, Davies & Stewart, 2011; Loutfy, Sonnenberg-Schwan, Margolese & Sherr, 2012). Für die Frauen kann diese Möglichkeit jedoch Segen und Fluch zugleich bedeuten. Neben der Angst, ihr Kind vielleicht doch mit HIV zu infizieren, kann eine Schwangerschaft auch eine zusätzliche körperliche und emotionale Belastung darstellen. Frauen sehen sich gezwungen, ihren HIV-Status während der Schwangerschaft und nach der Geburt des Kindes in der Öffentlichkeit zu verheimlichen. Vor allem durch den Verzicht des Stillens, der die Mutter-Kind-Übertragung verringert, kann es erforderlich sein, sich auf neugierige Fragen durch Lügen erklären zu müssen. Zusätzlich fühlen sich die Frauen häufig in ihrem nahen Umfeld unter Druck gesetzt, ihre Entscheidung für ein Kind zu rechtfertigen. Alte Glaubensmuster von Ärzten, Familien und Freunden über die Verantwortungslosigkeit HIV-positiver Frauen mit einem Kinderwunsch sitzen immer noch tief (Craft, Delaney, Bautista & Serovich, 2007; McDonald, 2012; Wagner et al., 2010).
HIV unter Frauen ist heute längst keine Krankheit mehr, die nur in sozialen Randgruppen auftritt. Die Frauen sind sich aber über das stigmatisierte Bild, welches in den Köpfen ihrer Mitmenschen über sie als Krankheitsträger herrscht, bewusst. Viele von ihnen wünschen sich mehr Aufklärung darüber, dass HIV in allen gesellschaftlichen Schichten auftreten kann und dass ein einmaliger ungeschützter sexueller Kontakt für die Infektion ausreicht. Sie sind müde, immer wieder die Frage „Woher hast du es denn?“ beantworten zu müssen und womöglich zu erklären, dass sie weder Drogen genommen noch als Prostituierte gearbeitet haben (Moneyham et al., 1996). Eine erfolgreiche Geschäftsfrau aus Sydney reflektiert darüber, wie HIV-positive Frauen in der Gesellschaft wahrgenommen werden:
They’re sort of promiscuous, a bit dirty, undesirable, (…) people still really don’t know very much. (…) I think if the mums at school knew that I have it, they would just fall over. They wouldn’t expect it (…) because I don’t fit into the model of who has HIV. (Persson et al., 2006, S. 13)
3 Methodisches Vorgehen
Im weiteren Verlauf der Arbeit wurde anhand der internationalen Forschungsliteratur das HIV-Stigma für Frauen innerhalb von Industrienationen systematisch untersucht. In den Ergebnissteil der Literaturarbeit gehen insgesamt 23 Texte ein, die im Zeitraum von 1996 bis 2012 publiziert worden sind (s. Tabelle 1).
3.1 Literatursuche
Die Forschungsliteratur wurde im Oktober und November 2012 anhand von Fachdatenbanken auf relevante Zeitschriftenartikel untersucht. Über PubMed wurde die Datenbank MEDLINE und über EBSCO die Datenbanken PSYNDEX, PsycINFO und PsycARTICLES durchsucht. Zusätzlich wurde die Datenbank von Springer Link nach Artikeln durchsucht. Suchwörter waren „stigma“, „HIV“, „AIDS“, „women“, „females“, „HIV-disclosure“, die auch miteinander kombiniert wurden. Nach einer ersten Trefferquote von jeweils ca. 300-500 Artikeln wurden diese anhand des Titels und Abstracts systematisch auf ihre Relevanz untersucht. Für einen Volltextzugriff ausgewählter Artikel wurde auch die Elektronische Zeitschriftenbiblothek, mit den Lizenzen der Universitätsbiblotheken Hagen und Leipzig, genutzt. Durch eine Rückwärtssuche anhand der Literaturverzeichnisse bereits ausgewählter Arbeiten wurden weitere relevante Artikel gefunden. Diese wurden zum Teil auch über Open Access im Internet recherchiert. Es wurde darauf geachtet, dass die Artikel als peer reviewed gelten und den wissenschaftlichen Standards entsprechen. Bei der Studie von Bruning (2009) handelt es sich um eine anerkannte, jedoch nicht in einer Fachzeitschrift veröffentlichte Masterarbeit. Diese Arbeit wurde durch persönliche Kontakte vermittelt und aufgrund der hohen Relevanz zum Thema mit einbezogen.
[...]
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Erstausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2013
- ISBN (Paperback)
- 9783955492984
- ISBN (PDF)
- 9783955497989
- Dateigröße
- 227 KB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- FernUniversität Hagen
- Erscheinungsdatum
- 2015 (Februar)
- Note
- 1
- Schlagworte
- Immigrant Stigma AIDS USA Coping
- Produktsicherheit
- BACHELOR + MASTER Publishing