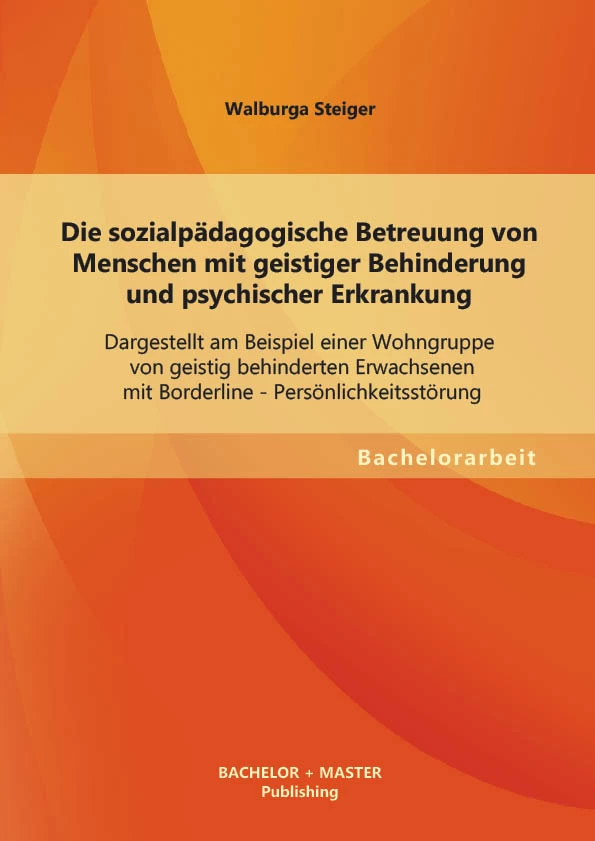Die sozialpädagogische Betreuung von Menschen mit geistiger Behinderung und psychischer Erkrankung: Dargestellt am Beispiel einer Wohngruppe von geistig behinderten Erwachsenen mit Borderline - Persönlichkeitsstörung
Zusammenfassung
Ein weiterer Punkt behandelt sozialarbeiterische Prinzipien und pädagogische Konzepte in der Arbeit mit intelligenzgeminderten psychisch kranken Menschen. Er stellt dar, welches Menschenbild der Arbeit zugrunde liegt und beschreibt den Alltag in einer Wohngruppe. Weiterhin werden sozialpädagogische Methoden und Interventionsmöglichkeiten erklärt. Auch wird beschrieben, wie mit Krisen umgegangen werden kann und welche Anforderungen an die Mitarbeiter in einer Wohngruppe gestellt werden.
Das Fazit befasst sich schließlich mit den zu ziehenden Schlussfolgerungen und mit der Frage, inwieweit die sozialpädagogische Betreuung von geistig behinderten Menschen sie in ihrer Weiterentwicklung zu fördern vermag sowie mit den Anforderungen an Staat und Gesellschaft.
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
3. Geistige Behinderung – Intelligenzminderung
Es gibt bis heute keine einheitliche Charakteristik der geistig behinderten Menschen und damit auch keine einheitliche Definition.
Eine der gängigsten Definitionen stammt von Georg Theunissen, einem deutschen Pädagogen. Er formuliert, dass geistige Behinderung kein objektiver Tatbestand sei, „vielmehr handelt es sich hierbei um ein soziales Zuschreibungskriterium, um ein subjektives Werturteil, weswegen es präziser wäre, nicht (wie häufig der Einfachheit halber) von geistig behinderten Menschen zu sprechen, sondern von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, die als geistig behindert bezeichnet (etikettiert) werden.“[1]
Medizinisch ausgerichtete Diagnoseinstrumente wie die International Classification of Diseases (ICD-10) sprechen von der geistigen Behinderung als „Intelligenzminderung“, das heißt, diese Definition ist stark am Intelligenzquotienten orientiert, was durchaus kritisch betrachtet werden muss. Denn IQ-Tests sind bei diesem Personenkreis schwierig durchzuführen und lassen nicht unbedingt Rückschlüsse zu auf die Qualität eines Lebens.
Klassifikation der geistigen Behinderung nach ICD-10
Klassifikation IQ-Werte Anteil
Leichte Intelligenzminderung 50 – 69 80 %
Mittelgradige Intelligenzminderung 35 – 49 12%
Schwere Intelligenzminderung 20 – 34 7%
Schwerste Intelligenzminderung < 20 1%
3.1. Definitionen psychischer Störungen bei geistig behinderten Menschen
Eine mögliche Definition formuliert Dr. Christian Schanze, Pädagoge und Psychiater:
Auf der Grundlage des Geistigbehindertenbegriffes der Weltgesundheitsorganisation WHO beschreibt er zwei Elemente der Definition für Intelligenzminderung: Zum einen die „Abweichung der Intelligenzleistung von mehr als zwei Standardabweichungen von einer statistisch als normalverteilt vorausgesetzten Intelligenz in der Allgemeinbevölkerung (Gauß´sche Normalverteilungskurve):“ Dieser Begriff ist allerdings kritisch zu hinterfragen, weil er die statistische Abweichung von einer als Norm postulierten kognitiven Leistungsfähigkeit darstellt und damit dem Individuum nicht gerecht wird.
Zum anderen die „Beeinträchtigung der Fähigkeit des adaptiven Verhaltens (...) Hierunter versteht man die eingeschränkte Fähigkeit kognitive Leistungen auch in situativ angemessenes Verhalten umsetzen zu können, was Voraussetzung für eine selbstständige Lebensbewältigung ist.“[2]
3.2. Diagnostik und Diagnosesysteme
Schanze stützt aus fachärztlicher Sicht die Diagnostik der Intelligenzminderung auf vier Säulen: die Fremdanamnese durch die Eltern, Fremdanamnese durch Mitarbeiter von versorgenden Behinderteneinrichtungen, Intelligenztests und körperliche Untersuchung, die durch spezielle Blutuntersuchungen und eventuell durch eine genetische Untersuchung ergänzt wird.
Die international gültigen Diagnose- und Klassifikationssysteme, die zum Ziel haben, allgemein übereinstimmende Kriterien und Bezeichnungen für psychische Störungen zu erstellen, sind:
Die „Internationale Klassifikation psychischer Störungen (ICD-10), in englischer Sprache: „International Classification of Diseases (ICD 10)“
Das „Diagnostische und Statistische Manual Psychischer Störungen“ (DSM-IV)
Diese beiden Schemata werden ergänzt durch durch das „Diagnostic Manual for Persons with Intellectual Disabilities (DM-ID), herausgegeben von Robert Fletcher, Earl Loschen, Chrissoula Stavrakaki und Michael First. Dieses Manual hat zum Ziel, die psychiatrische Diagnosestellung bei intelligenzgeminderten Menschen zu erleichtern.
Es gibt mehrere Diagnoseinstrumente, deren Beschreibung jedoch den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde, daher seien sie nur kurz genannt: Das „PAS-ADD“ (Psychiatric assessment schedule for adults with developmental disabilities ) besteht aus drei Teilen und wurde 1996 in England entwickelt. Das „Dash II“ (Diagnostic assessment for several handicapped) ist ein Diagnoseimstrument für Menschen mit schwerer Intelligenzminderung.
Die „MESSIER“ (Matson evaluation of social skills for individuals with severe retardation) ist eine Bewertungsskala für die sozialen Fertigkeiten bei Menschen mit einer schweren Intelligenzminderung.[3]
3.3. Die Borderline-Persönlichkeitsstörung
Wenn nun zur geistigen Behinderung eine psychische Erkrankung hinzukommt, dann sind alle diejenigen, die mit diesen Menschen zu tun haben, aufs Äußerste gefordert.
Besonders Borderline-Persönlichkeitsstörungen sind sehr geeignet, um Mitarbeiter und Therapeuten zur Verzweiflung zu bringen. Im Therapeute-Jargon werden Borderline-Persönlichkeiten auch „Therapeutenkiller“ genannt.
Der Begriff als solcher ist relativ neu, obwohl die Störung, die mit ihm beschrieben wird, schon lange bekannt ist. Im 17. Jahrhundert berichtete der englische Arzt T. Sydenham von Menschen, die äußerst launenhaft seien und zwischen Liebe und Hass hin und her pendelten.
Auch neigten sie zu plötzlichen emotionalen Ausbrüchen.
„Obwohl die Störung somit schon lange bekannt ist, fiel die Zuordnung der Phänomene zum Krankheitsverständnis der Medizin zunächst schwer. Im klassischen psychiatrischen Krankheitsverständnis wurden Krankheiten vor allem nach ihren vermuteten Ursachen unterschieden. Die Borderline-Störung galt dabei als Übergangsform zwischen den Schizophrenien und den Neurosen. Daraus entwickelte sich der Begriff „Grenzpsychose“ (englisch: „Borderline psychosis“ ). Die Erkenntnis, dass die Ursachen für psychische Erkrankungen sehr vielfältig sind (multi-faktorielle Krankheitsverursachung, variabler Verlauf und damit eingeschränkte Vorhersehbarkeit), führte schließlich zur Entwicklung eines neuen Krankheitsmodells, dem Stress-Diathese-Modell. Ausgangspunkt für die Entstehung einer psychischen Erkrankung sind nach diesem Modell Anfälligkeitsfaktoren (Dispositionen). Diese Dispositionen setzen sich jeweils aus Anlage- und Umweltfaktoren zusammen, etwa aus Besonderheiten der psychosozialen Entwicklung. Die Krankheit bricht aus, wenn der in diesem Sinne „anfällige“ Mensch einer besonderen Belastung ausgesetzt ist (Stress). Der Verlauf der Erkrankung wird dann nicht allein von der Krankheit, sondern auch von zahlreichen anderen Faktoren bestimmt, zum Beispiel der Krankheitsbewältigung und der Qualität der sozialen Unterstützung. Nach dem gegenwärtigen Wissen gilt auch für die Borderline-Störung ein solches Stress-Diathese-Modell.“[4]
Oftmals bestehen neben der Borderline-Störung Begleiterkrankungen wie z. B. Depressionen, Zwänge und Tics, Suchterkrankungen, Essstörungen oder Störungen der Sexualität. Einige entstehen als Folge der Borderline-Störung, andere sind Bewältigungsversuche der Patienten (wie z. B. Substanzmissbrauch).
Das Hauptproblem bei Borderline-Persönlichkeiten ist jedoch die Beeinträchtigung der inneren Ausgeglichenheit und Störungen in den sozialen Beziehungen. Die Suche nach eindeutigen Beziehungen führt zu Irritation und Gefühlschaos. Die Fähigkeit zu Beziehungen ist zwar vorhanden, wird aber von Ambivalenzen und Unsicherheiten geprägt. Borderliner neigen dazu, sehr enge Beziehungen einzugehen und sehr viel von ihnen zu erwarten. Dabei sind sie mit der stetigen Veränderung von Beziehungen, die ja in der Natur der Sache liegen, überfordert. Diese Überforderung löst Angst aus, „…vor allem dann, wenn die Integration unterschiedlicher oder sogar widersprüchlicher Emotionen nicht gelingen mag. Meistens lässt sich durch eine Klärung wieder Sicherheit herstellen, oftmals besteht aber die Ambivalenz weiter und muss dann ausgehalten werden, um die Beziehung aufrechterhalten zu können. Vor allem kann nur durch die Akzeptanz von Ambivalenz gewährleistet werden, dass die Autonomie der Partner nicht verloren geht. Es ist wahrscheinlich, dass dieser Aspekt in Beziehungen im Laufe der Entwicklung regelrecht gelernt wird, etwa bei der Auflösung der anfänglichen Symbiose zu den primären Bezugspersonen.
Weil dieser Prozess mit Angst einhergeht, sind die integrativen Fähigkeiten der Bezugspersonen besonders gefordert. Fehlt diese Unterstützung, kann die Angst erhalten bleiben und die zukünftigen Beziehungen prägen. Dies genau ist bei Borderline-Kranken der Fall.“[5]
In der ICD-10 wird die Borderline-Persönlichkeitsstörung als Unterkategorie der „emotional instabilen Persönlichkeitsstörung“ (F 60.3) geführt: „Eine Persönlichkeitsstörung mit deutlicher Tendenz, impulsiv zu handeln ohne Berücksichtigung von Konsequenzen, und mit wechselnder, instabiler Stimmung. Die Fähigkeit, vorauszuplanen, ist gering und Ausbrüche intensiven Ärgers können zu oft gewalttätigem und explosiblem Verhalten führen. Dieses Verhalten wird leicht ausgelöst, wenn impulsive Handlungen von anderen kritisiert und behindert werden.“[6]
Neben dem sog. impulsiven Typus (F60.30) („ ... mangelnde Impulskontrolle, Ausbrüche von gewalttätigem und bedrohlichem Verhalten sind häufig, vor allem bei Kritik durch andere.“) wird der „Borderline Typus (F60.31) wie folgt definiert: „Einige Kennzeichen emotionaler Instabilität sind vorhanden, zusätzlich sind oft das eigene Selbstbild, Ziele und ‚innere Präferenzen‘ (einschließlich der sexuellen) unklar und gestört. Meist besteht ein chronisches Gefühl innerer Leere. Die Neigung zu intensiven, aber unbeständigen Beziehungen kann zu wiederholten emotionalen Krisen führen mit übermäßigen Anstrengungen, nicht verlassen zu werden, und mit Suiziddrohungen oder selbstschädigenden Handlungen (diese können auch ohne deutliche Auslöser vorkommen).“ (ebd., S. 230)
DSM IV.- Im Diagnostischen und Statistischen Manual Psychischer Störungen (DSM IV) sind folgende Kriterien für eine Borderline-Persönlichkeitsstörung zu finden:
1. verzweifeltes Bemühen, tatsächliches oder vermutetes Verlassenwerden zu vermeiden,
2. Muster instabiler, aber intensiver zwischenmenschlicher Beziehungen, gekennzeichnet durch den Wechsel zwischen den extremen der Idealisierung und Entwertung
3. andauernde Identitätsstörung: ausgeprägte und andauernde Instabilität des Selbstbildes oder der Selbstwahrnehmung
4. Impulsivität in mindestens zwei potentiell selbstschädigenden Bereichen (Geldausgabe, Sexualität, Substanzmissbrauch, rücksichtsloses Fahren, „Fressanfälle“) selbstschädigende Aktivitäten
5. wiederholte suizidale Handlungen, Selbstmordandeutungen oder -drohungen oder Selbstverletzungsverhalten
6. Affektive Instabilität infolge einer ausgeprägten Reaktivität der Stimmung
7. chronische Gefühle von Leere
8. unangemessene, heftige Wut oder Schwierigkeiten, Wut zu kontrollieren
9. vorübergehende, durch Belastungen ausgelöste paranoide Vorstellungen oder schwere dissoziative Symptome
Nach dem DSM IV-Diagnoseschema müssen mindestens fünf der neun Kriterien für das Stellen der Diagnose BPS gegeben sein.
Nach Angaben im DSM-IV wird die Auftretenshäufigkeit der BPS auf 10% bei ambulanten und 20% bei stationären psychiatrischen Patienten geschätzt. Vollendete Suizide kommen bei 8-10% der Betroffenen vor.
Das Verständnis von Persönlichkeitsstörungen hat sich grundlegend gewandelt. Bis vor nicht allzu langer Zeit waren persönlichkeitsgestörte Menschen noch als „Psychopathen“ bezeichnet worden.
Heutzutage werden Persönlichkeitsstörungen immer im Zusammenhang von Eigenschaften eines Menschen in der Interaktion mit seiner Umwelt gesehen. Jeder Mensch hat verschiedene Eigenschaften und Potenziale, die ihn charakterisieren und ihn von anderen Menschen unterscheiden. Ebenso hat jeder Mensch ein Bild von sich selber, und andere machen sich eines von ihm. Das bedeutet, dass ein Mensch immer in Teilaspekten wahrgenommen wird. Einige Eigenschaften treten stärker hervor, und werden dementsprechend wahrgenommen, andere bleiben im Hintergrund.
Jegliche dieser Eigenschaften sind in ihrer Bewertung von ihrem Kontext abhängig. So kann aus der Eigenschaft „zuverlässig“ auch eine Eigenschaft „zwanghaft“ werden, je nachdem in welchem Kontext sie gezeigt wird.
Ebenso können Eigenschaften dazu führen, sich an die Umgebung anzupassen, oder aber in Konflikte zu ihr zu geraten. Erreichen diese konflikthaften Spannungen ein bestimmtes Ausmaß, kann es zu einer Krise kommen.
Wenn die Eigenschaft sich nicht mit der Umwelt vereinbaren lässt, entsteht die Störung. Dagegen wird eine Eigenschaft zur Ressource, wenn sie dazu beiträgt, Aufgaben bewältigen zu können.
Rahn formuliert aus diesem Verständnis von Persönlichkeitsstörungen folgende Konsequenzen:
„ Der Übergang von der Normalität zur Störung ist fließend
Die Störung hat in der Regel eine längere Vorgeschichte
Die Störungen sind meist an eine bestimmte Lebenssituation gekoppelt.“[7]
Das Alltagsverständnis von Persönlichkeit beinhaltet die Verschmelzung der verschiedenen Eigenschaften eines Menschen zu einem Gesamtbild. Diese „Gestalt“ zeigt jedoch nicht immer die vielfältigen Potenziale eines Menschen, aus diesem Grund hat sich in der Psychologie ein anderes Persönlichkeitsmodell etabliert. In diesem werden einzelne Faktoren bestimmt, die eine Persönlichkeit ausmachen.
Heute wird Persönlichkeit anhand von fünf Faktoren betrachtet:[8]
Extraversion: gesellig, humorvoll, optimistisch, zurückhaltend, verschlossen, schweigsam, lebhaft, temperamentvoll
Soziale Verträglichkeit: bescheiden, hilfsbereit, aufrichtig, warmherzig, rücksichtsvoll, altruistisch, mitfühlend, wohlwollend, kooperativ, gutmütig, ehrlich
Gewissenhaftigkeit: hart arbeitend, sorgfältig, zuverlässig, gewissenhaft, fleißig, pflichtbewusst, pünktlich, ordentlich
Neurotizismus: verlegen, nervös, traurig, ängstlich, verletzbar, launenhaft, unsicher
Intellekt: gebildet, wissbegierig, fantasievoll, schlagfertig, einfallsreich, scharfsinnig, interessiert, intelligent, kreativ
Je nachdem, wie diese verschiedenen Eigenschaften gewichtet sind, zeigt sich die Persönlichkeit. Eigenschaften können je nach Situation zu einer Störung führen, oder eben als Ressource von Nutzen sein. In Bezug auf Borderline - Persönlichkeiten ist zu beachten, dass oftmals störende Eigenschaften zunächst als Bewältigungsstrategien entwickelt worden sind.
Beispielsweise reagiert eine Bewohnerin sofort lautstark aggressiv gegen jede Art von Anforderungen oder Bemerkungen, weil dies in ihrem früheren Umfeld die einzige Möglichkeit war, sich zu verteidigen und zu schützen. Hinter der Aggression steckt außerdem auch Angst, die aus einer traumatischen Situation herrührt: In ihrer Grundschulzeit hielten mehrere Kinder sie fest, während zwei andere sie mit den Füllfederhaltern „stachen“ und ihr damit einen großen blauen Fleck auf den Ellbogen tätowierten.
4. Pädagogische Konzepte in Wohngruppen mit geistig
behinderten Erwachsenen und Borderline-Persönlichkeitsstörung
4.1. Sozialarbeiterische Prinzipien und Konzepte
4.1.1. Menschenbild: Würde und Wert des Menschen, Wertschätzung des Individuums
Im Mittelpunkt steht der Mensch mit allen seinen Rechten und Pflichten und auch seinen Bedürfnissen. In Anlehnung an das Grundgesetz, das in Artikel 1 die Würde und den Wert des Menschen postuliert, sieht die Sozialpädagogin die zu Betreuenden als eigenständige, mit eigenem Willen und eigenen Wünschen ausgestattete Menschen.
Die pädagogische Grundhaltung hier ist die Wertschätzung und bedingungslose Annahme.
4.1.2. Autonomie, Individualisierung
Der geistig behinderte Mensch hat ebenso das Bedürfnis nach Autonomie wie der nicht Behinderte. Dazu ist sozusagen „Selbst-Ermächtigung“ notwendig, die Betroffenen werden sich ihrer Ressourcen bewusst und entwickeln Fähigkeiten, mit Problemen umzugehen.
Aufgabe der Sozialpädagogin ist dabei, den geistig behinderten Menschen zu beraten und zu begleiten, ohne ihn zu bevormunden oder einzuengen. Der zu Betreuende ist dabei als Individuum zu sehen, denn jedes Problemverhalten ist in der Praxis einzigartig und kann nicht durch generalisierte Behandlungsmethoden „geheilt“ werden. Der Mensch soll ermutigt werden, eigene, oft verborgene Fähigkeiten und Stärken zu entdecken und weiter zu entwickeln, um Selbstvertrauen zu gewinnen und an der eigenen Lebensgestaltung teilzuhaben.[9]
Theunissen nennt es einen „weitverbreiteten Irrtum, anzunehmen, es gebe in der Heilpädagogik allgemeingültige Förderkonzepte oder Behandlungsformen.
Nur ein individualisiertes Konzept könne zum Erfolg führen. Das bedeutet, „ ‚von der Person, mit ihr und für sie’“ ein Konzept zu entwickeln.“[10]
4.1.3. Lebensweltorientierung
Alle heilpädagogischen Maßnahmen und Angebote kommen erst voll zur Geltung, wenn sie in die Lebenswelt des geistig behinderten Menschen integriert werden. Denn die Umwelt bestimmt mit, wie sich ein Mensch entwickelt und verändert, so dass das soziale Bezugsfeld durchaus hemmend oder fördernd wirken kann. Dies muss in der pädagogischen Arbeit mit berücksichtigt werden.
Lebensweltorientierung bedeutet auch Alltagsorientierung. Die Lebenswelt des geistig behinderten Menschen in einer Institution besteht jedoch nicht nur aus Wohngruppe und Werkstätte, sondern auch aus Nachbarschaften, Freizeitstätten, kulturellen Orten oder auch ganz profan dem Einkaufszentrum.
Das Heim bietet Möglichkeiten, den besonderen Bedürfnissen geistig behinderter Menschen gerecht zu werden. Innerhalb dieses geschützten Raumes können die Menschen Entlastung und Anregungen finden, ihre speziellen Möglichkeiten zu entwickeln. Das Heim ist auf Dauer ausgerichtet, im Gegensatz zur Familie. Denn auch wenn Mitarbeiterinnen und Bewohner wechseln, so bleibt doch das Heim als Institution bestehen.
Die Mitarbeiterinnen als professionell Handelnde haben Eltern und Familien gegenüber den Vorteil, dass sie sich auf die Heimbewohner einlassen können, ohne von eigenen bitteren Erfahrungen und Enttäuschungen belastet zu sein.
Die Problematik des Heimes liegt darin, dass es zwar den Bewohnerinnen und Bewohnern einen entlasteten und freien Lebensraum bieten will, dies aber nur innerhalb bestimmter Rahmenbedingungen verwirklichen kann. Das Leben ist in besonderer Weise organisiert und institutionalisiert, wird von Strukturen wie Verwaltung und Therapien bestimmt. Besonders in Heimen für Behinderte besteht die Gefahr, dass die Pädagogik als Kunst und Umgangselement gegenüber den anderen Aufgaben der Pflege und Therapie ins Hintertreffen gerät, dass sie als zweitrangig betrachtet (und bezahlt) wird.[11]
Der Einsatz von pädagogisch nicht ausgebildeten Pflegehelfern und schlecht oder gar nicht bezahlten Praktikantinnen in immer größerem Maß zeigt dies ebenfalls.
4.1.4. Inklusion
Geistige Behinderung ist einer der Hauptrisikofaktoren, von sozialer Exklusion bedroht zu sein. Inklusion bedeutet aber nicht nur Einbeziehung in soziale, sondern auch in wirtschaftliche Systeme. Der „normale“ Mensch ist erwerbstätig und ist gleichzeitig Konsument. Geistig behinderte Menschen sehen sich einer verschlechterten Beschäftigungslage ausgesetzt, dies wirkt sich auch auf das Einkommen aus. Aber auch in den Bereichen Bildung, Zugang zu Umwelt und Dienstleistungen, Mobilität und Zugang zu Information und Kommunikation sind behinderte Menschen sozusagen von Ausschluss bedroht.[12]
Inklusion bedeutet, nicht erst zu separieren, um dann wieder einzuschließen, sondern von vornherein sozusagen „eingeschlossen“ zu lassen, im Unterschied zur Integration.
Konsequent weitergeführt bedeutet dieser Gedanke, dass Menschen mit Behinderungen in der Gesellschaft als Nachbarn und Bürger akzeptiert werden, dass Begegnungen möglich sind zwischen Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen und alten Menschen mit und ohne Behinderungen und dass sich diese Menschen überall in der Gesellschaft begegnen, sei es im Supermarkt, in der Kneipe oder auf dem Sozialamt.
Theunissen sieht dies sogar als professionelle Aufgabe, die „mit Sicherheit zu einem festen Programm für die Behindertenarbeit (Heilpädagogik) avancieren wird. (...) Letztlich geht es um die (Wieder-) Belebung solidaritätsstiftender und -stabilisierender Bürgergemeinschaften (Nachbarschaften, Kirchengemeinde...), die lebendige Beziehungen zum Anderen, zwischen Professionellen, Betroffenen und der nichtbehinderten Bevölkerung, emotional haltgebende Begegnungen und zugleich auch informelle Unterstützungsformen entstehen lassen. Bis vor kurzem war der Geistigbehindertenpädagogik (Behindertenhilfe) dieses Leitprinzip der „Bürgerzentrierung“ weithin fremd – operierte sie doch fast ausschließlich im Lichte der traditionellen klinisch-therapeutischen Denkfigur.“[13]
4.2. Lebensweltorientierte Arbeit mit Behinderten
Von den genannten Prinzipien habe ich das der Lebensweltorientierung zur ausführlichen Darstellung ausgewählt, weil vor allem nach diesem Prinzip in unserer Einrichtung gearbeitet wird. Dieses Prinzip dient meiner Meinung nach dem betroffenen Menschen am meisten.
Der Begriff „Lebenswelt“ stammt aus der Soziologie und wird von verschiedenen Autoren interpretiert. Hans Thiersch hat den Begriff der Alltagsorientierung erweitert zur „Lebensweltorientierung“ und meint damit: „…den Bezug auf die gegebenen Lebensverhältnisse der Adressaten, in denen Hilfe zur Lebensbewältigung praktiziert wird, meint den Bezug auf individuelle, soziale und politische Ressourcen, meint den Bezug auf soziale Netze und lokale/regionale Strukturen.“[14]
Für Jürgen Habermas ist die Lebenswelt „der transzendentale Ort, an dem sich Sprecher und Hörer begegnen.“[15]
4.2.1. Prinzipien der Lebensweltorientierung
Lebensweltorientierung bedeutet, die Arbeit unter Einbezug des sozialen und räumlichen Umfeldes auf den Alltag des zu Betreuenden auszurichten. Jeder Mensch lebt in seinem „Alltag“, egal ob Staatsoberhaupt oder Kleinbauer. „Alltag“ bedeutet die Bewältigung vielfältigster Probleme und Aufgaben. Das heißt, dass Alltag es erfordert, Kompetenzen zu haben bzw. zu entwickeln und auszubauen.
Nicht zuletzt bedeutet „Alltag“ auch Lernen. Jeder Tag bringt Erkenntnisse und erfordert Aktivität und Überlegung.
Lebenswelt spielt sich auf mehreren Ebenen statt, die ineinandergreifen:
Auf der Mikroebene findet sich der einzelne Mensch mit geistiger Behinderung, die Mesoebene bezeichnet die Ebene der Institutionen und die Makroebene schließlich meint die Ebene der Gesellschaft.
4.2.2. Lebenswelt im institutionalisierten Alltag
Das Wohnheim bietet die Möglichkeit und den Raum, den besonderen Bedürfnissen des behinderten Menschen gerecht zu werden. Es soll Schutz, Entlastung und Anregung bieten, so dass der Mensch gemäß seiner eigenen Möglichkeiten leben und sich entwickeln kann. Die Institution Wohngruppe ist auf Dauer angelegt, im Unterschied zur Familiensituation, und ermöglicht in vielfältiger Weise Lernen, Arbeit und Therapie.
In besonderen Rollen befinden sich die Mitarbeiterinnen, sie sind arbeitsteilig zuständig für die verschiedenen Bereiche der Versorgung und Pflege. Als (hoffentlich) gut ausgebildete professionelle Helfer können sie sich auf die Wohngruppenbewohnerinnen einlassen in ihren jeweiligen Eigenarten, ohne von persönlichen Emotionen wie Enttäuschung, Frustration oder Schuld belastet zu sein.
Die Geschichte eines geistig behinderten Menschen ist ja oftmals geprägt von mühsamer und bitterer Auseinandersetzung seiner Eltern mit eben dieser Behinderung, so dass der Einzug ins Heim ein wirklicher Neuanfang sein kann für einen jungen Menschen.
Freilich birgt die Institution Wohngruppe auch ihre eigene Problematik. Das Dilemma besteht darin, dass die Gruppe zwar einerseits einen entlasteten und freien Lebensraum bieten will, dies aber nur in besonders organisierter institutionalisierter Weise tun kann. Mit der Lebenswelt der Bewohnerinnen und Bewohner verquickt sind die Mitarbeiter, die ihrerseits in zwei verschiedenen Lebenswelten leben (ihrer privaten und der des Heimes), während die Bewohnerinnen ausschließlich im Heim leben. So entsteht eine gewisse Gespaltenheit, die zusätzlich verstärkt wird durch die Strukturen von Verwaltung und Therapie. Je größer das Heim, umso mächtiger wird diese Gespaltenheit. Sie wird dann sichtbar, wenn die Bewohner nur noch in ihrem Funktionieren im Heim gesehen werden, wenn sozusagen nicht das Heim dem Bewohner, sondern die Bewohnerin dem Heim dient.
Ohnehin erlaubt das Leben im Wohnheim nicht allzu große Perspektiven, die zudem momentan überschattet werden von den immer schlechteren Bedingungen, die eine rigide Sparpolitik seitens der Bezirke und der Länder mit sich bringt.
Beispielsweise plant der Bezirk Schwaben, bei Neubauten nur noch Zweibett-Zimmer zu genehmigen und zu bezuschussen. Ich finde dies unglaublich menschenverachtend, denn damit wird dem geistig behinderten Menschen das Recht auf Privatsphäre und Intimsphäre abgesprochen, und seine Selbstbestimmung noch mehr beschnitten, als es ohnehin schon der Fall ist.
Geistig Behinderte sind meist nicht freiwillig in den Heimen, sie werden der Institution einfach unterworfen, und sie können sich üblicherweise ihre Mitbewohnerinnen nicht aussuchen. Daher sollte ein Konzept, das angeblich das Wohl des geistig behinderten Menschen im Mittelpunkt hat, tunlichst auf solcherlei Rückschritte in der Betreuung und Pflege verzichten.
Von dem Prinzip der Hilfe als Selbsthilfe ausgehend, müsste die Hilfe so konzipiert sein, dass das Potential zu einem möglichst selbständigen, eigenverantwortlichen Leben auch gesehen und unterstützt werden kann.
Ansatzpunkt kann ausschließlich das Leben des geistig behinderten Menschen in seinen gegebenen Verhältnissen, also in seinem Alltag sein.
Thiersch plädiert in Bezug darauf für Vielfalt und hält Heimbetreuung nicht für die geeignete Form der Betreuung in Bezug auf Erlangung von Autonomie und Selbständigkeit:
„Notwendig sind Angebote alternativer Lebensräume für Behinderte, die gemäß dem Prinzip der Anpassung an gegebene Lebensverhältnisse vielfältig differenziert sein müssen zwischen den Möglichkeiten von Tagesgruppen, Kurzzeitunterbringung, Lebensgruppen im Heim. Wohngemeinschaften, betreutem Wohnen und Übergängen zum selbständigen Leben. – Heimerziehung ist ein Moment in dieser Kette. Als Arrangement eines neuen, anderen, gelingenderen Alltags ist es prekär. Muss es doch eine überschaubare und transparente Struktur haben. In seinem Lebensarrangement müssen Selbständigkeit und Teilhabe der Beteiligten ebenso gewährleistet sein wie sinnvolle und attraktive Aufgaben eines selbstgestalteten Lebens. Das Heim muß nach außen hin geöffnet sein; das Engagement der ‚Betreuer’, die ja zunächst im Alltag ‚da sein’ und belastbar sein müssen, muss gestützt und aufgewertet werden gegenüber den unterschiedlichen spezialisiert-fachlichen Aufgaben.“[16]
4.2.3. Das Normalisierungsprinzip
Das Normalisierungsprinzip besagt, dass für alle Menschen mit geistigen oder anderen Beeinträchtigungen die Rahmenbedingungen und Lebensmuster geschaffen werden, die den gewohnten Verhältnissen und Umständen der jeweiligen Kultur entsprechen.
„„Das Normalisierungsprinzip bedeutet, dass man richtig handelt, wenn man für alle
Menschen mit geistigen oder anderen Beeinträchtigungen oder Behinderungen
Lebensmuster und alltägliche Lebensbedingungen schafft, welche den gewohnten
Verhältnissen und Lebensumständen ihrer Gemeinschaft oder ihrer Kultur
entsprechen oder ihnen so nahe wie möglich kommen.“ ( Bengt Nirje, Das
Normalisierungsprinzip )“[17]
Normaler Tages-, Wochen- und Jahresrhythmus
Der geistig behinderte Mensch soll wie jeder andere sein Leben individuell gestalten können.
Aufstehen, Mahlzeiten einnehmen nach den eigenen Bedürfnissen, in Urlaub fahren, die jahreszeitlichen Feste erleben.
Dazu gehört auch die Trennung von Arbeit – Wohnen – Freizeit, die für „Normalmenschen“ ja auch selbstverständlich ist.
Normale Erfahrungen im Ablauf des Lebenszyklus
Die verschiedenen Entwicklungsstadien sollen genauso durchlaufen werden können, bspw. Pubertät und Adoleszenz. Auch für geistig Behinderte gilt, dass Erwachsen-Werden mit der Loslösung vom Elternhaus verbunden ist.
Für Senioren soll ein ausreichendes und attraktives Freizeitprogramm möglich sein, ebenso die Mitgliedschaft in Vereinen.
Normalen Respekt vor dem Individuum und dessen Selbstbestimmung
Wünsche, Entscheidungen und Hoffnungen sind zu respektieren und zu akzeptieren.
Einfühlende Aufmerksamkeit ist auch für geistig behinderte Menschen ein Grundbedürfnis, vor allem weil sie sich oftmals nicht auf herkömmliche Weise verständlich machen können.
Mitbestimmung und Selbstbestimmung bei alltäglichen Gegebenheiten wie Kleiderkauf oder Freizeitgestaltung sind selbstverständlich.
Normale sexuelle Lebensmuster ihrer Kultur
Das Erleben von Sexualität und Sinnlichkeit sind auch dem geistig behinderten Menschen zu ermöglichen, ebenso wie das Zusammenleben beider Geschlechter sowie Familie und Elternschaft.
Normale ökonomische Lebensmuster und Rechte im Rahmen gesellschaftlicher Gegebenheiten
Angemessenes Arbeitshonorar und Taschengeld sollen dem geistig behinderten Menschen ermöglichen, den Umgang mit Geld und die damit verbundene Verantwortung zu erlernen.
Die Kosten und die Art der Unterbringung sollen individuell ermittelt werden, je nach Hilfebedarf des Individuums.
Normale Umweltmuster und Standards innerhalb der Gemeinschaft
Geistig Behinderte sollen nicht in abgelegenen Gebieten kaserniert werden, sondern in der Mitte der Gesellschaft leben können. Andererseits darf die Gemeinde durch die Größe der Wohneinrichtung und die Anzahl der Bewohner nicht beeinträchtigt werden.
Die behinderten Menschen sollen so selbständig wie möglich wohnen können.“[18]
Kritische Betrachtung des Normalisierungsprinzips:
Dieses Prinzip stellt einen guten Anfang dar, weist aber einige Lücken auf. So wird zwar für sexuelle Freiheit und sogar Familiengründung plädiert, jedoch kommen andere Formen der Sexualität wie beispielsweise Homosexualität oder Fetischismus nicht vor.
Auf den weit verbreiteten Fetischismus, sei es in harmlosester Form, reagieren Einrichtungen und Mitarbeiter auch heute noch mitunter panisch, die Betreffenden werden oftmals mit Medikamenten „heruntergefahren“ und ruhiggestellt.
Familiengründung ist in den derzeitigen Betreuungsformen für geistig behinderte Menschen so gut wie unmöglich. Es gibt zwar einzelne Projekte dazu. In der allgemeinen Praxis jedoch wird geistig behinderten Menschen die Fähigkeit abgesprochen, Kinder erziehen zu können.
Meine Meinung dazu ist, dass auch geistig behinderte Menschen Kinder haben könnten, vorausgesetzt, sie werden dabei adäquat unterstützt.
Wenn ich überlege, was Kindern in dieser Gesellschaft von sogenannten geistig normalen Menschen alles widerfährt, dann ist für mich klar, dass viele „normale“ Eltern mindestens genauso viel Anleitung und Unterstützung bei der Kindererziehung brauchen wie geistig behinderte Eltern.
Im Allgemeinen ist Elternschaft für geistig behinderte Menschen aber ein Tabu.
So ist das Normalisierungsprinzip als guter theoretischer Weg zu betrachten, der aber weiter ausgebaut werden müsste und vor allem effektiv in die Tat umgesetzt werden müsste
4.3. Der Alltag in einer Wohngruppe
4.3.1. Rahmenbedingungen
Bei Regens Wagner leben im Erwachsenenwohnbereich 10 Bewohner in einer Gruppe. Die einzelnen Gruppen sind in Häusern untergebracht, die mit Einzelzimmern ausgestattet sind. Teilweise haben die Bewohnerinnen eigene Duschen und Toiletten, je nach Hilfebedarf. Die Häuser stehen zusammen auf einem Grundstück, es sind jeweils Terrasse und Schuppen vorhanden. So sind annähernd familiäres Leben, Nachbarschaftskontakte und gruppenübergreifende Angebote möglich.
Die Nutzung von Terrassen und Gärten trägt auch bei zur Entzerrung von Konflikten.
4.3.2. Pflege
Hier ist die fördernde, aktivierende Pflege gemeint, die die selbständige Pflege des eigenen Körpers zum Ziel hat. Respektvoller und wertschätzender Umgang muss selbstverständlich sein, die Hilfe ist hier Anleitung zur Selbsthilfe.
In der Praxis läuft dies so ab, dass der Mitarbeiter den Bewohner beispielsweise verbal anleitet beim Duschen, gegebenenfalls mithilft bei einzelnen Schritten wie Haare waschen oder Abtrocknen. Bewohnerinnen müssen oftmals auch beraten werden, was die Wahl und die Menge des Körperpflegemittels betrifft. Viele brauchen Beratung und Unterstützung im Umgang mit Inkontinenz, von der sehr viele geistig behinderten Menschen betroffen sind.
4.3.3. Hausarbeit, lebenspraktische Assistenz
Die Bewohnerinnen haben innerhalb der Wohngruppe verschiedene Arbeiten zu erledigen wie z.B. Abspülen, Abtrocknen, Spülmaschine ein- und ausräumen, Müll wegbringen, etc.
Bei der Erledigung dieser „Ämter“ unterstützen die Mitarbeiterinnen und geben Anleitung.
Dabei geht es um größtmögliche Verselbständigung des Einzelnen. Das lebenspraktische Tun bietet darüber hinaus ein großes pädagogisches Lernfeld: Kochen, Küchengeräte bedienen, Umgang mit Messer, Tisch decken oder abräumen, Umgang mit Nahrungsmitteln, Einkäufe erledigen, Kleider- und Wäschepflege, Taschengeld verwenden, Telefonieren, An- und Auskleiden, Gestaltung und Pflege des Zimmers, Bettwäsche wechseln etc…
4.3.4. Freizeitgestaltung
Dieser Bereich ist als Sozialisationsfeld enorm wichtig, aber auch um den Alltag abzurunden.
Es gibt eine Vielzahl von Möglichkeiten: Pflege von Hobbies, Spiele, gesellige Feste, Ausflüge, Malen, Basteln, Handarbeiten, Tanz, Theater, Musik, Züchten und Pflegen von Pflanzen, Urlaubsgestaltung, Sport.
Regelmäßig finden Gruppenfreizeiten statt, auch gruppenübergreifende Angebote stehen den Bewohnern zur Verfügung. Tagesausflüge im Sommer werden zum großen Teil von ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern begleitet.
4.3.5. Seelsorgerische Betreuung
Ein wichtiger Aspekt bei Regens Wagner Einrichtungen ist der spirituelle. Es gibt eine gut organisierte Hausseelsorge, ein Pfarrer hält mehrmals in der Woche Gottesdienste und Andachten ab. Er wird unterstützt von einem Diakon, der auch das Seelsorgeteam leitet. Regelmäßig finden in seelsorgerlicher Hinsicht Angebote für die Bewohnerinnen statt, die diese auch sehr gerne annehmen, wie Einkehrtage, Kräuterwanderungen mit Binden eines Kräuterbuschens etc.
Dabei beschränkt sich die Seelsorge durchaus nicht auf den Besuch von Gottesdiensten. Jeder Mitarbeiter wird ermutigt, seelsorgerlich tätig zu sein im Alltag. Zu diesem Thema finden regelmäßig Fortbildungen statt.
Seelsorge bedeutet bei Regens Wagner auch Selbstsorge. Nur wer gut für sich selber sorgen kann, vermag auch für andere gut zu sorgen.
4.3.6. Allgemeine Lebensberatung, Bildungsassistenz
In unserer Einrichtung finden regelmäßige Gespräche mit Sozialdienst und Therapeuten statt, die für die Bewohnerinnen auch sehr wichtig sind. Doch gerade im Wohngruppenalltag sind die Mitarbeiterinnen oft gefordert als Gesprächspartnerinnen und auch Ratgeberinnen.
Leider bleibt für diesen wichtigen Aspekt immer weniger Zeit.
Regelmäßig finden Gruppengespräche statt, an denen alle Bewohnerinnen und Mitarbeiter teilnehmen.
Biografie-Arbeit ist ein wichtiger Aspekt in unserer Einrichtung. Hier werden die Bewohner nicht nur bei der eigenen Lebensrückschau sensibel begleitet, sondern es werden auch Wünsche und Vorstellungen zu eigenen Lebensgestaltung erarbeitet.
Auch die Begleitung des Älterwerdens ist in unserer Gruppe ein Thema, weil die meisten der Bewohnerinnen über fünfzig Jahre alt sind, einige über sechzig.
4.3.7. Psychosoziale Lebenshilfe und Körperliche Aktivierung
Dieser Bereich betrifft vor allem geistig behinderte Menschen, die verhaltensauffällig sind und die zur Kompensation psychischer Krisen und zur Prävention Hilfe benötigen.
Diese findet statt in Form von Therapieangeboten und soll zur psychischen Stabilisierung beitragen. Die Bandbreite reicht vom Einzelgepräch bei der Psychologin über die Snoezelen- und Ergotherapien bis hin zur Hunde- oder Reittherapie.
In diese Kategorie gehören auch Gesprächsrunden zur Aufarbeitung von Problemen, die in der Gruppe auftreten.
4.3.8. Gesellschaftliche Integrationshilfe, kulturelle Partizipation
Geistig behinderte Menschen sind darauf angewiesen, dass ihnen kulturelle Ereignisse von den Mitarbeitern nahegebracht werden. Sie brauchen Begleitung und Ermutigung dabei.
In unserer Einrichtung sind die Bewohnerinnen und Bewohner gut in das dörfliche Leben integriert und nehmen selbstverständlich an allen öffentlichen Veranstaltungen und Festen teil.
Außenaktivitäten wie das Erkunden des nahen und weiteren Lebensumfeldes, örtliche Orientierung, Bewegen im Verkehr und Benutzung von Verkehrsmitteln sowie die Nutzung öffentlicher Dienstleistungen und Ressourcen wie Kaufhäuser, Cafe, Friseur, Kino, Schwimmbad, VHS, Behördengang sind dabei genauso wichtig wie die Öffentlichkeitsarbeit in Form von Zusammenarbeit mit Geschäften oder Cafes, Dienstleistungsbetrieben, Förderung der Nachbarschaftsbeziehungen, Elterntreffen, Besuch anderer Einrichtungen etc…[19]
4.4. Pädagogischer Umgang bei Borderline-Störungen
4.4.1. Pädagogische Prinzipien
Die Borderline-Störung ist eine sehr komplexe, trotzdem gibt es einige Grundregeln um Umgang mit Borderline - Persönlichkeiten, die allgemein gelten können:
- Zunächst Symptome und Probleme klar darstellen, damit realistische Ziele für die Hilfe formuliert werden können. Helfer und alle Betroffenen wie z.B. Mitarbeiterinnen der Werkstätte und Fachdienste sind einzubeziehen
- Fortlaufender Aushandlungsprozess der Beziehungsgestaltung: Grundlage für diese Beziehung ist die Autonomie aller Beteiligten und deren Verantwortlichkeit für das eigene Handeln.
- Möglichst offene Konfrontation mit Problemen: Dazu sind gegenseitige Ehrlichkeit notwendig sowie der Versuch, keine Themen im Dialog zu vermeiden.
- Konkrete Arbeit an der Problemlösung und ein Gefühl für Veränderungen entwickeln: Wichtiger ist das Finden eines möglichen Weges als die Suche nach dem richtigen Weg, denn ein aktiver Umgang mit den Problemen ist der Schlüssel. Dabei ist die Gegenwart am wichtigsten, die Zukunft hat weniger Bedeutung, und beides hat mehr Wertigkeit als die Vergangenheit. Die Beziehung ist auf Veränderung angelegt und von daher auch Veränderungen und eventuell Krisen unterworfen.
Auch die Beziehung zum Helfer wird in diese Überlegungen mit einbezogen.
- Verantwortlicher Umgang mit der Zeit: Die Helferbeziehung ist im Unterschied zur privaten Beziehung kein Selbstzweck, sie ist auf ein Ziel gerichtet und hat von daher auch einen Anfang und ein Ende.[20]
Eine ganzheitliche Sichtweise ist hilfreich im Umgang mit den Betroffenen, denn sie reduziert den Störungsaspekt zu einem Teilaspekt. Bei einer seelischen Erkrankung ist jeweils immer nur ein Teil der erkrankten Person tangiert, dies ermöglicht die Aktivierung von Ressourcen. Eine der wichtigsten Ressourcen ist die Möglichkeit, eigene Bewältigungs- und Entwicklungspotentiale zu entdecken und zu nutzen. Dabei kann die helfende Person unterstützen, wenn sie in der Lage ist, die Besonderheit als Ressource zu sehen. Wenn auch die anderen Eigenschaften wahrgenommen, berücksichtigt und genutzt werden, gelingt es besser, ein tragfähiges Hilfekonzept zu entwickeln.
Wichtig im Umgang mit Borderlinern sind weiterhin:
Genaue Absprachen und Vereinbarungen: Regeln vermitteln ein Gefühl der Verlässlichkeit und der Sicherheit. Borderline-Kranke neigen dazu, Regeln immer wieder in Frage zu stellen, weil sie es nicht aushalten können, eventuell in Widerspruch zu einer Regel zu geraten. Flexibilität ist eine der größten Herausforderungen für geistig behinderte Borderlinerinnen, denn Veränderungen machen ihnen Angst und stürzen sie in Krisen.
4.4.2. Sozialpädagogische Methoden und Interventionen
Grundlage allen Umganges sind professionelle Handlungsmuster, die unabhängig von Verhaltensauffälligkeiten zu einer professionellen Betreuung gehören:[21]
- Interessen, Bedürfnisse oder Wünsche aufgreifen und unterstützen
- Von den Stärken ausgehen
- Positive Signale, Spontanaktivitäten oder Initiativen erkennen, aufgreifen und unterstützen
- Situationen derart gestalten, dass ein gewünschtes Verhalten ohne korrigierende Einflussnahme möglich wird
- Überaltersgemäße und attraktive Angebote zu neuem Verhalten oder Probehandlungen anregen, motivieren und ermutigen
- Kooperieren, gemeinsam handeln
- Ausprobieren lassen
- Aufmerksam zuhören und aussprechen lassen
- Trösten
- Psychisch-physische Entspannung, Ruhe, Geduld, empathische Gelassenheit
- Nonverbale Signale positiv einsetzen
- Helfen, aber nur soviel wie nötig
- Zunächst vormachen, eventuell führen und dann alleine entscheiden oder handeln lassen
- Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl aufbauen und stärken
- Die Alltagsarbeit so gestalten, dass täglich genügend Angebote für eine sinnerfüllte Lebensgestaltung bestehen
- Genügend positive soziale Kontakte innerhalb und außerhalb der primären Lebenswelt anbieten und zulassen
- Eine offen-neutrale Grundhaltung einnehmen und Schuldzuschreibungen vermeiden
- Sozial wertvolle Aufgaben und Rollen nutzen und unterstützen
Sozialpädagogische Intervention sollte symptomorientiert sein, dabei handelt es sich um pädagogische Techniken, um Konfliktsituationen zu handhaben. Es geht hier nicht um „Tricks“, sondern um die kurzfristige Reaktion auf ein auffälliges Verhalten. Einige dieser symptomorientierten Interventionen sind:
Auffälliges Verhalten bewusst ignorieren:
Diese Intervention kann dort eingesetzt werden, wo keine Selbst und Fremdschädigung zu erwarten ist
Direkter Appell:
Die Wirkung dieser Handlung ist abhängig von der Person des Mitarbeiters, je nachdem, wie er respektiert wird. Allerdings führen zu viele Appelle zu einer einseitigen Kommunikation und zu einem unwirksamen, unbeteiligten Agieren.
Intervention durch Signale:
Manchmal genügt schon ein ernster Blick oder ein warnender Laut, um das auffällige Verhalten zu verhindern. Grundlegende Voraussetzung für das Gelingen dieser Intervention ist eine positive Beziehung.
Kontrolle durch unmittelbare Anwesenheit:
Bei Konflikten mit immer wiederkehrendem ähnlichem Muster hat es sich bewährt, sich rechtzeitig am Ort des Krisenherdes aufzuhalten, nicht als Bedrohung, sondern als Stütze.
Beruhigung durch körperlichen Kontakt:
Eine freundliche Berührung kann oft präventiv wirken und den betreffenden Menschen beruhigen. Voraussetzung auch hier: eine positive Beziehung.
Krise meistern durch Humor:
Manchmal können gespannte Situationen durch eine humorvolle Reaktion entschärft werden. Allerdings darf die humorvolle Geste nicht sarkastisch oder ironisch sein, sie muss echt sein, um zu wirken.
Einschränkung der räumlichen Bewegungsfreiheit und der Verfügbarkeit von Gegenständen:
Manchmal muss schnell entschieden und reagiert werden, wenn es um Gefahrensituationen geht. Dann werden gefährliche Gegenstände abgenommen und weggesperrt. Allerdings sollte diese Intervention für absolute Ausnahmesituationen vorbehalten bleiben, weil sie kontraproduktiv in Bezug auf Selbstbestimmung wirkt.
Körperliches Eingreifen und Festhalten:
Hierbei darf es sich nicht um aggressives Zupacken handeln. Das Festhalten dient der Selbstverteidigung oder der Verhinderung von Selbst- und Fremdgefährdung. Respekt und Wertschätzung des behinderten Menschen darf dabei nicht außer Acht gelassen werden.[22]
Für den festgehaltenen Menschen muss erkennbar sein, dass es sich hier um eine Momentaufnahme handelt, die die positive Beziehung nicht gefährdet.
Zu bedenken ist auch, dass diese Intervention nur geeignet ist, wenn die jeweilige Mitarbeiterin der Bewohnerin auch körperlich gewachsen ist. Kritisch wird es dann, wenn Bewohner mit gefährlichen Gegenständen auf Mitarbeiter losgehen. In unserer Gruppe rannte eine Bewohnerin mit Borderline-Störung mit einem großen Messer auf die Mitarbeiterin zu, die wie gelähmt war und zunächst überhaupt nicht reagieren konnte. Glücklicherweise drehte die Bewohnerin ab und lief in ihr Zimmer. Nun erforderte es allen Mut, ihr ins Zimmer zu folgen und die Herausgabe des Messers zu verlangen. In so einem Fall ist es erforderlich, sich vorher eine Kollegin zu Hilfe zu holen.
Zunächst aber sollte versucht werden, die Krise durch die Technik des Umlenkens zu entschärfen.
Umlenken:
Dem betreffenden Menschen werden Vorschläge zu alternativem Handeln oder zur Entspannung bzw. Aktivität oder körperlicher Bewegung gemacht, die ihn zum Aufgeben seiner momentanen Verhaltensweise motivieren sollen.
Ob diese Intervention Erfolg hat, hängt ab vom Grad des Erregungszustandes und von der Bereitschaft des Betreffenden, die Hilfe anzunehmen.
Situative Herausnahme:
Auch diese Maßnahme kann nur eine Notfallmaßnahme sein: Der Betreffende wird aus der Situation bzw. der Gruppe herausgenonmen. Dies hat sachlich zu geschehen, die Mitarbeiterin darf sich weder Feindseligkeit noch Gegenaggression, Wut oder Triumph erlauben, sonst wäre die Beziehung gefährdet und die Arbeit wesentlich erschwert.
Diese Intervention muss sehr sensibel gehandhabt und gut reflektiert werden, denn sie birgt einige Problematiken: So kann beispielsweise die Herausnahme als Belohnung erlebt werden, wenn die Situation den behinderten Menschen langweilte oder ihm unangenehm war. Dies würde auffälliges Verhalten verstärken. Ebenso muss bedacht werden, dass die Herausnahme eine Stigmatisierung bedeuten kann.
Leider ist es weit verbreitete Praxis, die Bewohnerzimmer als „Time-out-Räume“ zu missbrauchen. Dies bedeutet eine Geringschätzung der Privatsphäre und der Wohnkultur und ist eine Form der Freiheitsberaubung.
Daher dürfen Ausschlussmethoden nur für den äußersten Notfall gelten, sie tragen im Grunde nicht zur Lösung psychosozialer Probleme oder zur Verbesserung der Handlungsmöglichkeiten bei. Dies gilt im Übrigen auch für die anderen direktiven Methoden.
Symptomverschreibung:
Das bedeutet, bestimmte auffällige Verhaltensweisen ausdrücklich zu erlauben, um sie weniger wichtig zu machen, ihnen den Reiz zu nehmen und eventuell zum Verschwinden zu bringen. Dazu muss man den betreffenden Menschen allerdings sehr gut kennen und seine Reaktionen einschätzen können.
Wiedergutmachung:
Personen, die Schaden verursacht haben, werden dazu aufgefordert, den ursprünglichen Zustand so gut wie möglich wieder herzustellen: z.B. Scherben aufheben, Stühle wieder aufstellen etc. Auch die Entschuldigung bei angegriffenen oder geschädigten Personen gehört hier dazu.
Allerdings muss diese Technik unmittelbar der unerwünschten Aktion folgen, um wirksam zu sein. Wiederum ist hier der Mitarbeiter gefordert, keine Feindseligkeit oder Wut bei sich selber zuzulassen.
Grenzen setzen und Verbote aussprechen:
Dies ist wiederum eine Intervention für Notsituationen, um Selbst- und Fremdgefährdung zu vermeiden oder zu verringern. Verbote dürfen den Alltag nicht bestimmen. Oftmals lassen sich Grenzsetzungen und Verbote dadurch umgehen, dass mit dem Betroffenen Verträge abgesprochen werden, die Regelungen und Konsequenzen beinhalten.
Bestrafen:
Die klassische Bestrafung kommt als Interventionsmethode in der Arbeit mit Menschen nicht in Betracht, denn sie fördert lediglich Wut, Zorn und verstärkt Ohnmachtsgefühle und Hass.
Viel wirksamer, um unerwünschten Verhaltensweisen zu begegnen, sind logische negative Konsequenzen, die nichts mit der Person der Mitarbeiterin zu tun haben. Beispiel: Eine Person hält sich nicht an Regeln und zwingt dadurch beispielsweise die ganze Gruppe, bei der wöchentlichen Einkaufsfahrt zu warten. Eine logische Konsequenz wäre, tatsächlich zum festgesetzten Zeitpunkt ohne die betreffende Person loszufahren.
Dabei muss beachtet werden, dass so eine Konsequenz vorher angekündigt werden , bzw. wenn sie angekündigt ist auch durchgeführt werden muss.
Natürlich ist diese Intervention nur dann wirksam, wenn der betreffenden Person der Einkauf auch wichtig ist. Zudem sind sorgfältige Absprachen mit Kolleginnen erforderlich, um die Betreuung während der Abwesenheit der Gruppe zu gewährleisten.[23]
4.4.3. Umgang mit Krisen
Ein gutes Krisenmanagement ist bei geistig behinderten Borderlinern besonders wichtig. Es liegt in der Natur der Störung, dass Krisen sehr häufig auftreten. Krisen bei Borderline-Persönlichkeiten äußern sich oftmals in Toben, Schreien oder selbstverletzendem Verhalten. Häufig dauert es längere Zeit, bis die emotionale Erregung bewältigt ist.
Mit dem Begriff der Krise werden fast alle menschlichen Problemlagen bezeichnet, so bedarf es einer Differenzierung, was „Krise“ bei psychisch kranken geistig behinderten Personen bedeutet.
Wüllenweber erklärt die Herkunft des Wortes wie folgt:[24]
„Das griechische Verb ‚krinein’ bedeutet trennen, scheiden, entscheiden. Das abgeleitete Substantiv krisis bedeutet entsprechend Beurteilung, Entscheidung, Urteil, Scheidung (Bollnow, 1959, 27 f). In seiner lateinischen Verwendung bezieht sich ‚crisis’ verstärkt auf Krankheiten und wird mit zwei Bedeutungen assoziiert: Gefahr (Tod) und Chance (Leben, Heilung), was in der ursprünglichen medizinischen Verwendung als Wendepunkt oder Zuspitzung einer Entwicklung deutlich hervortritt. In der Medizin bezeichnete der Begriff ursprünglich den Wendepunkt bei einem Fieberanfall, der die Entscheidung zur Heilung anzeigte. Die Bivalenz des Krisenbegriffs zwischen Gefahr und Chance wird auch in anderen Sprachen deutlich. So steht im Chinesischen das erste der beiden Zeichen (wie) für Gefahr, hingegen bedeutet das zweite Zeichen (ji) Chance (Mennemann 2000; Aguilera 2000).“
Daher ist wichtig, dass das Arbeitsteam der Wohngruppe konkrete Absprachen hat, wie Krisen zu handhaben sind. Dazu kann beispielsweise die Vereinbarung gehören, selbstverletzendes Verhalten wenig zu beachten. Oftmals eine Gratwanderung, denn gegebenenfalls muss der Mitarbeiter die betroffene Person vor sich selber schützen. All dies erfordert eine sehr gute Zusammenarbeit im Team.
Gelassenheit im Umgang mit selbstzerstörerischem Verhalten ist deshalb geboten, weil diese Verhaltensweisen oftmals der Spannungsreduzierung dienen und daher möglicherweise in gewissem Maß zu tolerieren sind. Dies stellt hohe Anforderungen an ein Arbeitsteam.
Nach einer Eskalation:
Wenn ein Betreuter sich nach einer eskalierten Situation wieder beruhigt hat, sind alle Beteiligten erleichtert. Daher wird der „Nachsorge“ oft wenig Aufmerksamkeit geschenkt.
Dieter Irblich nennt dies „Nachsorge ist zugleich Vorsorge: „… Dabei geht es für den Betreffenden aber darum, seinen Platz in der Gemeinschaft wieder einzunehmen, eine gemeinsame Problemdefinition zu finden und zukunftsgerichtete Konsequenzen aus dem Vorfall abzuleiten. Der Nachsorge kommt daher eine wichtige präventive Funktion im Hinblick auf den weiteren Krisenverlauf zu. Ziel dieses Prozesses kann es natürlich nicht sein, dass der Betreute (gut gemeinte aber unrealistische) Versprechungen für die Zukunft abgibt, sondern dass ein Arbeitsbündnis mit ihm geschlossen werden kann, um weitere derartige Vorfälle nach Möglichkeit zu vermeiden.“[25]
Für die „Nachbearbeitung“ einer Eskalation können folgende Fragen hilfreich sein:
- Was kann oder soll der Betreute tun, nachdem die Aufregung abgeklungen ist?
- Wie und wann lässt sich der Vorfall klären, der zur Eskalation geführt hat?
- Auf welche Weise kann die Gruppe wieder zur Tagesordnung übergehen?
- Wie kann Schadensregulierung erfolgen?
- Wer muss informiert werden, und durch wen?
- Welche Konsequenzen ergeben sich aus der Eskalation?
- Was kann getan werden, um eine Wiederholung zu vermeiden?
- Was können betroffene Bewohnerinnen tun, um das Erlebnis zu verarbeiten?
Zunächst ist auf jeden Fall wichtig, die Beendigung des problematischen Verhaltens dem Betreffenden positiv rückzumelden, um damit ein Signal zu setzen, dass der Konflikt (vorerst) beendet ist und etwas Neues beginnen kann. Hier passiert es oft, dass Mitarbeiter ihrer eigenen Anspannung und Erleichterung noch in Anwesenheit der Betreffenden Luft machen, so dass beim Bewohner der Eindruck entsteht: „Die Erzieherin beginnt richtig zu schimpfen, wenn ich mich beruhigt habe“, was kontraproduktiv ist.
Oftmals haben sich Entschuldigungsrituale etabliert, die aber kritisch zu hinterfragen sind.
Zum einen bestehen sie oftmals aus leeren Worthülsen, die den Konflikt nicht lösen können.
Manchmal werden Entschuldigungen auch nicht angenommen, weil die Bereitschaft dazu nicht vorhanden ist, aus welchem Grund auch immer.
Das „Nachbesprechen“ des Konfliktes, wo immer möglich, ist eine gute Möglichkeit, der Betreffenden eigene und fremde Verhaltensanteile zu erklären. Die Wahrnehmung dieser ist oftmals stark verzerrt.
Geistig behinderte Menschen sollen im Rahmen ihrer Möglichkeiten lernen, für ihr Verhalten Verantwortung zu übernehmen. Dazu gehört auch, dass sie die Folgen von destruktivem Verhalten aufgezeigt bekommen und an Wiedergutmachung zumindest beteiligt sind.
Dies ist bei Borderline-Persönlichkeiten mitunter schwierig, da in ihrem Weltbild stets die anderen oder die Umstände schuld sind an Konflikten. Daher sind bei diesen Personen externe Therapieformen der dialektisch-behavioralen Therapie mit ihrem besonderen Augenmerk auf Eigen- und Fremdwahrnehmung hilfreich. Eine gute Zusammenarbeit und regelmäßiger Austausch erleichtert die Betreuung erheblich und nimmt Druck von allen Beteiligten in der Wohngruppe.
4.5. Anforderungen an die Mitarbeiterinnen einer Wohngruppe
4.5.1. Umgang mit Überforderung und Hilflosigkeit
Borderline-Persönlichkeiten gelten als „Teamspalter“, weil sie die Mitarbeiter eines Teams oftmals gegeneinander ausspielen bzw. den einen bei der anderen „anschwärzen“. Diese Persönlichkeiten sind in der Betreuung extrem anstrengend und fordern das Personal täglich und stündlich aufs Neue. Daher müssen Mitarbeiterinnen gut ausgebildet sein, um sich selber und ihre Arbeit gut reflektieren zu können und die nötige Distanz zu wahren. Hilfen und Begleitung dabei bieten die psychologischen Fachdienste und der Sozialdienst.
Die besondere Belastung durch die Betreuung von Menschen mit geistiger Behinderung und psychischer Erkrankung bedarf großer Aufmerksamkeit, denn sie ist kräftezehrend. Daher müssen Mitarbeiterinnen sich mit ihrem Arbeitsfeld gründlich auseinandersetzen. Die Polarität zwischen Engagement und Selbstschutz ist eine Gratwanderung, die in ihrer Ambivalenz durchaus mit der Gratwanderung der Borderlinerin korrespondiert.
4.5.2. Selbstreflexion, Reflexion im Team
Gute und intensive Reflexion ist unabdingbar. Dabei brauchen die Mitarbeiterinnen mitunter Unterstützung und Begleitung, beispielsweise durch Supervision. Leider ist hier oftmals kein Etat vorhanden, die Hilfe wird erst zur Verfügung gestellt, wenn sozusagen „das Kind schon in den Brunnen gefallen ist“. Wünschenswert wäre Begleitung als Prävention, zumal auch gerade im Erwachsenenwohnbereich viele Hilfskräfte mitarbeiten, die zwar oftmals sehr engagiert sind, aber nicht pädagogisch adäquat mit geistig Behinderten, deren psychischen Erkrankungen und den daraus resultierenden Eigenheiten umgehen können. Dadurch werden oftmals Prozesse, auch Heilungsprozesse, gestört.
4.5.3. Selbstsorge: Seelsorge auch für die eigene Seele
Der zeitgenössische Philosoph Wilhelm Schmid bringt in diesem Zusammenhang die Begriffe der „Selbstsorge“ und der „Selbstkultur“ ein. Die Sorge um sich selber beinhaltet Selbstkultur und gilt allen Aspekten des Selbst. Dabei schließt er körperliche, geistige und seelische Sorge für sich selber mit ein. Notwendig dazu ist Aufmerksamkeit, die Schmid als “eine der knappsten, mithin umstrittensten Ressourcen unter Menschen, so auch im Umgang des einzelnen Menschen mit sich selbst” sieht.[26]
Die meisten Mitarbeiter sorgen sich sehr um die zu betreuenden Menschen. Mit der Selbstsorge ist es etwas schwieriger. Viele Mitarbeiterinnen engagieren sich bis zur Erschöpfung und gestehen sich für sich selber gar keine Sorge zu.
In Bezug darauf sind die Fachdienste ebenfalls Ansprechpartner und beraten bei Bedarf Mitarbeiterinnen und Gruppenleitungen.
Zur Selbstsorge gehört auch, die nötige Distanz zum Geschehen in der Wohngruppe zu wahren. Oftmals sind die Übergänge von Privatleben zum Arbeitsleben in diesem Bereich sehr unscharf. Mitarbeiter verbringen sehr viel Zeit auf der Wohngruppe, auch nicht bezahlte Zeit, beispielsweise in den Nachtbereitschaften. Das führt dazu, dass Mitarbeiterinnen wesentlich mehr Zeit an ihrem Arbeitsplatz verbringen, um auf ihre Stunden zu kommen, als der „normal“ Werktätige, was der Überforderung und dem Ausbrennen Vorschub leistet. Hier stehen die Fachdienste beratend zur Seite, auch mit konkreten Vorschlägen.
Ein Beispiel dazu: man/frau stellt sich in einer Konfliktsituation vor, sie stehe sozusagen neben sich und der Konflikt mit der Bewohnerin spiele sich mit ihrem „Double“ ab, das nicht verletzt werden kann.
[...]
[1] (Theunissen, Georg: Pädagogik bei geistiger Behinderung und Verhaltensauffälligkeiten, 2005, S. 12)
[2] (Schanze, Christian: Psychiatrische Diagnostik und Therapie bei Menschen mit Intelligenzminderung, 2007, S. 15)
[3] (Schanze, Christian: Psychiatrische Diagnostik und Therapie bei Menschen mit Intelligenzminderung, 2007, S. 15)
[4] (Rahn, Ewald; Knuf, Andreas (2008): Borderline verstehen und bewältigen, S. 47 ff)
[5] (Rahn, Ewald: Umgang mit Borderline-Patienten, Bonn, 2007, S. 48)
[6] (Dilling, Mombour und Schmidt, 1994, S. 230f.)
[7] (vgl. Rahn, Ewald: Umgang mit Borderline-Patienten, Bonn, 2007, S. 17)
[8] (vgl. Schilling, Johannes: Anthropologie Menschenbilder in der Sozialen Arbeit, 2000, S. 111 ff)
[9] (vgl. Theunissen, Georg: Pädagogik bei geistiger Behinderung und Verhaltensauffälligkeiten, 2005, S. 106)
[10] (vgl. Theunissen, Georg: Pädagogik bei geistiger Behinderung und Verhaltensauffälligkeiten, 2005, S. 107)
[11] (vgl. Theunissen, Georg: Pädagogik bei geistiger Behinderung und Verhaltensauffälligkeiten, 2005, S. 96 ff)
[12] (Wansing, Gudrun: Teilhabe an der Gesellschaft, S. 78 ff)
[13] (vgl. Theunissen, Georg: Pädagogik bei geistiger Behinderung und Verhaltensauffälligkeiten, 2005, S. 110)
[14] (Thiersch, Hans: Lebensweltorientierte Soziale Arbeit, 2009, S. 5)
[15] (Habermas, Jürgen: Theorie des kommunikativen Handelns, 2009, Band 2, S. 192)
[16] (Thiersch, Hans, Lebensweltorientierte Soziale Arbeit, S. 101
[17] (http://www.awo-kiel.de/typo3/fileadmin/kundendaten/dokumente/normalisierungsprinzip.pdf 11.05.10, 21:30 Uhr)
[18] (http://www.awo-kiel.de/typo3/fileadmin/kundendaten/dokumente/normalisierungsprinzip.pdf 11.05.10, 21:30 Uhr
[19] (vgl. Theunissen, Georg: Pädagogik bei geistiger Behinderung und Verhaltensauffälligkeiten, 2005, S. 112 ff)
[20] (vgl. Rahn, Ewald: Umgang mit Borderline-Patienten, Bonn, 2007, S. 76 ff)
[21] (vgl. Theunissen, Georg: Pädagogik bei geistiger Behinderung und Verhaltensauffälligkeiten, 2005, S. 123 ff)
[22] (vgl. Theunissen, Georg: Pädagogik bei geistiger Behinderung und Verhaltensauffälligkeiten, 2005, S. 129 ff)
[23] (vgl. Theunissen, Georg: Pädagogik bei geistiger Behinderung und Verhaltensauffälligkeiten, 2005, S. 126 ff)
[24] (Wüllenweber, Theunissen: Hilfen für Menschen mit geistiger Behinderung, 2001, S. 12)
[25] (Irblich, Dieter: Menschen mit geistiger Behinderung, 2003, S. 581 ff)
[26] (Schmid, Wilhelm: Mit sich selbst befreundet sein, S 78.).
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Erstausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2010
- ISBN (Paperback)
- 9783955494124
- ISBN (PDF)
- 9783955499129
- Dateigröße
- 1.1 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Katholische Stiftungsfachhochschule München
- Erscheinungsdatum
- 2013 (Juli)
- Note
- 1,3
- Schlagworte
- Inklusion Wohngruppe Borderline Selbstsorge Seelsorge
- Produktsicherheit
- BACHELOR + MASTER Publishing