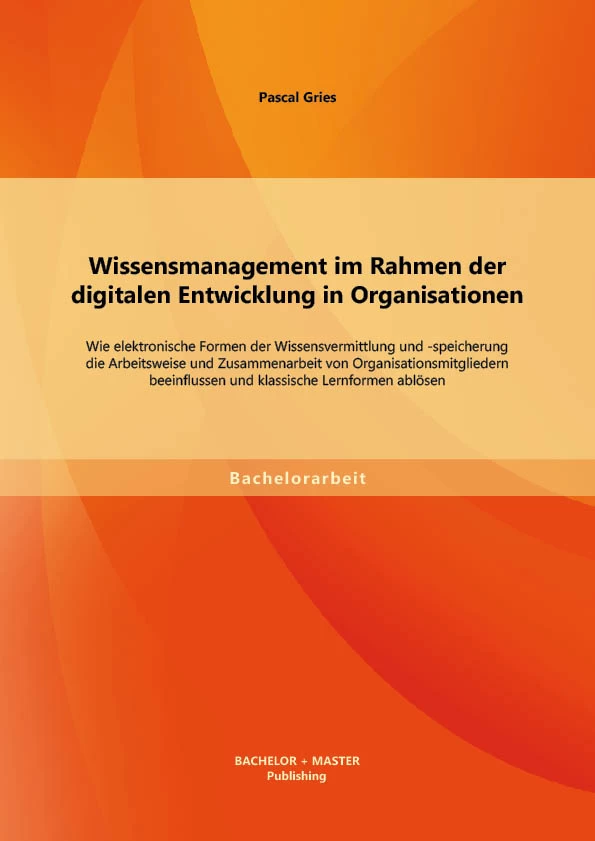Wissensmanagement im Rahmen der digitalen Entwicklung in Organisationen: Wie elektronische Formen der Wissensvermittlung und -speicherung die Arbeitsweise und Zusammenarbeit von Organisationsmitgliedern beeinflussen und klassische Lernformen ablösen
Zusammenfassung
Dies umfasst die Frage, wie implizites Wissen in die neue Enterprise 2.0 Organisation gespeist werden kann und informelles Lernen Bestandteil der Lernprozesse wird. Dabei spielt speziell der Einsatz elektronischer Systeme zur Wissensvermittlung und Social Media eine wichtige Rolle.
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
3.1.1 Austausch von explizitem und implizitem Wissen
Bei der Betrachtung des Wissens in Organisationed Träger aufzeigen. Die Verfügbarkn lassen sich Unterschiede in Bezug auf Verfügbarkeit uneit lässt sich differenzieren in implizites und explizites Wissen. Implizites, auch tacit knowledge bezeichnet, ist ein nicht in Worte zu fassendes, personen- und kontextgebundenes Wissen. Explizites hingegen ist wenig kontextgebunden, dokumentationsfähig, imitierbar, mobil und handelbar (vgl. Al-Laham, A., 2003, S.31f.). Um explizites Wissen sichtbar zu machen, also zu explizieren, kann es in Medien wie Texten, Bildern, Grafiken oder Präsentationen dargestellt werden und digital übertragen werden. Dieses Resultat des Explizierens wird Informationsobjekt genannt, also Ausschnitte von Wissen, welches an Dritte übertragen werden kann. Bei explizitem Wissen handelt es sich häufig um Know-What (vgl. Riempp, G., 2004, S.66; North, K., 2011,S.47; Geißler, H., 2002, S.67f.). Der Begriff des impliziten Wissens wurde von Polanyi (1962) geprägt, der erstmals erkannt hat, dass Menschen mehr wissen, als sie artikulieren, also explizieren können. Das vorhandene, unbewusste und nicht artikulierbare Wissen hat allerdings eine viel größere Bedeutung (vgl. Polanyi, M., 1962 zit. n. Riempp, G., 2004, S.61; Geißler, H., 2002, S.65ff.). North (2011) definiert es als: „Das persönliche Wissen eines Individuums“ (North, K., 2011, S.47). Beide Formen können als individuelles oder kollektives Wissen vorliegen. Das bedeutet, dass es entweder Einzelnen zugänglich und an sie gebunden ist (individuell) oder von mehreren geteilt wird und für diese verfügbar ist (kollektiv). Diese Form umfasst Wissensgemeinschaften, die im angloamerikanischen als Communities of Practice bezeichnet werden. Diese Gemeinschaft zeichnet sich durch ein äquivalentes Wissen aus und entsteht durch gleiches Interesse oder gleiche Aufgaben (vgl. Al-Laham, A., 2003, S.38ff.). Dabei können beide Formen anhand der Dimensionen explizit und implizit differenziert werden, was in Tab. 1 erläutert wird (vgl. Oberschulte, H., 1994, zit. N. Al-Laham, A., 2003, S.36). Eine dritte Form, das organisationale, beschreibt das von allen geteilte Wissen und wird in Kap. 3.2 näher erläutert.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tabelle 1: Explizit und implizit im Verhältnis individuell und kollektiv
Quelle: In Anlehnung an Lam, A. (2000), S.487-513
Im Laufe der Zeit zeigte sich die zunehmende Bedeutung von implizitem Wissen. Galt in den letzten 15 Jahren die Vorstellung, dass jegliches Wissen explizier- und dokumentierbar ist, so wird heute implizites für die organisationale Wissensbasis als unerlässlich gesehen und als Potential zur Generierung von Wettbewerbsvorteilen (vgl. Edvinsson, L., 1997 zit. n. Davenport, T.H., Prusak, L., 2000, S. 171 ; Nonaka, I., 1994 zit. n. Kugler, P.; Gibbert, M.; Völpel, S.276).
Das Zusammenspiel und der Übergang zwischen diesen Wissensarten, werden anhand des SEKI Modells von Nonaka (1994) in Abb.4 erläutert.
Das Modell, auch Wissensspirale genannt, sieht im Austausch von explizitem und implizitem Wissen die Voraussetzung für die Bildung von kollektivem und organisationalem Wissen. Hiernach ist implizites Wissen zwar explizierbar, kann allerdings nicht durch die einfache Übergabe von Informationsobjekten internalisiert werden (vgl. Nonaka, I., 1994a zit. n. Riempp, G.2004, S.62).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 4: SEKI Modell
Quelle: In Anlehnung an Nonaka, I.; Takeuchi, H. (1995), S.72
Die Übertragung von implizitem Wissen an Dritte in Form von individuellem Wissen oder kollektivem Wissen, beginnt mit dem Schritt der Sozialisation. Sie bezeichnet die non-verbale Übergabe von implizitem Wissen, hauptsächlich durch Beobachtung und Anwendung. Im nächsten Schritt, der Externalisierung, erfolgt eine teilweise Umwandlung in explizites Wissen, durch direkten Austausch und persönliche Kommunikation. Dabei wird durch Analogien, Metaphern und Modelle versucht das Erfahrungswissen zugänglich zu machen.
Die Stufe der Kombination bezeichnet die Verknüpfung von explizitem Wissen, welches hauptsächlich über Informationstechnologie übertragen wird und den impliziten Charakter von Wissen ausblendet. Text kann dabei nur schwer vernetzte Strukturen abbilden, auch Abbildungen reduzieren sich auf das Wesentliche. Die Abbildbarkeit ist somit nur eingeschränkt.
Die letzte Stufe Internalisierung, der Übergang von explizitem in implizites Wissen, erfolgt über die Anwendung und Erlernen von Handlungsroutinen (vgl. Nonaka, I., 1994a zit. N. Riempp, G., 2004, S.62; Riempp, G., 2004, S.66).
Zusammengefasst zeigen sich beim Wissen folgende Eigenschaften:
- Beinhaltet Theoriewissen und Regeln des praktischen Handelns/Verhaltens
- Umfasst personalisierte und nicht-personalisierte Bestandteile
- Liegt in individueller, kollektiver oder organisationaler Form vor
- Umfasst impliziten und expliziten Charakter
- Ergebnis von Lernprozessen (vgl. Al-Laham, A., 2003, S.43).
3.1.2 Entwicklung der Lerntheorien
Da Wissen das Ergebnis von Lernprozessen ist und dies die Basis für die Kompetenz zum Handeln, beschäftigt sich dieser Abschnitt nun mit der Basis von Lernprozessen: dem Lernen und den Theorien in die es gebettet ist.
Eine der ersten Lerntheorien war der behavioristische Ansatz. Dieser geht davon aus, dass auf einen äußeren Stimulus direkt die gewünschte Reaktion folgt, ohne Vorwissen und Motivation der Lernenden zu berücksichtigen (vgl. Bastiaens, T. et al., 2011, S.11; Schröder, 2002, S.31 ff.). Im Laufe der Zeit wurde erkannt, dass der Lernprozess sich nicht durch äußere Einflussfaktoren steuern lässt. Bevor es zu einer Reaktion kommen kann, muss erst das Verstehen, die Informationsverarbeitung einsetzen. Vor diesem Hintergrund entwickelte sich der kognitionspsychologische Ansatz. Dieser sieht im Verstehen eine bewusste Verarbeitung von Informationen und baut erkenntnisbezogene, kognitive Strukturen auf oder verändert sie (vgl. Baumgartner, P.; Payr, S., 1994 S.105; Tulodziecki,G., Herzig, B., Blömeke,S, 2004, S. 22). Vertreter dieser Theorie war Piaget der erkannte, dass Informationen nicht einfach als Wissen aufgenommen und angewendet werden können, sondern dieses anhand bestehender Eindrücke und Erfahrungen in mentalen Modelle konstruiert wird (vgl. Glasersfeld, E.v., 2002, o.S.). Die Konstruktion von Wissen bildet die nächste Stufe der Theorien, den Konstruktivismus. Dabei wird Wissen durch Lerner auf Basis der Wahrnehmung konstruiert und angepasst. Lernen bezeichnet hier den aktiven, selbstgesteuerten Prozess, der die Konstruktion von Wissen auf Basis von Vorwissen und Erfahrungen umfasst. Lernen wird lediglich ermöglicht und kann nicht von außen erzeugt werden. Ziel dieses Konzepts ist erstmals nicht die Wissensrepräsentation, sondern die Problemlösung (vgl. Foerster, H.v. et al., 2000, S.1, Tulodziecki,G., Herzig, B., Blömeke,S, 2004, S.26ff.). Die aktuelle Entwicklung legt den Schwerpunkt auf den Praxistransfer, bei dem Lerninhalte in praxisnahe Situationen eingebunden werden. Hier wird vom situierten Lernen, dem: „Lernen anhand authentischer Situationen“ (Bastiaens, T. et al., 2011, S.29) gesprochen. Wie im Konstruktivismus können Lernprozesse auch hier nicht von außen gesteuert, sondern nur ausgelöst werden. Dies erreicht situiertes Lernen durch das Schaffen einer authentischen Lernumgebung, mit Berücksichtigung kultureller und sozialer Bedingungen des Lerners. Der situative Ansatz sieht den Wissenserwerb, Wissen und seine Anwendung untrennbar verbunden (vgl. ebd. S.59f.). Für die betriebliche Weiterbildung bedeutet dies, dass Mitarbeiter an eigenen, praxisnahen Problemstellungen lernen müssen, in einem selbstorganisiert ablaufenden Aneignungsprozess in authentischen Lernsituationen und dabei Vorwissen, Motivation und Emotionen berücksichtigt werden (vgl. Reinmann-Rothmeier, G.; Mandl. H, 1997 zit. n. Schüßler, I.; Thurer, C.M., 2005, S.34f.).
3.1.3 Lernkultur des eigenverantwortlichen Lernens
Der Prozess des Lernens, sowie die Lerntheorien sind stets eingebunden in eine Lernkultur. „Lernkultur lässt sich (metaphorisch) als Lernlandschaft definieren […]. Lernlandschaften bestehen aus Lernumgebungen, Lernchancen und Lernbarrieren aus den Zugängen zu neuem Wissen […]. Aus Lerngewohnheiten und Lernritualen, aus der sozialen Anerkennung oder Missachtung des Lernens“ (Siebert, H., 1999, S.16). Dabei ist: „Die Lernkultur eines Unternehmens […] insbesondere in Zukunftsbranchen eine der entscheidenden Ressourcen für die strategische Unternehmensentwicklung und die internationale Wettbewerbsfähigkeit“ (Erpenbeck,J.; Sauer, J 2001 zit. n. Brödel u.a., S.49). Abb. 5 zeigt dich wichtigstem Wandlungsimpulse für die Prägung einer neuen Lernkultur. Der gesellschaftliche Wandel und eine erhöhte Informationsflut mit enormer Medienvielfalt, erfordern eine ständige Aktualisierung des Wissens, da neu erworbenes Wissen zu schnell überholt und stetig aktualisiert werden muss. Gewandelte Arbeitsbedingungen durch Flexibilisierung und Digitalisierung der Arbeitsprozesse, erfordern Selbstorganisation und Selbstverantwortung, sowie Schlüsselkompetenzen, die über fachliche hinausgehen. Der dritte Impuls ist der Wandel zur Wissensgesellschaft und der somit entstehenden Umgang mit der Unsicherheit, da starre Strukturen aufgelöst werden und Organisationsveränderungen in immer kürzeren Abständen aufkommen, in einem Umfeld zunehmender Komplexität. Damit geht die neue Lernkultur einher mit den Treibern der Wissensgesellschaft (vgl. Kade, S., 2009, S.199; Deller, J. 2008, S.166f.; Schüler, I.; Weiss, W., 2006, S.261).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 5: Wandlungsimpulse für Lernkulturen
Quelle: In Anlehnung an: Schüßler, I.; Thurer, C.M. (2005), S.34
Lebenslanges Lernen ist dabei zentrales Medium der Wissensgesellschaft, in Form einer ständigen Weiterbildung (vgl. Bellmann, L.; Leber, U., 2002, S.96). Um diese Lernform zu fördern, ist eine Lernkultur der Eigenverantwortlichkeit und Selbstlernkompetenz erforderlich (vgl. Deller, J., 2008., S.167; Stamov Roßnagel, S., 2008, S.19f.). Sie bildet das „[…] kognitive, kommunikative und sozialstrukturelle Ausführungsprogramm für alle mit Lernprozessen befasste Sozialität, in deren Zentrum ein selbstorganisiertes, reflexives Lernhandeln unter institutionellen und nichtinstitutionellen Bedingungen steht. Die neue Lernkultur ist ermöglichungsorientiert, selbstorganisationsfundiert und kompetenzzentriert“ (Erpenbeck, J.; Rosenstiel, L.v., 2003, S. XII). Sie verlangt:
- Selbstständiges Erkennen des Lernbedarfs und der Lerntechniken
- Selbstständige Planung der Ziele und Kontrolle der Erreichung
- Lernen muss mit anderen Aufgaben in Einklang gebracht werden, dabei steht das arbeitsbezogene Lernen im Vordergrund
- Ort, Zeit und Medien müssen geplant werden
- Ausreichend Spielraum für eigene Entscheidungen muss gegeben sein
- Motivation und Fähigkeit zum Selbstlernen muss gegeben sein (vgl. Reimann-Rothmeier, G; Mandl, H., 2001, S.199; Singh, M., 2005, S. 93-126; Deller, J., 2008., S.167; Stamov Roßnagel, S., 2008, S.19f.).
Im Arbeitsumfeld bedeutet dies, dass Lernen nicht mehr nur in formellen, institutionell initiierten Lehrveranstaltungen stattfindet, sondern jederzeit selbstständig und selbstgesteuert. Wissen wird ständig konstruiert und kann sowohl individuell, als auch organisational eingesetzt werden. Mitglieder der Generation Y haben das Prinzip des selbstständigen Lernens bereits verinnerlicht, was allerdings nicht auf alle Mitarbeiter zutrifft. Bei Älteren bedarf es Hilfestellungen, wie selbstreguliertes Lernen funktioniert. Die neue Lernkultur muss auf allen Ebenen der Organisation greifen und erfordert eine positive Einstellung zum Lernen und das auf individueller und kollektiver Basis, um erfolgreiches Lernen zu gewährleisten. Eine Gegenüberstellung der Änderungen der neuen gegenüber der bisherigen Lernkultur zeigt die Tab. 2 (vgl. Dubs, R., 2000, S.96 ff.; Reimann-Rothmeier, G; Mandl, H., 2001, S.211):
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tabelle 2: Entwicklung der Lernkultur
Quelle: In Anlehnung an Dehnbostel, P. (2001), zit. n. Brödel u.a. 2001, S.89
3.1.4 Entwicklung der Lernformen
In der betrieblichen Weiterbildung lässt sich Lernen grundsätzlich in das formelle und das informelle Lernen aufteilen. Die Begriffe lassen sich anhand verschiedener Kriterien unterscheiden, welche in Tab. 3 erläutert werden. Besondere Indikatoren sind die Unterscheidung der Selbststeuerung und der Bewusstheit des Lernprozesses (vgl. Rohs, M.;Dehnbostel, P., 2007, S.1).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tabelle 3: Formelles und informelles Lernen im Vergleich
Quelle: Rohs, M.; Dehnbostel, P. (2007), S.2
Formelles Lernen erfolgt in Form des expliziten Lernens, also bewusstem, gewollten Lernvorhaben, während informelles Lernen neben dem explizitem auch implizit, also beiläufig oder inzidentell, also zufällig erfolgen kann. Je informeller das Lernen ist, desto mehr wird implizit gelernt und je formeller es ist, desto expliziter wird gelernt (vgl. Meese, A., 2011, S.53; Straka, G., 2005, S.27-46). “[…] Informal Learning can be planned or intentional […] in self-directed learning or help […] from coaches or mentors” (Marsick, V. J., Watkins, K.E., 1990, S.7). Es beschreibt den Prozess der Aneignung, den ein Individuum mit oder ohne formelle Unterstützung selbstorganisiert einleitet (vgl. Meese, A., 2011, S.25).
Zunehmender Lernbedarf, komplexe Themen, sowie die Notwendigkeit des Erlangens von Handlungskompetenz, in der Lerner situationsangemessen und flexibel ihre Kenntnisse und Kompetenzen einsetzen (vgl. Reimann-Rothmeier, G; Mandl, H., 2001, S.198) führen dazu, dass der Einsatz von formellem Lernen und traditioneller Lernformen an Grenzen stößt. Selbstgesteuerte, informell geprägte Lern- und Arbeitsformen gelten als effizienter, als die Vermittlung von formellem Theoriewissen. Nur mit selbstorganisierten, informellen Lernformen, die in Arbeitsprozessen eingebunden sind, kann Wissen der Mitarbeiter mobilisiert und für die Organisation nutzbar gemacht werden. Dies führt zu besseren Lernleistungen, sowie zu einer dauerhafter Speicherung des Gelernten (vgl. Reinmann-Rothmeier, G.; Mand. H., 1993 zit. n. Kraft, S., 2000, S. 134f.; Krapp, A., 1993, S.201). Abb. 7 zeigt die Unterscheidung von Theorie- und Erfahrungswissen in Bezug auf die Lernformen.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 6: Formen des Lernens
Quelle: In Anlehnung an Dehnbostel, P. (2000), S.104
Mitarbeiterqualifizierung und betriebliche Innovationen werden hauptsächlich über diese Lernform getrieben (vgl. Dehnbostel,P.; Molzberger, G.; Overwien, B., 2003, S.177) , denn nur informelles Lernen kann das benötigte implizite Wissen vermitteln, klassische Lernformen vermögen dies nicht. Dies geschieht hauptsächlich während der Anwendung in Form von Erfahrung und Probieren, statt durch passives, formelles Lernen (vgl. Singh, M., 2005, S.114). „Informelles Lernen besteht folglich aus bewusst als Lernprozesse angestrebte Handlungen (Selbstorgansiertes Lernen) und solche wahrgenommenen Erfahrungen (Erfahrungslernen) sowie aus Lernprozessen, deren Verlauf und Ergebnis den Lernenden nicht bewusst sind (implizites Lernen)“ (Kirchhof,S.; Kreimeyer, J., 2003, S.53). Die Einbindung in einen Arbeitszusammenhang mit Kollegen ist dabei unabdingbare Voraussetzung (vgl. Dehnbostel,P.; Molzberger, G.; Overwien, B., 2003, S.176; Kreimeyer, J., 2004, S.48). Je besser das Netzwerk der Mitarbeiter, desto besser kann Lernen erfolgen. Cross (2010) sieht hier den wichtigsten Faktor des Lernens: „To learn is to optimze the quality of one´s networks“ (Cross, J., 2010, o.S.).
Formen des informellen Lernens können Gespräche mit Kollegen oder der Austausch mit Experten sein, wie in der Phase der Externalisierung des SEKI Modells beschrieben. In Bezug darauf, dass ein Großteil des Handlungswissens implizit ist und auf Erfahrungen basiert, kommt dem Erfahrungslernen die größte Bedeutung zu. Es bezeichnet eine Unterkategorie des informellen Lernens (vgl. Meese, A., 2011, S. 44). Informelles Lernen erfolgt meist über Erfahrungslernen, also die Reflexion über Erfahrungen, und macht 75% des Lernens aus (vgl. Dohmen, G., 1996, S.32; Dehnbostel, P., 2001a, S.187).
Der Trend zum informellen Lernen lässt sich aus betrieblicher und pädagogischer Sicht argumentieren. Aus betrieblicher Sicht sollen die Lernformen Kosten senken, um gestiegenen Bedarf zu decken und Effektivität und Flexibilität zu erhöhen. Aus pädagogischer Sicht können Handlungsspielräume und Eigenverantwortlichkeit gesteigert werden (vgl. Kraft, S., 2000, S.135).
3.1.5 Einfluss von Social Media auf die Entwicklung der Lernmethoden
Dieser Abschnitt beschreibt mögliche formelle und informelle Methoden der Wissensvermittlung in der betrieblichen Weiterbildung und den Einfluss, den Social Media darauf ausübt. Übergeordnet lassen sich Lernmethoden anhand von zwei Kategorien differenzieren: Präsenz (Klassenraum) und elektronisch (eLearning). Der Begriff eLearning bezeichnet dabei jegliches elektronisch gestützte Lernen. Dazu zählen technisch-pädagogische Programme, die mit Informationen und Interaktion durch Nutzung elektronischer Systeme Selbstlernprozesse unterstützen. Aber auch alle technischen Hilfsmittel in Verbindung mit Lernprozessen, sowie entsprechende Internet- und Webtechnologien mit Lernzwecken zählen dazu (vgl. Dichanz, H., 2004, S.14 f.).
Social Media beschreibt eine Vielzahl von internetbasierten Technologien, die zum Ziel haben, dass mehrere Nutzer über digitale Kanäle kommunizieren und sich austauschen, u.a. mit dem Ziel der Pflege von Beziehungen (vgl. Bingham, T.; Conner, M., 2010, S.6; Springer Gabler Verlag, 2013g).
Eine Integration in eLearning erhöht die Interaktivität und wird auch als Corporate eLearning 2.0 bezeichnet. Diese Variante liefert Werkzeuge, um das Prinzip einer lernenden Organisation zu unterstützen, indem Social Media elektronisches Lernen um die Möglichkeiten der Interaktion erweitert (vgl. Vaßen, M.; Perty, T., 2011, S.60ff.; Seufert, S., 2011, S.33).
Die Lernmethoden lassen sich anhand zweier Kriterien vergleichen: Anteil der Kontrolle, sowie Anteil des formellen, bzw. informellen Lernens und werden in Abb.7 dargestellt. Die Methoden mit dem größten formellen Anteil sind Klassenraumtrainings, sowie Web Based Trainings (WBT), also webbasierte Lernprogramme, eingebunden in ein Lern Management System. Ein LMS bezeichnet die Lernplattform, die zur Bereitstellung von Lerninhalten und Organisation von Lernvorgängen dient. Es regelt den Informationsfluss zwischen Anbieter und Lerner und übernimmt Verwaltungsaufgaben, wie z.B. das Reporting (vgl. wikipedia, 2013c, o.S.). Im weiteren Verlauf der Entwicklung kommt es zur Vermischung durch Blended Learning, also die Kombination von klassischen und digitalen Methoden, später auch formeller und informeller Methoden. Geprägt durch den Einfluss von Social Media etabliert sich der Begriff des Social Learning. Es bezeichnet das gemeinsame Lernen mit und von anderen unter Einbezug von Social Media (vgl. Binham, T.; Conner, M., 2010, S.6; Springer Gabler Verlag, 2013, o.S.), ähnlich wie das gemeinsame Lernen in Communities (Kap.4.2.2) als Lernmethoden, mit dem informellsten Anteil. Diese beiden Formen kombinieren formelle und informelle Methoden, durch praxisorientiertes Erfahrungswissen (vgl. Cross, J., 2010a zit. n. Jenewein, T., 2011, S.94).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 7: Lernmethoden in der Übersicht
Quelle: In Anlehnung an Cross, J. (2010a) zit. n. Jenewein, T. (2011), S.94.
Der Einfluss von Social Media hat seinen Ursprung im privaten Bereich, und erhält immer mehr Eintritt in die Organisationen, was unter Betrachtung der allgemeinen Entwicklung auch zwingend notwendig ist. Denn über 45 Mio. der deutschen Bürger sind mittlerweile online und 76 % davon in einem sozialen Netzwerk registriert, bei den 14-29 Jährigen sogar 96% (vgl. Jäger, W.; Petry, T., 2012, S.17.). Die Notwendigkeit zeigt sich auch bei Betrachtung der Generation Y, da diese mit Social Media aufgewachsen sind und diese Kultur des Wissensaustauschs fordert (vgl. Klotz, U., 2010, S.10). Die Hauptfunktionen von Social Media im Arbeitsleben sind Information finden, erstellen, bewerten, verändern und kommentieren. Des Weiteren zählt dazu das Identitätsmanagement für die Reputation, Selbstdarstellung und Wissensteilung.
Kern ist das Beziehungs-/Kontaktmanagement zur Vernetzung, Kontaktpflege und Zusammenarbeit. Letztere dient zum Teilen, Diskutieren, Bewerten, der Expertensuche und dem gemeinsamen Austausch (vgl. Richter, A.; Koch, M., 2008 zit. n. Koch, M; Richter, A., 2009, S.71 ; Grabmeier, S., 2012, S.64).
Zu der im weiteren Verlauf relevanten Social Media Software zählen:
- Blogs/Mikroblogs: Chronologische Eintragungen zu konkreten Themen im Intra- oder Internet, die kommentiert werden können. Bei Mikroblogs sind maximal 200 Zeichen möglich.
- Wikis: Wissensplattform, bestehend aus Seitensammlungen, die von Nutzern selbst gepflegt, korrigiert und weiterentwickelt.
- Soziale Netzwerke: Erstellung und Verknüpfung von Profilen in einer Webanwendung und Interaktion mit anderen, zur Beziehungspflege (vgl. Jäger, W.; Petry, T., 2012, S.18f.; Springer Gabler Verlag, 2013h; Springer Gabler Verlag, 2013e; Klebl, M., Ludwig, J., Petersheim, A., K., 2011, S.157).
Laut einer McKinsey (2008) Umfrage über deren Einsatz in Unternehmen zeigt sich, dass 47% Blogs, 42% soziale Netzwerke, 40% Wikis und 18% Mikroblogs einsetzen (vgl. McKinsey, 2009, S.4). Bei Betrachtung der Einsatzgebiete zeigen sich Schwerpunkte auf dem Managen von Wissen (83%), Förderung der Kollaboration (78%) und Verbesserung der Unternehmenskultur (74%). Für die Integration in formelle Trainings nutzen es 71% der Unternehmen (vgl. McKinsey 2008 zit. n. Ehms, K., 2010, S.140). Diese Schwerpunkte zeigen, dass Social Media sowohl im Bereich der formellen Weiterbildung, als auch für das WM eingesetzt wird. Somit bietet es die Möglichkeit der Verzahnung des formellen und informellen Lernens. Besonders soziale Netzwerke haben für das informelle Lernen Bedeutung und können Quellen des informellen Austauschs, wie den Kaffee-Klatsch unter Kollegen ablösen (vgl. Granovetter , M. , 1973 zit. n. Koch , M ; Richter , A. , 2009 , S.69f.).
Erfolgsfaktoren beim Einsatz von Social Media sind Einfachheit, intuitive Bedienung und niedrige Einstiegsbarrieren. Dabei sollten sie eigeninitiativ und selbstorganisiert eingesetzt werden (vgl. Back, A.; Heidecke, F., 2009, S.4). Die durch Social Media beeinflusste neue Form der Wissensvermittlung wird auch als Lernen 2.0 beschrieben. Klassische Ausbildung im Seminar wird durch Online-Interaktion erweitert, indem formelle Kurse um informelles Lernen erweitert werden mit Fokus auf der Wissensanwendung, statt dem Erwerb. Durch die eigenverantwortliche Steuerung der eigenen Lernprozesse, haben die Lerner Einfluss auf die Lerninhalte und Lernen bei Bedarf. Dadurch ersetzt Lernen on-the-job, also Weiterbildung durch Ausprobieren und Zusehen am Arbeitsplatz, zunehmend off-the-job Varianten. Tab. 4 erläutert, welche formellen und informellen Methoden in den beiden Formen zum Einsatz kommen (vgl. Stoller-Shai, D. 2011, S.111; Springer Gabler Verlag, 2013i, o.S.).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tabelle 4: On-the-job und off-the-job Maßnahmen
Quelle: In Anlehnung an Jenewein, T. (2011), S.102
Abschließend folgt in Abb.9 ein Blick auf den Einsatz der Methoden für die betriebliche Weiterbildung. Hier zeigt sich schon heute der vermischte Einsatz formeller und informeller Methoden. Darüber hinaus ist der Trend des Mobile Learning präsent, also die Unterstützung des Lernprozesses durch mobile Devices, wie Smartphones oder Tablets (vgl. Unesco, 2013, o.S.).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 8: Anwendung der Lernformen in der betrieblichen Weiterbildung
Quelle: MMB (2011), S.1
3.2 Lernende Organisation
Die bisher vorgestellten Formen des Lernens bezogen sich vornehmlich auf die Sicht des Lerners, also das individuelle und kollektive Lernen (Kap.3.1.1). Allerdings findet in Organisationen eine zunehmend wichtigere Lernform statt: organisationales Lernen. Der Aspekt des organisationalen Lernens ist dabei Leitbild der lernenden Organisation, wobei der Begriff mit dem des lernenden Unternehmen und organisationalen Lernen synonym verwendet wird. Diese Form des Lernens ist aufgrund der veränderten Rahmenbedingungen in der Wissensgesellschaft notwendig, da permanenter Innovations- und Anpassungsdruck nicht durch das herkömmliche Konzept der Ablauf- und Aufbauorganisation erfüllt werden kann (vgl. Dehnbostel, P. 2001, S.175). Seufert (2011) bezeichnet die lernende Organisation als „anpassungsfähige Organisation, die sich durch eine dynamische Unternehmenskultur auszeichnet, in der die Weiterentwicklung – das gemeinsame Lernen aller einen zentralen Wert darstellt“ (Seufert, S., 2011, S.31). Für die nachhaltige Wissensbasis der Organisation ist es erforderlich, Informationen zu Wissen und Kompetenz für das Handeln zu vernetzen, damit es in die Form des organisationalen Wissens, transferiert werden kann. Dies bezeichnet nicht nur die Summe aller Einzelwissen, da die Vernetzung von bestehendem Wissen Neues entstehen lässt. Es bildet die Basis für Innovationen und erst wenn der Transfer in organisationales Wissen erfolgt, kann von nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen gesprochen werden. Ansonsten besteht Gefahr, dass Experten abgeworben werden und ihr individuelles und implizites Wissen mitnehmen (vgl. Oberschulte, H., 1994, S.36; Herbst, D., 2000, S.10; Riempp, G., 2004, S.76; North, K., 2011, S.38; Barney, J., 1991 zit. n. Kugler, P.; Gibbert, M.; Völpel, S. , 2002, S. 276).
Aus Sicht der Organisationen müssen Mitarbeiter sich Inhalte nicht nur aneignen, sondern das Wissen kommunizieren und anderen zur Verfügung stellen. Dies versetzt eine lernende Organisation in die Lage, sich veränderten Umweltanforderungen durch Anpassungen im Inneren anzupassen (vgl. Schüßler, I.; Thurer, C.M., 2005, S.127f.). Elemente des organisationalen Lernens sind:
- Lernsubjekte: Individuum, Gruppe, Organisation
- Lernarten: Single Loop, Double Loop, Deutero Lernen
- Lernformen: Kognitives, verhaltensbezogenes Lernen
- Lernphasen: Identifikation, Entwicklung, Verteilung von Wissen, Integration, Nutzung (vgl. Pawlowsky, P.; Reinhardt, R., 2002, S.4f.)
Während die Lernsubjekte bereits im Kap. 3.1.1 erläutert wurden, sowie die Lernformen im Kap. 3.1.4, werden die Lernphasen gemeinsam mit den Phasen des WM in Kap. 3.3.3 erläutert. Die Lernarten folgen nun anhand der Erklärung von Argyris, C.; Schön D. A. (1978). Single Loop Learning bezeichnet das Anpassungslernen, also Lernen mit dem Ziel schnell auf Veränderungen zu reagieren. Dabei vollzieht es sich in einem festen Bezugsrahmen. Double Loop Learning bezeichnet Erschließungslernen. Lernen resultiert dabei aus Problemlösungsstrategien und vollzieht sich als Konfliktbewältigungsprozess. Im Gegensatz zum Single Loop Lernen, werden hier Rahmen und Grundwerte hinterfragt. Beim Deutero Lernen wird der Lernprozess selbst zum Gegenstand des Lernens, durch die Reflexion vergangener Single- oder Double Loop Lernprozesse (vgl. Argyris, C.; Schön, D.A., 1978 zit. n. Seufert, S., 2011, S.32). McAffee (2006) fasst die lernende Organisation, den Einfluss durch Social Media und digitale Transformation im Begriff Enterprise 2.0 zusammen, wie bereits in Kap.2.3.2 erläutert. Danach sind die veränderten Anforderungen nicht mehr durch traditionelle Arbeitsweisen und Methoden, wie E-Mail zu erfüllen (vgl. McAfee, A.P, 2006, S.21-28). Vielmehr versteht sich Social Media in Enterprise 2.0 Organisationen als zentraler Bestandteil zur Kommunikation und für das WM, um die kollektive Intelligenz der Organisation besser nutzen zu können (vgl. Ulbricht, C., 2010, S. 96).
Back und Heidecke (2004) formulieren: „Social-Software Anwendungen unterstützen als Teil eines soziotechnischen Systems menschliche Kommunikation, Interaktion und Zusammenarbeit. Dabei nutzen die Akteure die Potenziale und Beiträge eines Netzwerks von Teilnehmern“ (Back, A.; Heidecke, F., 2009 S.4). Innovationen funktionieren in Netzwerken besser, als in standardisierten Strukturen (vgl. Rump, J.; Schabel, F.; Grabmeier, S., 2011, S.22-39).
Erforderlich für eine Enterprise 2.0 Organisation ist der Aufbau einer Unternehmenskultur 2.0, in der alle Mitarbeiter die Möglichkeit haben Wissen zu teilen. Dafür muss der Tenor „Wissen ist Macht“ geändert werden in „Wissen ist zum Teilen da“ (vgl. Schreckenbach, F., 2012, S.134). Dies erfordert Vertrauen, statt Kontrolle. Dafür muss sich das Management mit Kontrollverlust abfinden und einen Rahmen schaffen, in dem Mitarbeiter sich selbst organisieren können (vgl. Jäger, W.; Petry, T., 2012, S.30f.). Die Unterschiede der klassischen Organisation zu Enterprise 2.0 werden in Tab. 5 erläutert.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tabelle 5: Gegenüberstellung Enterprise 1.0 – Enterprise 2.0
Quelle: Jäger, W.; Petry, T. (2012), S.30f.
Der Einsatz von Social Media Technologie soll zu einer Steigerung der Effektivität und Effizienz führen, indem damit auf implizites Wissen zugegriffen und vernetztes Arbeiten gefördert wird (vgl. Jäger, W.; Petry, T., 2012, S.23f.). Enterprise 2.0 schafft somit die Grundlage dafür, dass Wissen als vernetzter Prozess zu verstehen ist (vgl. Schreckenbach, F., 2012, S.134).
Dies zeigt sich auch bei den Gründen für die Einführung einer Enterprise 2.0 Organisation. Auf das Verfügbarmachen von implizitem Wissen fallen 51% und die Verbesserung der Wissensspeicherung 49%. Für 39% ist es die Erhöhung der Innovationsfähigkeit (vgl. Petry, T.; Schreckenbach, F., 2012, S.45). In der Praxis zeigen sich Erfolge durch die Einführung, insbesondere in Bezug auf die offene Kommunikation und den offenen Zugang zu Informationen. Die sechs größten Erfolgsfaktoren werden in der Abb.10 dargestellt.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 9: Erfolge durch die Einführung von Enterprise 2.0
Quelle: In Anlehnung an: Petry, T.; Schreckenbach, F. (2012), S.52
3.3 Wissensmanagement in lernenden Organisationen
Zentraler Bestandteil von Enterprise 2.0 ist der Umgang mit Wissen und Informationen. Um zum einen organisationales Lernen zu ermöglichen und zum anderen das individuelle Lernen der Mitarbeiter effizient zu gestalten, erscheint eine Verknüpfung der Elemente des WM und der betriebliche Weiterbildung erforderlich. Bisher verstehen sich beide als separate Institutionen in Organisationen. Vor diesem Hintergrund soll nun der Begriff des WM genauer betrachtet werden, um dessen Beitrag für das organisationale Lernen und die Basis für eine Verknüpfung mit der betrieblichen Weiterbildung aufzuzeigen.
Grundsätzlich stellt sich beim WM die Frage, ob Wissen überhaupt gemanagt werden kann. Plato zufolge gibt es zwar ein objektives Wissen in der Welt, das man erschließen kann (vgl. Jaspers, K., 1988, S.234). Allerdings sagt Drucker (1969): „You can´t manage knowledge, Knowledge is between two ears, and only between to ears“ (Drucker, P., 1969 zit. n. Hofmann, J., 2010, S.60). Dies zeigt die Herausforderungen an WM und dem Umgang mit explizitem und implizitem Wissen, da unterschiedliche Meinungen existieren.
Über die Notwendigkeit von WM ist man sich allerdings einig. In einer wissensorientierten Organisation muss das für die Erreichung der Ziele notwendige Wissen zur Verfügung stehen, genutzt, entwickelt und gespeichert werden und die systematische Nutzung in Organisationen gefördert werden (vgl. North, K., 2011, S.11; Heisig, P.,2002, S.254). Menschen, Organisation und Technik, bilden dabei die zentralen Bestandteile und müssen stets gleichermaßen betrachtet werden (vgl. Reinmann-Rothmeier, G., et al. 2001, S.18).
3.3.1 Aufgaben und Ziele des Wissensmanagements
Die übergeordneten Ziele von WM umfassen eine verbesserte Kommunikation, Transparenz von Wissen, schnellerer Zugriff, weniger Zeitaufwand bei der Suche sowie, einen verbesserten Wissensaustausch und die Vermeidung von Redundanzen. Dies erhöht die Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit, sowie die Produktivität, durch eine verbesserte Produkt- und Servicequalität, sowie verbesserter Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit (vgl. North, K., 2011, S.146; Herbst, 2000, S.188). Die Aufgaben von WM können grundsätzlich auf drei Ebenen betrachtet werden:
- Strategieorientiert: Kodifizierungs- oder Personalisierungsstrategie
- Prozessorientiert: Unterstützung Geschäftsprozesse oder WM selbst
- Systemorientiert: Informationssysteme zur Unterstützung der Strategie und Prozesse (vgl. Riempp, G., 2004, S.78).
Bei der Frage der Strategie existieren zwei Varianten: Die Kodifizierung oder Personalisierung. Bei der Kodifizierung liegt der Fokus darauf Wissen in Informationssysteme einzubinden. Dabei wird vornehmlich in die IT und elektronische Dokumentensysteme investiert und Mitarbeiter für das Ablegen von explizitem Wissen, dem Kodifizieren, belohnt. Bei der Personalisierungsstrategie liegt der Fokus weniger auf der IT, sondern auf der Bildung informeller Netzwerke, damit implizites Wissen ausgetauscht wird. Dabei wird nicht Kodifizierung, sondern der direkte Wissensaustausch der Mitarbeiter selbst belohnt. Bekannter Vertreter der Kodifizierungsstrategie ist Ernst & Young und für die Personalisierungsstrategie McKinsey & Company (vgl. Hansen, M. T.; Nohria, N.; Tierney, T., 1999, S. 2f.). Aus prozessorientierter Sicht hat WM die Aufgabe, Wissen zu lokalisieren, zu erfassen, es auszutauschen und zu verteilen, wobei dies sowohl aktuelles, als auch zukünftiges Wissen miteinschließt (vgl. Riempp, G., 2004, S.81). Aus systemorientierter Sicht dienen die Informationssysteme als Unterstützung, durch das Bereitstellen von Informationsobjekten für Geschäftsprozesse oder zum Auffinden von Experten. Je nach Strategie liegt ein unterschiedlicher Schwerpunkt vor (vgl. Riempp, G., 2004, S.84). Die Schlüsselbereiche für die Ausgestaltung von professionellem WM sind:
- Wissensinhalte: Ziele, Bedarf, Informationsquellen
- Prozesse: Vereinfachung und Standardisierung der Nutzung
- IT Systeme: Hardware, Datenbank, Sicherheit, Schnittstellen
- Organisation: Sponsor, /IT-Team , Kultur (vgl. Herbst, D., 2000, S.157).
3.3.2 Wissensträger in Organisationen
Zentrales Element des WM und Kriterium für die Strategie, sind die Wissensträger. Zu den Wissensträgern zählen „Objekte, Personen oder Systeme, die in der Lage sind Wissen zu speichern“ (Rehäuser, J.; Krcmar, H., 1996 zit. n. Al-Laham, A., 2003, S.31f.). Dies umfasst Dokumente und Datenbanken, Systeme, Menschen oder die Unternehmenskultur (vgl. Al-Laham, A., 2003, S.35). Kategorisch lassen sich die Wissensträger in materielle und personelle teilen (vgl. Riempp, G., 2004, S.62). Während personelle Wissensträger Experten zu bestimmten Themen beschreiben und sowohl in individueller, als auch kollektiver Form vorliegen, bezeichnen materielle (vgl. Al-Laham, A., 2003,S. 38ff.):
- Druckbasierte: Bücher, Zeitschriften, Notizen
- Audiovisuelle Träger: Tonbänder, Fotos, Videos
- Computerbasierte: CD, DVD, USB, Internet
- Produktbasierte: Fertigungsanlagen (vgl. Amelingmeiyer, J., 2000, S.57).
Im Rahmen der Kodifizierung, also der Dokumentation von Wissen in Form von Informationsobjekten in Medien, kann es als explizites Wissen vervielfältigt und an andere personelle Wissensträger übertragen werden. Allerdings können nach dem heutigen Verständnis nur Informationen, also Know-What in audiovisuellen Wissensträgern gespeichert werden, da sie nur in einem subjektivem und situativen Kontext zu Wissen werden können (vgl. Laham, A. , 2003, S.34f.; Trillitzsch, U.C.; Klostermeier, F., 2002, S. 229).
Die Identifikation von materiellen und personellen Wissensträgern ist elementare Voraussetzung für organisationale Lernprozesse. Aus der Informationsflut und existierenden Kompetenzen muss dabei relevantes Wissen identifiziert werden. Dabei kann weder der Wissenserwerb der personellen Wissensträger, noch die Bereitschaft Wissen zu teilen, von außen verordnet, sondern lediglich ermöglicht werden. Entscheidend für den Erfolg sind Vorwissen und Motivation der Lerner (vgl. Al-Laham, A., 2003, S.38ff.).
3.3.3 Wissensmanagement-Modelle in Organisationen
Es existieren verschiedene Modelle für den Einsatz von WM in Unternehmen. Die bekanntesten Varianten werden in diesem Kapitel erläutert:
1. Technokratisches Modell von Rehäuser J. ; Krcmar, H (1996)
2. Münchener Modell von Reimann-Rothemeier, G.; Mandl, H. (1999)
3. Integratives Modell von Reinhardt, R., Pawlowsky, P (1997)
Das technisch orientierte, technokratische Modell setzt den Fokus auf das Abbilden von explizitem Wissen in Datenbanken. Nach der Modellauffassung ist Wissen gleichzusetzen mit einer Information und somit ein speicherbares Produkt. Wissen ist stets Faktenwissen und weder personen- noch kontextgebunden (vgl. Siebert 1999, S.127). Es teilt sich auf in fünf Phasen:
- Managen der Wissens und Informationsquellen
- Management der Wissensträger und Informationsressourcen
- Management des Wissensangebots
- Management des Wissensbedarfs
- Management der Infrastruktur des Wissens und Informationsverarbeitung, sowie Kommunikation (vgl. North, K., 2011, S.191).
Das Münchener Modell umfasst eine pädagogisch-psychologische Sicht und sieht Lernen als Wettbewerbsfaktor. Dabei ist Wissen nicht wie im technokratischen WM nur ein speicherbares Objekt, sondern vornehmlich prozessorientiertes Wissen, wie Erfahrungswissen und unterscheidet folgende vier Phasen (vgl. North, K.2011, S.186; Reinmann- Rothmeier, G., 2001a, S.1ff.). Bestandteil des Modells sind Communities, die in Kap. 4.2.2 erläutert werden:
- Wissensrepräsentation: Identifikation und sichtbar machen von Wissen
- Wissenskommunikation: Austausch und Vermittlung von Wissen
- Wissensgenerierung: Wissen verarbeiten, so dass neues entsteht
- Wissensnutzung: Tatsächliche Umsetzung des Wissens (vgl. Winkler, K.; Mandl, H., 2002, S.142ff.; North, K., 2011, S.186).
Das Modell des integrativen WM bezieht verschiedene Ebenen mit ein, integriert es in ein Modell des organisationalen Lernens und sieht sich als Erweiterung dessen. Ziel ist es „individuelles und kollektives Wissen auf der Grundlage unterschiedlicher Lernformen, Lerntypen und Lernprozesse so einzusetzen, dass organisationales Lernen gefördert wird“ (Pawlowksy, P., 1994, zit. n. Scherm, E.; Pietsch, G., 2007, S.314). Damit entspricht das Modell dem der Wissensökologie, dass besagt, dass es entscheidend ist Rahmenbedingungen zu schaffen, in denen sich Wissen entwickeln kann, indem Mitarbeiter motiviert werden Wissen zu erwerben und zu nutzen. Im Vordergrund steht das Wissen als Prozess und die Eigenorganisation (vgl. North, K., 2011, S.182). Wie auch organisationales Lernen unterscheidet das integrative Modell die Lernsubjekte Individuum, Gruppe, Organisation und die Lernarten Single-, Double Loop und Deutero Lernen. Erweitert wird das Modell um Zielsetzung operativ oder strategisch, sowie die Lernebenen Wissen und Kultur. Die Wissensphasen des Modells bestehen aus vier Phasen:
- Identifikation und Generierung von
- Diffusion: Kommunikationskanäle, -formen, -barrieren.
- Integration oder Modifikation: Werden neue Wissenselemente ignoriert, integriert oder die Wissensbasis modifiziert, je nach Bewertung
- Anwendung: Auswirkung auf das Verhalten (vgl. North, K., 2011. S.188f.).
Da sich in der Entwicklung vom technokratischen zum integrativen Modell zwei gegensätzliche Modelle zeigen, folgt in Tab. 6 eine Gegenüberstellung.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tabelle 6: Gegenüberstellung: Technokratisches und integratives WM
Quelle: in Anlehnung an Severing, E. (2006), S.143
Im weiteren Verlauf der Arbeit steht der Ansatz des integrativen WM im Vordergrund, sowie dessen Sichtweise der Wissensökologie, da dieses neben den beschriebenen Modellen vornehmlich den organisationalen Ansatz fokussiert. Dabei betrachtet technokratisches WM weniger Lernprozesse, während integratives WM sich am ehesten dafür eignet, WM und betrieblichen Lernen miteinander zu verbinden (vgl. Severing, E., 2006, S. 153).
4. Wissensmanagement 2.0 und Personalentwicklung 2.0 in Enterprise 2.0
Die bisherigen Ausführungen haben aufgezeigt, dass die betriebliche Weiterbildung den Wissensbedarf mit formellen Maßnahmen allein nicht decken kann und eine Kombination mit einer neuen Form des WM und informellem Lernen notwendig ist. Verursacht ist dies durch die digitale Entwicklung, sowie die Wichtigkeit der lernenden Organisation und veränderter Lernprozesse der Mitarbeiter. Der folgende Abschnitt erläutert, wie sich WM und die Rolle der PE hierdurch verändert, wie konkrete kombinierte Maßnahmen aussehen, Auswirkungen auf Mitglieder und Organisation, sowie Herausforderungen und Erfolgsfaktoren bei der Einführung von WM 2.0.
4.1 Entwicklung von Wissensmanagement und Personalentwicklung
Es folgt eine Schilderung der Entwicklung des WM auf Basis der digitalen Entwicklung, zuerst im Rahmen des WM allgemein, anschließend in Bezug auf die Rolle der PE in der betrieblichen Weiterbildung.
4.1.1 Wandel des Wissensmanagements durch digitale Transformation
Verursacht durch die digitale Entwicklung in Enterprise 2.0 Organisationen wird Wissen als kontextspezifische, subjektive Erfahrung gesehen, welches sich nicht wie beim technokratischen WM einfach in Datenbanken abbilden lässt, sondern untrennbar mit den personellen Trägern verbunden ist (vgl. Schabel, F., 2013, S.38; Nonaka, I.,2007, S.162-171). Dies bestätigt auch eine Studie der Giga Information Group. Demnach liegt nur 20% des Wissens in kodifizierter Form vor. Davon 4% in strukturierter Form, wie in Kundenbindungs- oder Warenwirtschaftssystemen, 16% in Form von E-Mails, Word Dateien oder PowerPoint Präsentationen. 80% des Wissens hingegen ist personengebunden (vgl. Buhse, W., 2010, S.174f.).
Diese Betrachtungsweise bezeichnet den Unterschied bei der heutigen Form von WM. Es steht nicht mehr nur das Fakten- oder Theoriewissen im Vordergrund, sondern Erfahrungs- und Handlungswissen (vgl. Hofmann, J., 2010, S. 54). Diese geänderte Sichtweise erklärt das Scheitern des traditionellen technokratischen WM. Der Grund dafür ist, dass dieses Modell funktionierende Verfahren des persönlichen Wissensaustauschs durch neue Funktionen und Instrumente versucht hat abzulösen. Dadurch sollte nicht planbares und Kreatives kontrollierbar gemacht werden. Formalisierte Verfahren der Kanalisierung und des Zugriffs auf Wissen wurden den Mitarbeitern vorgestellt und die Nutzung durch Sanktionen durchgesetzt. Ziel war es Wissen aus den Köpfen der Mitarbeiter zu explizieren und in Datenbanken abzulegen. Dies führte dazu, dass Wissen durch Entpersonalisierung in totes Wissen verwandelt wurde (vgl. Severing, E., 2006, S. 140f.; Hofmann, J., 2010, S. 54; Schabel, F., 2013, S.38). Heute hingegen, geht es nicht mehr ausschließlich um die elektronische Abspeicherung von Wissen. Vielmehr sollen die Träger von Wissen stärker vernetzt und zum gegenseitigen Austausch animiert werden. Demnach kann nur durch Vernetzung auf Wissen zugegriffen werden (vgl. Hofmann, J., 2010, S. 54; Buhse, W., 2010, S.174f). WMS dürfen nicht mehr nur als Informationsmanagement (IM) Systeme gesehen werden, bei denen es um die Erfassung, Verwaltung und Suche von Informationen geht. Vielmehr ist es erforderlich, dass Informationen in einem praxisnahen Kontext umgesetzt und mit bestehenden Erfahrungen verknüpft werden. Relevantes, internes Expertenwissen muss identifiziert und somit organisationsweite Lernprozesse ermöglicht werden (vgl. Eppler, J.E., 2002, S.38).
In der Vergangenheit wurde WM oft mit IM gleichgesetzt. Tab. 7 zeigt die wichtigsten Unterschiede von Informations- und Wissensmanagement.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tabelle 7: Informations- vs. Wissensmanagement
Quelle: Sturz, W. (2011), S.2
Dies wird dadurch realisiert, dass anstatt Wissen in Dokumenten darzulegen, personelle Wissensträger über Blogs, Wikis oder soziale Netzwerke kommunizieren und sich vernetzen. Der eigentliche Wissensaustausch erfolgt also weniger über das reine Dokumentieren, sondern in direkter, problembezogener Kommunikation und Zusammenarbeit (vgl. Bartlett, C.A., 1996). Dies führt dazu, dass der Anteil freiwillig bereitgestellter Daten künftig einen höheren Anteil an den insgesamt verfügbaren Daten ausmachen wird (vgl. Otter, T.; Holincheckm J., 2008, zit. n. Trost, A., 2011, S.11).
Bei dieser Entwicklung wird auch von WM 2.0 gesprochen. Es hat großen Einfluss auf verschiedene Faktoren, wie Unternehmenskultur, Personalmanagement, Management, Prozessorganisation, und Wissenscontrolling. In der einer Unternehmenskultur des WM 2.0, auch als Unternehmenskultur 2.0 bezeichnet, ist es entscheidend, dass Maßnahmen ergriffen werden, die eine positive Einstellung zu Wissen entstehen lassen. In Bezug auf das Personalmanagement ist Motivation und Qualifizierung der Mitarbeiter Hauptaufgabe. Benötigtes Wissen muss durch gezielte Entwicklung zur Verfügung gestellt werden und das Management die Bedeutung des Wissens auf oberster Ebene vorleben und einen Verlust der Kontrolle der Kommunikationswege in Kauf zu nehmen. In Bezug auf die Organisation ermöglicht nur eine prozessorientierte Struktur einen möglichst schnittstellenarmen Wissensfluss. Wissenscontrolling definiert, ob Wissensziele richtig formuliert wurden und Maßnahmen erfolgreich durchgeführt wurden (vgl. Bodendorf, F., 2006, S.138-141).
[...]
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Erstausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2013
- ISBN (Paperback)
- 9783956841170
- ISBN (PDF)
- 9783956846175
- Dateigröße
- 1.1 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- FernUniversität Hagen
- Erscheinungsdatum
- 2015 (Februar)
- Note
- 2,1
- Schlagworte
- Wissensmanagement Personalentwicklung Informelles Lernen Social Media eLearning
- Produktsicherheit
- BACHELOR + MASTER Publishing