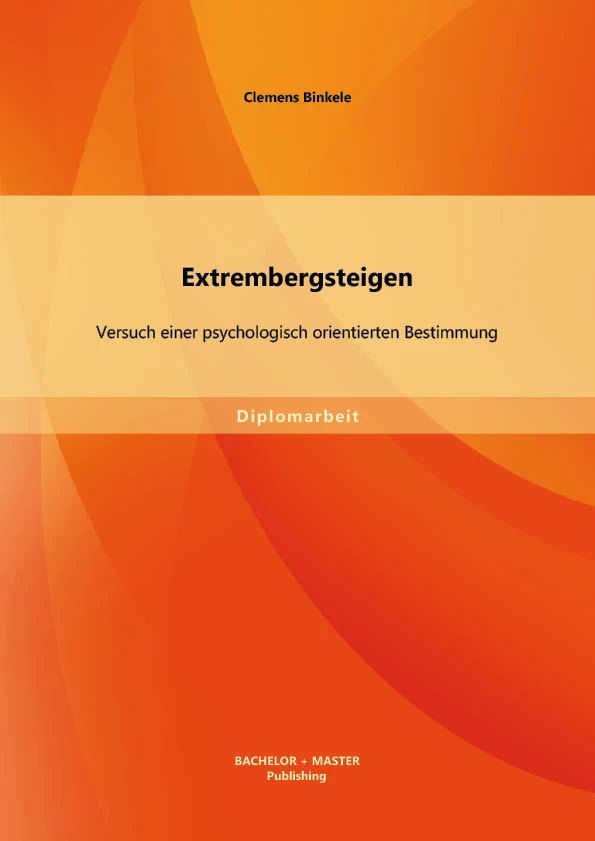Extrembergsteigen: Versuch einer psychologisch orientierten Bestimmung
Zusammenfassung
Ziel der Arbeit ist es, mögliche Gründe dafür zu finden, was Extrembergsteiger zu solch besonderen Höchstleistungen verbunden mit Lebensgefahr, Entbehrungen und Qual antreibt.
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
4 Grundmerkmale des Extrembergsteigens
Im vorletzten Kapitel wurde das Extrembergsteigen definiert. Anschließend wurden allgemeine und symbolische Aspekte von Bergen im Bereich der Mystik und der Geschichte veranschaulicht. In diesem Kapitel wird zuerst phänomenologisch vorgegangen und die äußere Struktur des Extrembergsteigens beschrieben. Im Verlauf dieses Hauptkapitels werden zunehmend innere Prozesse der Bergsteiger aufgezeigt und damit im Sinne einer psychologische Bestimmung das Bergsteigen analysiert.
4.1 Innere Herausforderung zum Kampf
4.1.1 Extreme physische und psychische Belastung bis an die Grenze
Äußerste körperliche und psychische Belastungen sind kennzeichnend für das Extrembergsteigen. Die Extrembergsteiger nehmen Leiden freiwillig auf sich und sehen darin scheinbar selbst eine besondere Leistung: „Ich weiß, dass ich mich sehr quälen kann, auch dann, wenn es gar nicht mehr geht“ (Reinhard, zitiert nach Aufmuth, 1988, S. 99). Extremtouren bringen tage- und wochenlange körperliche Qualen und eine äußerst hohe seelische Belastung mit sich. Grund für die enormen Belastung ist unter anderem, dass Extrembergsteiger sich in Höhen wagen, die für den menschlichen Körper eine beträchtliche Belastung darstellen. Besonders ausgeprägt ist diese beim Steigen in der „Todeszone“. Im Bergsteigen wird damit der Bereich über etwa 7000 Metern Höhe bezeichnet, in dem durch zu geringen Luftdruck keine dauerhaft ausreichende Sauerstoffversorgung über die Atmung mehr möglich ist (vgl. Berghold, 1997, S. 52). Edouart Wyss-Dunant, Expeditionsarzt der Schweizer Everest-Expedition 1952, definiert die „Todeszone“ sehr anschaulich. Daher möchte ich ihn hier wörtlich zitieren:
Erst bei 7000 Meter Höhe beginnen die ernstlichen Schäden, die ‚deterioration’, wie die Engländer es nennen. Die Halsschmerzen wandeln sich von einfachen Entzündungen zu schmerzhaften Geschwürbildungen. Frostschäden sind um so mehr zu fürchten, als der Organismus arm an Sauerstoff ist. Das Herz, das sich schwer anpaßt, trägt Dilatationen (Erweiterungen) davon. Die Schlaflosigkeit wird unüberwindlich; durch Mangel an lebenden Vitaminen läßt der Appetit nach. Schließlich lauert der Weiße Tod auf den, der zu lange oberhalb der ihm physiologisch gezogenen Höhengrenze zu bleiben versucht (Dunant, zitiert in Messner, 1978, S. 11).
Nach Aufmuth stellen diese extremen körperlichen und psychischen Belastungen, die in besonderem Maße in der Todeszone empfunden werden, ein „auffälliges Charakteristikum des Extrembergsteigens“ (Aufmuth, 1988, S. 99) dar. Die psychische Belastung tritt dabei vor allem in den Vordergrund, wenn der Extrembergsteiger in Todesnähe kommt. Physische und psychische Leiden können somit als Normalzustand von Extremalpinisten angesehen werden. Dabei ist darauf hinzuweisen, dass die hohe körperliche Belastung die seelische bedingt. Extrembergsteiger gehen dabei oft bis an die Grenzen der physischen Zerstörung (Aufmuth, 1988, S. 96-101). Dieses „Gehen bis an seine eigene Grenze“, in einigen Fällen auch das Überschreiten dieser Grenze, ist von den Extremalpinisten gewollt. Prädestinierter Ort für diese Grenzerfahrungen ist die oben beschriebene „Todeszone“, denn in diesem Bereich kommt es gewöhnlich zu einer Überlagerung von mehreren Faktoren: Todesgefahr durch Absturz, körperliche Ermüdung durch Schlafmangel, verbunden mit enormer Anstrengung, selten auch unter Sauerstoffmangel (Reinhold Messner und später auch andere Bergsteiger wagten sich in die Todeszone ohne zusätzlich Sauerstoff). Diese Faktoren können psychotische Erlebnisse im Bergsteiger hervorrufen. Beispielsweise sind Halluzinationen in der Todeszone nicht selten:
Da glaubte ich plötzlich, dicht vor mir ein Schneehuhn zu sehen. Ich halte. Es fliegt rasch über den Boden davon, kommt zurück, fliegt wieder in der selben Richtung davon und kommt wieder zurück [...] Ich schüttle mich. Welche Halluzination narrt mich? (Messner, 1978, S. 152).
Zudem kann es zu Halluzinationen von Begleitern kommen, die durchaus positiven Charakter haben aber auch zu Wahnvorstellungen, die sich negativ auf das Handeln auswirken können, wie folgendes Beispiel verdeutlichen soll:
Während er das weite Schneefeld der Mulde in nördlicher Richtung quert, löst sich ein Steigeisen vom Fuß – er müßte es lediglich neu befestigen –, aber er stolpert vor sich hin in der Vorstellung, zwischen Tabakplantagen zu wandern: Die Höhe hat seine Sinne völlig verwirrt (Messner, 1978, S. 168).
Darüber hinaus kommt es in derartigen Grenzsituationen häufig zu seelischen Erlebnissen die zur Spaltung des Seins führen[1].
4.1.2 Eroberungsdrang
Edward Whymper beschreibt in seinem Buch „Berg- und Gletscherfahrten in den Alpen“ aus dem Jahre 1872 die letzten Meter der Besteigung des Barres des Ecrins, indem er sie mit der Eroberung einer Festung vergleicht:
Als wir die Spitze des Passes erblickten, stürmten wir so leidenschaftlich vorwärts, als gelte es der Mauerbresche einer Festung, nahmen den Graben, hinten geschoben und vorn gezogen, im ersten Anlauf, eroberten den steilen Hang, der nun folgte, und standenum acht Uhr fünfzig Minuten in der kleinen Lücke, 11054 Fuß über dem Spiegel des Meeres. Die Bresche war erstürmt (Whymper, 1872, S. 8).
Diese Stimmung erinnert auch an Kriegsgeheul und Nationales. Tatsächlich war auch der Alpinismus (und auch der Deutsche Alpenverein) in den Nationalsozialismus involviert. „Das Bergsteigen wie den Krieger macht allein das innere Erlebnis des Kampfes aus“ (Amstädter, 1996, S. 445). Im Nationalsozialismus galt das Bergsteigen als etwas Soldatisches und Heldenhaftes. Außerdem war die Bestätigung der Männlichkeit am Berg zugleich eine hommage an die eigene Nation. Dass Extrembergsteigen für propagandistische Zwecke vereinnahmt wurde, verdeutlichen auch Bilder der deutschen Himalaja-Expedition von 1934. Zu sehen ist stets die Hakenkreuzfahne auf dem Gipfel (vgl. Peskoller, 2001, S. 172). Die Bergsteigerliteratur ist auch eine politische Literatur, die der eigenen Nation gewidmet zu sein scheint:
Letztlich will man immer wieder plausibel machen, dass gerade diese oder jene nationalen Eigenschaften genau die richtigen sind für die Erstbesteigung des betreffenden Achtausenders - mit der durchsichtigen Funktion nationalistischer Selbstbestätigung(Siegrist, 1996, S. 297).
Dieser Missbrauch des Extrembergsteigens im Nationalsozialismus verdeutlicht im Besonderen den Kampfescharakter des Extrembergsteigens:
Die Gefahr ist die Grenze zwischen Leben und Tod, ihre Überwindung ist die Tat, der Kampf. So stellt sich das Bergsteigen als eine Lebensform dar, deren Lebensform der Kampf ist (Siegrist, 1996, S. 297).
Es gibt jedoch auch Extrembergsteiger, die den Gedanken der „Eroberung“ der Berge entschlossen von sich weisen. Der bekannteste Extrembergsteiger, der das Eroberungsbergsteigen ablehnt, ist Reinhold Messner. Er sieht, das Bergsteigen vielmehr als Suche nach neuen Grenzwerten (vgl. Messner, 2006, S. 132).
4.1.3 Personifizierung des Bergs als Gegner
Besonders eindrucksvoll wird der Kampfescharakter des Extrembergsteigens auch in der Literatur von Lammer beschrieben: „In zähem Kampfe wanden wir uns vorsichtig die schaurig steilen Hänge hinunter“ (Lammer, 1999 [1887], S. 87). In einigen Aufsätzen von Eugen Lammer, beispielsweise in seiner Schrift „Unfall am Matterhorn“, beschreibt er die Steinschläge als Stimme des Berges: „[...] die warnenden Stimmen der Berge verstummten [...]“ (Lammer, 1999 [1887], S. 80) und einige Seiten später den Berg, als Gegner:
Du grausam herrliches Matterhorn, vom flüssigen Silber des Mondes bist du umronnen, [...] mir nur schattest du und raubst mir Weg und Schau ! Und doch, du grausamer Berg, unser Besieger, du Stiefmutter Natur, du harter Gott, ich liebe euch in all eurer gnadenlosen Schöne, in eurer graniten Gleichgültigkeit. [...] Wohl neige ich mich vor dem Richterspruche des Waltenden, der uns vom Matterhorn geschleudert, [...](Lammer, 1999 [ca. 1887], S. 87).
In diesen teilweise mythischen Beschreibungen wird der Berg zuerst durch die Stimmen, anschließend sowohl durch das Adjektiv „grausam“ als auch durch sein Handeln („geschleudert“) personifiziert. In diesen Bilder kann Lammers innere Gestimmtheit möglicherweise auch Erfahrungen mit früheren Bezugspersonen zum Ausdruck kommen. Man könnte den Berg hier als Projektionsfläche von Gefühlen, die aus früheren Erfahrungen herrühren, betrachten. Denn er sieht im Berg einen Gegner, vielleicht einen Rivalen, der in tiefenpsychologischer Betrachtung als Vaterfigur interpretiert werden kann. Darauf soll im Kapitel fünf „Bezug zur Lebensgeschichte der Extrembergsteiger“ näher eingegangen werden.
Andererseits sieht Lammer im Gegner „Berg“ einen Gott und stellt sich selbst auf dessen göttliche Ebene: „Ich, der Unzerstörbare, bin euresgleichen.“ (Lammer, 1999 [1887], S. 87). Er will sich diesem Gott nicht unterwerfen. Dies kann als Größenphantasie gedeutet werden[2]. Aufmuth konkretisiert diese Beschreibungen und vergleicht das Erzwingen des Berges mit dem „Kampf gegen einen hartnäckigen menschlichen Kontrahenten“ (Aufmuth, 1988, S. 25) und bleibt damit auf einer greifbareren Ebene. Ihm geht es dabei mehr um die im Menschen steckende Kampfeslust. Er bezeichnet den Berg als „passiven Gegner“, denn im Unterschied zu einem wahrhaften menschlichen Gegner könne er sich nicht wehren. So könne der Bergsteiger all seine Kraft an ihm auslassen, ohne ihn zu „verletzen“. Darin sieht Aufmuth auch einen signifikanten Unterschied zu anderen Sportarten. Der Berg könne nicht verletzt werden und ermögliche dem Bergsteiger damit das Ausleben all seiner Kräfte, was nicht einmal in kämpferischen Sportarten wie dem Boxen oder Ringen möglich sei. Im Gegensatz zu einem reglementierten Wettkampf gibt es für den Bergsteiger keine Regeln, die er einhalten muss (vgl. Aufmuth, 1988, S. 25).
Es scheint ein Kampf zu sein, der dem David gegen Goliath gleichkommt und auf den ersten Blick ein Ungleichverhältnis darstellt. Doch der Bergsteiger schafft es meist doch, mit allen Raffinessen den Berg zu besteigen und damit den Kampf zu gewinnen. Des Weiteren geht Aufmuth davon aus, dass das „körperliche Sich-Messen mit einem ebenbürtigen Gegenüber“ (Aufmuth, 1988, S. 25) ein Impuls ist, der im Menschen steckt. Er vergleicht die Eroberung der Berge mit der früheren Sagenwelt, in der die Helden unermüdlich von Kampf zu Kampf eilten, um nach immer gewaltigeren Gegnern Ausschau zu halten. Darüber hinaus stellt er das Schicksal der Extremen dem von Kriegerfiguren gleich, die rastlos von Kampf zu Kampf ziehen und lediglich darin Frieden und innere Erfüllung finden können. Er beschreibt den Kampf beim Extrembergsteigen als ein unmittelbares und elementares Kräftemessen, als ein „Feuerwerk der Sinne und der Körperkraft“ (Aufmuth, 1988, S. 26) und sieht darin einen fundamentalen Beweggrund der Bergsteiger in ihrem Tun. Wie im Boxkampf bleibe dabei die Frage nach Sieg oder Niederlage bis zum Ende, dem Erreichen des Tales, offen (vgl. Aufmuth, 1988, S. 25-27). Aufmuth sieht im Berg folglich einen Herausforderer, einen Widerstand, den es zu bezwingen und zu überwinden gilt. Dies zeigt sich auch in zahlreichen Beschreibungen von Extrembergsteigern. Beispielsweise im Bericht Whympers von der Besteigung des Matterhorns:
Das Matterhorn war ein hartnäckiger Feind, wehrte sich lange, teilte manchen schweren Schlag aus, und als es endlich mit einer Leichtigkeit, die niemand für möglich gehalten hatte, besiegt wurde, da nahm es als heimtückischer Gegner, der überwunden, aber nicht zermalmt ist eine fürchterliche Rache“. (Whymper, zitiert in Messner, 1976, S. 23)
Im Gegensatz zu den Beschreibungen Aufmuths betont Reinhold Messner, dass er diese kämpferischen Ambitionen nicht in sich trägt: „Ich bin nicht zum Mount Everest gefahren, um ihn zu bezwingen, sonst hätte ich ja von vornherein alle möglichen Techniken eingesetzt, um mir des Erfolges sicher zu sein“ (Messner, 1978, S. 14). Auf den aggressiven Charakter des Extrembergsteigens, der in diesem Kapitel durchaus zum Anklang kam, werde ich in Kapitel 4.5.3 „Autoaggression“ eingehen.
4.2 Spiel mit dem Leben
„Ich war entschlossen, das Höchste zu wagen, mein Leben wieder und wieder auf des Messers Scheide zu setzen“ (Lammer, 1999 [1887], S. 77). Dieses Zitat von Eugen Guido Lammer ist wohl kaum als Grundsatzeinstellungen der Extremen zu übernehmen. Dennoch spiegeln die Worte Lammers die Gefahren, das Todesrisiko, das Spiel mit dem Leben wider, das die Extremen in ihrem Tun eingehen und das in diesem Kapitel verdeutlicht werden soll. Gewiss kann eingeräumt werden, dass Lammer den Extremalpinismus des 19. Jahrhunderts verkörpert, in dem Ausrüstung und Sicherheitsaspekte nicht dem heutigen Standart entsprachen, doch dieses Kapitel wird anhand dramatischer Episoden der Extremen aufzeigen, dass das Extrembergsteigen auch heute noch ein Spiel um Leben und Tod darstellt. Um dem Leser nicht den Eindruck zu vermitteln, dass es sich hier um suizidale Auslebungen handelt, sei noch ein richtungsweisendes Zitat Messners angefügt.
Wenn Bergsteiger, wie es oft so schön heißt, ‚ihr Leben aufs Spiel setzten’, hat das nichts mit Selbstmord zu tun. Durch den ‚kalkulierten Wahnwitz’ ihrer Klettertouren wollen sie nicht zu Tode, sondern zum Leben, zu sich selbst kommen (Messner, 1978, S. 159).
4.2.1 Ausgeliefertsein an die Naturgewalten
„Der extreme Bergsteiger ist mit Haut und Haar in der Natur. Er berührt sie mit dem eigenen Körper“ (Peskoller, 1997, S. 214). In diesem Kapitel werden die Entfaltungsmöglichkeiten der Natur im Berg dargestellt. Im Speziellen soll die von der Natur ausgehende Gefahr, der das Individuum im Berg ausgesetzt ist, anhand Beschreibungen von Extrembergsteigern veranschaulicht werden. Der Extreme befindet sich nach Lammer vor allem dann in großer Gefahr, wenn er sich in einer exponierten Lage im Fels befindet. Das rührt daher, da an derartigen Kletterstellen nicht nur das Können des Extrembergsteigers, sondern auch die Beschaffenheit der Natur, des Felsen, über Leben oder Tod entscheidet. So Lammer:
Den Hochalpinisten umdräuen vielerlei Gefahren; aber nirgends schauen wir dem Tode so nah in seine Augenhöhlen als da, wo wir „exponiert“ (ausgesetzt) sind: Tausend Stellungen kann unser Körper einnehmen, doch nur eine einzige oder ganz wenige sind es, die in einer exponierten Lage nicht verderblich werden; und diese einzigen rettenden Haltungen muss unsere Erfahrung wissen und der widerstrebenden Natur (dem losen Gestein, dem tückenreichen Schnee oder Eis, dem plötzlichen Windprall usw.) jeweils die richtige anpassen oder aufzwingen (Lammer,1999 [1887], S. 115).
Er beschreibt in seinen Aufsätzen die Kräfte der Natur, denen der Extreme ausgesetzt ist, sehr eindrücklich:
Die lange Sonnenbestrahlung hatte Hänge ausgeapert, die seit Jahrzehnten durch des Wassertropfens bohrende und sprengende Kraft vom Berge losgewittert, aber bisher stets vom Firn oder Eis gefesselt waren. Nunmehr wurden sie mit einem Male frei: Riesige Trümmer, ganze Felsbänke hatten wir [...] in Pausen von zehn und fünf Minuten herunterkrachen sehen (Lammer, 1999 [1887], S. 79/80).
Darüber hinaus veranschaulicht Lammert die für den Extremen davon ausgehenden Gefahren.
„Da löste endlich die heiße Südwestsonne alle Bande der Hölle, klirrend zerbrachen die eisigen Fesseln; und nun begann ein Toben, wie es markerschüttender nicht auszudenken. Schwarze Klumpen, groß wie Eisenbahnwagen, rissen sich irgendwo hoch droben los, polterten, sprangen in Hundertmetersätzen, flogen auf Vorsprünge, zerbasten in Scherben, die nun in unberechenbarem Streukegel durch die Lüfte sausten [...] Immer spähte der eine von uns nach oben, indes der andere kletterte, und beim Warnschrei preßten wir unsere bebenden Leiber hart an den Fels, aber dessen Schutz war fraglich an diesen Platten“ (Lammer, 1999 [ca. 1887], S. 82/83).
Diese beiden Auszüge aus Lammers Aufsatz „Keine Reue – Matterhorn“ verdeutlichen wie schnell Extrembergsteiger durch Wetterumschwünge in Todesgefahr gelangen können. Es ist zudem vor allem die Vielzahl der Beschreibungen in der Bergliteratur, die die Gewalt und Unberechenbarkeit der Natur verdeutlichen (Lammer, 1999 [1887], S. 115). Auch Messner berichtet von dem Ausgeliefertsein gegenüber der Natur:
Erst jetzt erkannten wir die tödliche Gefahr. Ursache des Donnerschlags war ein Felssturz. Wir rissen die Köpfe hoch und sahen über uns, auf einer Front von 20-30 Metern, nur Steine, große und kleine, einige waren mindestens ein Kubikmeter groß, die genau auf uns zukamen (Messner, 1978, S. 146).
Andere Naturgewalten, die den Bergsteiger in Todesgefahr versetzen können, sind Schneelawinen, das schützende Zelt abreißende Orkanböen, sich auftuende Gletscherspalten etc. (vgl. Aufmuth, 1988, S. 208). So beschreibt auch Lionel Terray das Ausmaß der Gefahr durch die Natur sehr eindringlich:
Wenn ich während meiner ganzen Laufbahn auch nur einen einzigen Sturz getan habe, bei dem ich dem Tode nahe war, so bin ich wenigstens neun Mal durch Bergrutsch, Steinschlag oder Eisbrocken fast umgekommen. Neben Schneelawinen und Wächtenbrüchen sind das die großen Gefahren des Alpinismus im Hochgebirge (Terray, 1966, S. 52).
4.2.2 Umgang mit der Todesgefahr
Im vorigen Kapitel wurde bereits das erhebliche Risiko beim Extrembergsteigen, das von der unberechenbaren Natur ausgeht, aufgezeigt. In diesem Kapitel soll nun explizit auf das Risiko beim Extrembergsteigen eingegangen werden. Der Umgang der Extremen mit der Todesgefahr soll dabei beispielhaft durch die Darstellung verschiedener Sichtweisen von Extremen auf die erhebliche Gefahr aufgezeigt werden. In einem ersten Schritt werden Risikotechniken nach Messner und seine Forderungen aufgezeigt, wie mit dem Risiko im Extremalpinismus umgegangen werden soll und in einem weiteren Schritt Lammers Einstellung in Bezug auf die Gefahr im Extrembergsteigen dargelegt.
4.2.2.1 Risikotechnik: Hochtechnologisierung versus Enttechnologisierung
„Wer sich als Bergsteiger überschätzt, lebt nicht lange“ (Messner, 1978, S. 55). Dieses Zitat, bringt nicht nur die Gefahr, der man beim Extrembergsteigen begegnet auf den Punkt, sondern weist auch zugleich auf ein wesentlich Voraussetzung für erfolgreiches Bergsteigen hin: die richtige Selbsteinsschätzung. Messner sieht im Extrembergsteigen die Kunst, den Gefahren mit Geschick auszuweichen. Man müsse „größtmöglichen Schwierigkeiten mit größtmöglicher Vorsicht“ (Messner, 1978, S. 55) begegnen. Dieses Zitat könnte den Eindruck erwecken, dass Messner jegliches Risiko ausschließt und dass Extrembergsteigen, wenn man nur vorsichtig genug vorgeht, kein Risiko in sich trägt. Ein Restrisiko bleibt jedoch immer. Festzuhalten sind nach Messner zwei Dinge, um das Risiko einzugrenzen: das Können richtig einzuschätzen und ein vorsichtiges Vorgehen, das in Anbetracht der waghalsigen Unternehmungen der Extremen dem Leser beinahe ironisch erscheint. Demnach müsse die Vorstellung eines Bergsteigers von sich selbst mit seinem Selbst übereinstimmen. Sobald sich der Bergsteiger jedoch überschätzt, steige das Risiko eines Unglücks enorm (vgl. Messner, 1978, S. 55).
Messner betont, dass das Risiko kritisch analysiert werden müsse, denn nur so bliebe man wachsam für Gefahren. Er fordert Wachsein, Vorbereitung, Training, Selbstbeherrschung und Einschränkung. Darüber hinaus verwendet er den Begriff der Risikotechniken. Dies sind Techniken des Grenzgangs, die darauf abzielen mit Ungewissheiten und Gefährdungen umzugehen beziehungsweise sie zu bewältigen. Dabei sollen schicksalhafte Bedrohungen zu einem berechenbaren und verantwortbaren Wagnis gemacht werden, so dass eine Rückkehr aus dem Gang in die Ungewissheit möglicht wird (vgl. Caysa, 2002, S. 55-58).
Im Laufe der letzten Jahrzehnte stieg die Tendenz, die Gefährdungen im Extrembergsteigen immer mehr durch eine zunehmende Hochtechnologisierung zu bewältigen. Die Risikotechnik wurde folglich zur Risikotechnologie. Nach Messner wird jedoch der Extremalpinismus durch die Hochtechnologisierung zu versichert und damit entzaubert. Durch diese „Versicherung“ käme es zu einer Auslöschung des Risikos im Extrembergsteigen und damit auch zu einer Auslöschung des „nahezu Unmöglichen“, das für ihn gerade das Extrembergsteigen auszeichnet: Nahezu Unmögliches möglich zu machen. Messner sieht für sich den Reiz, von der Hochtechnologisierung durch Enttechnologisierung Abstand zu nehmen. Darunter versteht er beispielsweise den Verzicht auf Bohrhaken und zusätzlichen Sauerstoff. Nach Messner soll man nicht, wie es der Trend vorgibt, der Direttissima (kürzeste Strecke zum Gipfel) folgen, sondern die Route suchen, die auch ohne Bohrhaken zu machen ist. Messner verachtet die Hochtechnologisierung, mit deren Hilfe die Kletterer ihre Route dem Berg aufzwingen wollen: „Der Mut wird in Form von Haken im Rucksack mitgetragen oder Seillänge für Seillänge aufgezogen“ (Messner, 2002, S. 73) und kritisiert: „Man nagelt viel zu viel und klettert viel zu wenig“ (Messner, 2002, S. 73). Es solle nicht die moderne Technik sein, die über Gelingen oder Misslingen entscheidet, sondern die Fähigkeiten und Anstrengungen des Individuums selbst. In der Gegenüberstellung von Ent- und Hochtechnologisierung könne folglich ein Kontrast zwischen einer extremen Natürlichkeit einerseits und einer extremen Künstlichkeit andererseits gesehen werden, wobei sich Messner diese Beschränkungen auflegt, „um das Verhältnis Mensch-Berg nicht in ein zu arges Missverhältnis zu bringen“ (Messner, 1991, S. 78). Er fordert die Rückkehr zu Techniken des Einfachen und des Nicht-Hochtechnologischen verbunden mit Höchstleistungen im selbsttechnischen Bereich. Messner möchte damit zum Ausdruck bringen, dass sich der Extreme mehr auf sein inneres Selbst und sein Dasein besinnen soll, als auf das Erreichen des Gipfels mit allen nur denkbaren Mitteln im Sinne eines Eroberungssports. Zudem fordert er eine Reflexion über sein Tun und über die angewande Risikotechnik als Selbsttechnik. Das heißt, in der Gefährdung muss stets eine Reflexion über die Gefahr stattfinden, deren „selbstkontrollierte Mäßigung“ den Extrembergsteiger zur Rettung führt. Nach Messner erlaubt dieser reflexive Gebrauch von Risikotechniken eine Verringerung der Technologisierung im Extrembergsteigen. Der Extreme müsse jedoch bereit sein zum Verzicht, denn ohne Verzicht wird für ihn das Risiko zur Todesfalle. Messner geht es folglich darum, dass Risiko einzugrenzen, aber nicht durch die Verwendung von Technologie völlig auszulöschen. Denn Hochtechnologisierung lösche nicht nur das Risiko aus, sondern entzaubere auch das Abenteuerliche des Extrembergsteigens (vgl. Messner, 1991, S. 60-78).
Dieser geforderte Verzicht verdeutlicht, dass die Grenzgänge bei Einhaltung der Risikotechniken Messners kein Spiel ohne Grenzen, sondern eines mit Grenzen darstellen. Caysa erläutert, dass Messner nicht mit dem allerletzten Augenblick, sondern mit dem vorletzten gespielt, um die Lebensgefahr zu minimieren. In diesem Sinne bezeichnet er Messners Risikotechnologien als Überlebenstechnologien, durch deren Gebrauch versucht wird, das mögliche Ende bewusst zu machen und dadurch dem Tod zu entkommen (vgl. Caysa, 2002, S. 58).
Es ist anzumerken, dass Messner mit seinem eigenen technischen Vermögen nicht automatisch die Lebensgefahr bei seinen Unternehmungen verringert, denn durch den immer größer werdenden Anspruch an sich selbst nimmt er auch immer gefahrvollere Herausforderungen an. An dieser Stelle möchte ich nochmals hervorheben, dass die dargestellten Risikotechniken das Risiko einschränken können, sie aber nur in geringem Maße die Gefahren, die von der Natur ausgehen und die im vorigen Kapitel aufgezeigt wurden, minimieren können.
4.2.2.2 Todesgefahr: Leiden und Masochismus
Lammer sieht in der Gefahr ein Hauptmotiv des Extrembergsteigens:
Hinter jeder Felskante, in jeder Eisschlucht möge die Todesgefahr sprungbereit lauern [...] wir wollen mit gespannten Sinnen sie erspähen und höchstgespannten Geistes mit höchstgespannten Gliedern sie bekämpfen (Lammer, 1999 [1929], S. 151).
Anhand dieses Zitats wird deutlich, dass sich Lammer geradezu nach der Gefahr sehnt und sie bewusst aufsucht. Dies weist auf masochistische[3] Persönlichkeitsanteile hin. Er könnte damit auch sagen wollen, dass das Präsentsein der Todesgefahr eine Voraussetzung für das Extrembergsteigen ist.
Aus seinen weiteren Schriften geht hervor, dass er es auch als enorm wichtig ansieht, sich der Gefahr ständig bewusst zu sein. Der Bergsteiger müsse sich jederzeit fragen, was geschehen kann und dies völlig klar vor Augen sehen, um so auf die Gefahr vorbereitet zu sein. Wer dies nicht tut, sich folglich blind in eine gefährliche Situation begibt, dem zollt er lediglich Geringschätzung. Wie heute Messner sprach auch er sich gegen die Verwendung zu vieler Sicherungen durch Anbringung von Bohrhaken im Fels aus, doch unterscheiden sich die Begründungen Lammers von Messners. Lammer bezeichnet die Gefahr als etwas Edles und Adeliges. Sich an den schwierigsten Stellen zu sicheren, stellt für ihn eine seelische Scheinleistung, eine Täuschung dar. Er sieht in der Suche nach der Gefahr ein Hauptmotiv im Bergsteigen und den Grund, von der mechanischen Sicherheit des Tales zu fliehen. Bergsteiger, die diese „mathematische und mechanische ‚Sicherheit’“ (Lammer, 1999 [1929], S. 157) hinauf in die Berge tragen, verachtet er und bezeichnet ihr Verhalten als beschämend. Denn der wahre Grund des Bergsteigens ist, so Lammer, das Verlassen auf sich selbst. Er beschreibt das Bergsteigen metaphorisch zum Beispiel als „ritterlichen Kampf mit dem Drachen“ (Lammer, 1999 [1929], S. 157).
Lammers Haltung erinnert sehr an die Verherrlichung des Heldenhaften, wie in den Heldensagen und wie es im frühen 20. Jahrhundert wieder auflebte[4]. Die Gefahr durch Kunsttritte und Drahtseile zu verringern, sieht er ebenfalls als einen Betrug nicht nur gegenüber dem Berg an, sondern auch gegenüber sich selbst; denn damit gehe ebenfalls eine Verringerung der Freude einher (vgl. Lammer, 1999 [1929], S. 150-157). Die Ablehnung von zu viel Sicherheit bei Messner und Lammer könnte auf masochistische Persönlichkeitsanteile dieser Extrembergsteiger hinweisen. Darüber hinaus kann in den Äußerungen von Lammer Freuds Todestriebsthese bestätigt werden. Darunter wird nach Freud, ein dem Lebenstrieb, dem Eros, entgegen gesetzter Trieb, auch Destruktionstrieb genannt, verstanden. Wenn er auf das Subjekt gerichtet ist, wirkt er autoaggressiv (vgl. Freud, 1959, S. 11).
Lammer und Messner sprechen sich gegen die Verwendung zu vieler Hilfsmittel aus. Ihre Ansichten unterscheiden sich jedoch in der Hinsicht, dass Lammer nicht nur der Kampf mit der Gefahr reizte, „sondern die Gefahr selbst“ (Messner, 1978, S. 54). Messner hingegen betont in seinen Schriften, sich nicht dem „Walten des Zufalls“ (Messner, 1978, S. 54) zu stellen. Vor allem widerstrebt Messner die Forderung Lammers, die Todesgefahr herauszufordern. Er sieht das Risiko als Mittel zum Zweck, um „den Reiz einer ekstatischen Existenz zurückzugewinnen“ (Messner, 1978, S. 54), misst ihr aber keine so große Rolle bei wie Lammer. Es scheint Messner hier weniger um das eigene Heldenhafte zu gehen wie Lammer, sondern um das Erleben einer Veränderung im Bewußtsein. Gemeinsam ist dabei, dass beide ihren Körper bis zur Höchstgrenze der Belastbarkeit einsetzen, um ihr Gefühl für sich Selbst anzuheben, das heißt, einen großen narzisstischen Gewinn zu bekommen[5].
Caysa erläutert, dass die Angst, die in der Gefahr entsteht, als Mittel gebraucht wird, um die enormen Schmerzen zu ertragen. Nur durch die Bewältigung des Risikos sei es möglich, das Leiden und den Verlust der körperlichen Kräfte auszuhalten. Damit gehe ein Erlebnis der gedanklichen und körperlichen Ohnmacht einher, die überwunden wird und Allmachtsphantasien zur Folge habe. Durch die Bewältigung und das Aushalten der Schmerzen in der Todesgefahr entstehe ein enormes Lustgefühl. Dadurch dass das Leiden als solches gar nicht mehr wahrgenommen wird, kommt es zu einem „Fasziniertsein vom Leiden“ (Casya, 2002, S. 45), das zu einer Sucht führen kann. Caysa beschreibt dies als einen positiv wahrgenommen Psycho-, beziehungsweise Physisthriller, wobei sich schmerzliche Askese in ein ekstatisches Erleben verwandelt (vgl. Caysa, 2002, S. 45-46).
Nach Caysa wird also Gefahr bis zur Todesgefahr gebraucht, um Lustgefühle zu erleben. Er spricht vom Fasziniertsein vom Leiden, das Suchtcharakter bekommt. Folglich zeigen sich im Extrembergsteigen masochistische Verhaltensweisen, also Handlungen, die durch selbst herbeigeführtes Leiden gekennzeichnet sind. Sicherlich kann man durch Frustrationserlebnisse Glücksgefühle um so nachhaltiger erleben, doch im Extrembergsteigen geht es offensichtlich um mehr: Der Bergsteiger lechzt hier geradezu nach der Gefahr, ja sogar der Todesgefahr; er braucht sie. Caysa schildert zudem, dass intensive Ohnmachtsgefühle erlebt werden und durch ihr Überwinden Allmachtsphantasien entstehen. Er spricht hier ein narzisstisches Erleben an, auf das ich später eingehen werde.
4.2.2.3 Bagatellisierung der Todesgefahr
Eine andere Handhabung des Risikos ist in den Äußerungen Terrays zu finden. Sie verdeutlichen zum einen das große Risiko, das das Extrembergsteigen in sich trägt, zum andern jedoch auch mit welcher Verständlichkeit Terray die Todesgefahr auf sich nimmt:
Ich habe Hunderte schwierige Unternehmungen in all den speziellen Spielarten des Alpinismus durchgeführt, und dennoch bin ich nicht öfter als etwas zwanzigmal dem Tode wirklich nahe gewesen (Terray, 1975, S. 50).
Für den Bergsteiger Terray scheinen zwanzig Berührungen mit dem Tod keine große Zahl zu sein. Er räumt ein, dass das Extrembergsteigen eine Todesgefahr mit sich bringt, stellt diese Gefahr jedoch als normal dar und betont, dass er in Relation zu seinen vielen Besteigungen eigentlich noch viel öfter in Todesnähe hätte kommen müssen (vgl. Terray, 1975, S. 50). Auf ähnlich unbedeutende Weise spricht er über seine Stürze im Fels: „Nur einer dieser ‚Flüge’ hätte mir beinahe das Leben gekostet“ (Terray, 1966, S. 51). Terray bagatellisiert hier das tödliches Risiko und sieht es als etwas Normales an, das eben Teil des Extrembergsteigens ist:
Sich Gefahren auszusetzen, ist nicht der Zweck des Spiels, doch gehören sie nun einmal dazu. [...] Man hat durchaus die Möglichkeit zwanzig oder dreißig Jahre hindurch ‚großen Alpinismus’ intensiv zu betreiben und schließlich an Altersschwäche zu sterben; dabei ist es am schwierigsten, die ersten vier bis fünf Jahre heil zu überstehen (Terray, 1966, S. 54).
Terray bagatellisiert in seinen Beschreibungen zum einen die erhöhte Wahrscheinlichkeit des Unfalltods beim Bergsteigen, zum anderen konkrete lebensgefährliche Situationen; so beispielsweise den Beginn eines Steinschlags am Col du Diable des Mont Blancs, womit Terray auch seine Begleiter, seinen Freund Pierre Brun, seinen Vetter und den Pariser Bergsteiger Roger Endewell, in Gefahr brachte:
Bald kamen einige vereinzelte Steine das breite Couloir in graziösen Sprüngen herab. [...] außerdem nimmt ein menschlicher Körper auf einem an die 200 Meter breiten Hang nur wenig Platz ein. Es musste also mit dem Teufel zugehen, sollte eines dieser verfluchten Geschosse treffen (Terray, 1966, S. 53).
Allein die Wortwahl Lammers zum Beispiel „graziöse Sprünge“ zeigt wie er die Gewalten des Berges nicht nur verharmlos, sondern auch mit einem zarten, grazilen Wesen vergleicht.
Im sich anschließende Kapitel wird ausgehend von der ständigen Gefahr des in die Tiefe Stürzens die Besonderheit der kognitiven Abläufe im freien Fall veranschaulicht.
4.2.3 Der freie Fall als Grenzerlebnis
„Der Bergsteiger, der mit seiner ganzen Person beim Klettern und Eisgehen dem Berg verhaftet ist, kennt die Gefahr und muss mit dem Unfall rechnen“ (Messner, 1978, S. 114). Besonders im Abstieg kommt es durch die extreme Erschöpfung häufig zu Unfällen.
Nach halbstündigem Gipfelaufenthalt beginnt der abenteuerliche Abstieg, bei dem es infolge der Dunkelheit und der furchtbaren Erschöpfung zu bösen Zwischenfällen kommt: Schneebrett, Sturz des einen, der den anderen mitreißt, Verlust eines Pickels, Überschreitung eines großen Schrundes mit fünfzehn Meter tiefem Fall (Messner, 1978, S. 169).
Dieses Kapitel wird verdeutlichen, dass vor allem der freie Fall ein positives Erleben hervorrufen kann. Anhand von Empfindungen, die „Überlebende“ derartiger Unglückfälle berichteten, wird das Gefühl im freien Fall geschildert. Dabei werden die Empfindungen im freien Fall vor eintretender Bewusstlosigkeit mit den Empfindungen im freien Fall vor dem Tod gleichgesetzt (vgl. Heim, zitiert in Messner, 1978, S. 37). In den folgenden beiden Abschnitten werden Gefühle beim Fallen aus der Sicht von Eugen Guido Lammer und Klaus Mohrmann beschrieben.
Lammer schildert das Moment des Fallens als ein positives Erlebnis. „Ich habe den Sturz mit klaren Sinnen getan und kann euch künden, Freude“ (Lammer, 1999 [1887], S. 84). Lammer geht soweit, dass er das Todeserlebnis durch einen Sturz in alpinem Gelände als etwas Schönes darstellt. Dabei trat bei ihm die Todesangst lediglich im Moment auf, in dem man sich noch zu retten versuchte. Sobald er jedoch jegliche Rettungsgriffe umsonst getan hatte, kam ein Gefühl der Ergebung über ihn. Ähnlich wie Messner sein Dasein in der Todesnähe mit einem „hinter dem eigenen Körper herschweben“ vergleicht, beschreibt Lammer sein Empfinden beim Fallen: „[...] mein Ich schwebte über dem ganzen Geschehen als ruhevoller, neugieriger Zuschauer wie im Zirkus“ (Lammer, 1999 [1887], S. 84). Es scheint ein Zustand unglaublicher Gelassenheit und Souveränität einzutreten, den Lammer als Nirwana bezeichnet. Lammer berichtet ebenfalls wie Heim, von einer ein wenig später eintretenden Erinnerungen an die eigene Kindheit, Heimat und Mutter: „In zahlreichen Fällen folgt ein plötzlicher Rückblick in die ganz eigene Vergangenheit“ (Heim, zitiert in Messner, 1978, S. 39). Ähnliche Erinnerungen sind in zahlreichen Beschreibungen von Todesstürzen zu finden. Lionel Terray beschreibt seine Erlebnisse im „Todessturz“ folgendermaßen:
Als ich den Boden in schwindelerregender Schnelligkeit auf mich zukommen sah, glaubte ich, beide Seile wären gerissen, und ich würde gleich am Fuß einer Klippe zerschmettern. In Bruchteilen von Sekunden dachte ich an meine Mutter, an meine Frau und an tausend andere Dinge (Terray, 1966, S. 51).
Darüber hinaus betont Heim die verschobene Wahrnehmung der Zeit, die dem Stürzenden wie eine Ewigkeit erscheint. Ebenso wirke alles harmonisch und in Ruhe: „Ohne Schrei, ohne Aufregung, ohne Trauer, ganz erlöst von der Kette des Ichs!“ (Heim, zitiert in Lammer, 1999 [1887], S. 85). Hingegen wandle sich dieser „seelische“ Zustand im Moment des Liegenbleibens, dem des Erwachens. Es sei kein Dank und keine Freude die einen erfüllt, sondern nur noch Sorge (vgl. Lammer, 1999 [1887], S. 84-88).
Klaus Mohrmann unterscheidet Anfang der dreißiger Jahre des 20. Jahrhunderts hingegen zwischen einzelnen Phasen, in denen sich der Fallende befindet. Er teilt das Fallen im Fels, im Gegensatz zu Lammer, in vier Phasen einzelner Teilerlebnissen ein: den „Beginn des Absturzes – das Versagen der Gegenwehr – der Aufschlag mit der meist darauf folgenden Bewußtlosigkeit – das Erwachen“ (Mohrmann, zitiert in Messner, 1978, S. 82). Zudem unterscheidet er zwei Situationen: Solche bei denen der Sturzbeginn einen Schreck auslöst, und solche, bei denen der Bergsteiger sich nicht erschreckt. Dies sei wiederum davon abhängig, ob der Sturz in leichtem Fels oder an einer schwierigen Kletterstelle erfolgt, genauer, ob der Bergsteiger die Situation vollkommen beherrscht oder nicht. Denn in schwierigem Gelände ist der Bergsteiger eher auf einen Sturz eingestellt, das heißt, die Unfallbereitschaft ist größer und er erschrickt weniger als in leichtem Gelände, in dem er nicht mit einem Sturz rechnet. Bei sehr großem Schreckanlass fährt der Mensch wie gelähmt zusammen und beginnt mit der Gedankenproduktion erst bei Erkenntnis der Todesgefahr. Dann folgt der Versuch die Situation noch zu beeinflussen, beispielsweise beim Rutschen über Eisplatten den Pickel ins Eis zu schlagen, um Halt zu finden. Dabei ist der Körper in höchster Funktionsbereitschaft, und im Unbewussten werden die „auf die Seele einstürmenden Eindrücke zurückgehalten [...], damit kein Schock das zweckmäßige Handeln unmöglich macht“ (Mohrmann zitiert in Messner, 1978, S. 86). Erst im Moment der totalen Hilflosigkeit tritt die Todeserkenntnis einhergehend mit einem Glücksgefühl ein: „Nun erkannte ich auch die Aussichtslosigkeit jeder Rettung, und in diesem Moment kam ein Gefühl der Erlösung über mich“ (Mohrmann zit. nach Messner S. 79). Dieses auftretende Glücksgefühl, so Mohrmann, ist verbunden mit einer Ichaufgabe, die sich in einer absoluten Entspannung ausdrückt. Es kommt zur Ausschaltung des Willenslebens, des logischen und kritischen Denkens und der Fallende tritt in einen Traumzustand. Erst jetzt kommt es zu der so oft beschriebenen Lösung des Ichs vom Körper, was als Depersonalisierung[6] verstanden werden kann:
„Aber nicht ich war es, der das sah, fühlte und erlebte, sondern ein zweites Ich außer mir, das jetzt dem dahinrasenden Körper von höherer Warte aus zuschaute“ (Mohrmann, zitiert nach Messner S. 79).
Ich hatte keine Furcht, vielmehr erlebte ich den Sturz mehr als Zuschauer denn als Beteiligter (Terray, 1966, S. 51).
Im Verlauf dieser Ichverdopplung beziehungsweise Ichspaltung löst sich das seelische Ich vom körperlichen Ich[7]. Das Körpergefühl erlischt fast gänzlich und man hat das Gefühl, außerhalb des Körpers zu stehen. Oft erkennt der Verunglückte erst nach dem Sturz, soweit er nicht bewusstlos wird, die Gefahr, in der er schwebte, erlebt sie nach und wird so von Schrecken und Grauen befallen (vgl. Messner S. 78-91).
[...]
[1] Auf derartige Depersonalisierungserlebnisse werde ich im Speziellen sowohl in Kapitel 4.2.3 „Der freie Fall als Grenzerlebnis“ und Kapitel 4.3.1.2 „Verlassenheitsgefühle“ als auch in Kapitel 4.4 „Existentielle Grunderfahrung“ eingehen.
[2] Auf Größenphantasien von Extrembergsteigern werde ich in 4.5.2 „Narzisstische und ödipale Merkmale“ vertieft eingehen.
[3] „Im weiteren Sinne bezeichnet man heute alle selbstschädigenden Einstellungen und Verhaltensweisen als masochistisch, d.h. Verhalten und Haltungen, die durch bewußt oder unbewußt von den Betroffenen selbst herbeigeführtes Leiden gekennzeichnet sind“ (Wöller zit. in Ermann, 2004, S. 184).
[4] Zur Verherrlichung des Heldenhaften vgl. auch Kap. 4.1.2 „Eroberungsdrang“.
[5] Auf den narzisstische Gewinn beim Extrembergsteigen werde ich vertieft in Kap. 5.2 "Narzisstische und ödipale Merkmale" eingehen.
[6] Depersonalisierungsprozesse „beziehen sich auf das Selbst und den Körper bzw. auf die Umgebung. Es entsteht das Empfinden von Unwirklichkeit. [...] Es entsteht ein Gefühl, es sei gar nicht der eigene Körper, das eigene Selbst oder die gewohnte Umgebung. Körperteile können losgelöst oder leblos erlebt werden. Das Leben kann auf die Betroffenen fern, fremd und wie gemacht erscheinen, als beobachteten sie ein fremdes Leben und eine fremde Welt. [...] Solche Zustände [...] werden auch durch Drogen hervorgerufen oder können in Extremsituationen z.B. im Zustand der Traumatisierung und Todesdrohung auftreten“ (Ermann, 2004, S. 226).
[7] Auf Dissoziationen wird auch in den Kapiteln 4.3.1.2 „Verlassenheitsgefühle“ 4.3.2 „Auftreten von flow- Erlebnissen und physiologische Abläufe“ und 4.4.3 „Existenzerlebnis im Extrembergsteigen (Selbstfindung durch Grenzerfahrungen)“ Bezug genommen werden.
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Erstausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2009
- ISBN (Paperback)
- 9783956841743
- ISBN (PDF)
- 9783956846748
- Dateigröße
- 780 KB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Eberhard-Karls-Universität Tübingen
- Erscheinungsdatum
- 2015 (Februar)
- Note
- 1
- Schlagworte
- Bergsteiger Bergsteigen Grenzerlebnis Todesgefahr Risikotechnik Existentielle Grunderfahrung
- Produktsicherheit
- BACHELOR + MASTER Publishing