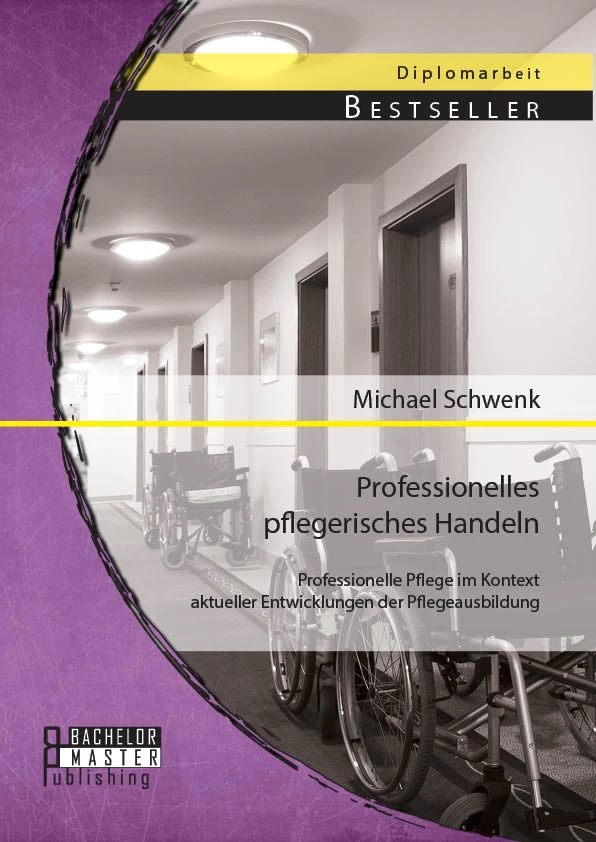Professionelles pflegerisches Handeln: Professionelle Pflege im Kontext aktueller Entwicklungen der Pflegeausbildung
Zusammenfassung
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
2.2.3 Das Konzept der Semi-Professionen
[1] Etzioni stellt kriterienorientierten „Positivlisten“ (Merkmalen, die eine Profession kennzeichnen) eine Negativliste (dementsprechend Indikatoren einer Semi-Profession) gegenüber. Professionen besitzen unter anderem eine lang ausdauernde Ausbildung von fünf Jahren, sie produzieren ihr Wissen selbst und wenden auch ihr eigenes Wissen an. Sie beschäftigen sich in ihrer Berufsausübung mit existenziellen Aspekten im Bereich von Leben und Tod.
Die Berufe der Semi-Professionen sind demzufolge so charakterisiert:
„Their training is shorter, their status is less legitimated, their right to privileged communication is less established, there is less of a specialized body of knowledge, and they have less autonomy from supervision or societal control"(Etzioni zitiert von Zoege 2004, S.228)." Unter anderem ist der Umgang mit Sterben und Tod eine Aufgabe von Semi-Professionen wie beispielsweise von Krankenschwestern, im Gegensatz zu Medizinern treffen sie dabei aber keine eigenständigen Entscheidungen.
Im Bereich der Ausbildung unterscheiden sich Professionen und Semi-Professionen ebenfalls grundlegend: Abhängig von der Wissensgrundlage bilden sich neben Berufsorganisationen die Ausbildungsstätten heraus. Ein wesentliches Merkmal von Professionen ist nämlich die autonome Selbstkontrolle innerhalb der Berufsgruppe und die Kontrolle über die Ausbildungsinhalte, wohingegen die Berufe der Semi-Professionen entweder von Professionsangehörigen, beispielsweise Medizinern kontrolliert werden oder von den Institutionen, in denen sie arbeiten.
Eine ähnliche Definition des Begriffs “Semi-Profession“ liefern Dewe und Otto:
„Als (...) bzw. Semi-Professionen werden üblicherweise Gebilde gekennzeichnet, die nur teilweise und unvollkommen durch soziale Mechanismen eine eigene Kompetenz gegenüber dem Laienpublikum wie auch gegenüber der Gesellschaft durchsetzen können (...) es mangelt Semi-Professionen an einer sozial eindeutigen Durchsetzungsfähigkeit“ (Dewe/Otto 1984, S.781).
Es folgt eine Liste von Negativmerkmalen: Unter anderem besitzen diese Semi-Professionen keine festen Zugangsregeln, um die Berufsangehörigkeit festzulegen, keine soziale Immunität, kein Monopol an Kompetenzen zur Interpretation bestimmter gesellschaftlicher Werte und vor allen Dingen keinen klar umrissenen Geltungsbereich der Berufsautonomie. Daraus resultieren eine diffuse Allzuständigkeit und ein geringes Maß an Spezialisierung.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich das Konzept der Semi-Professionen weiterhin an den Merkmalskatalogen der klassischen Professionstheorien orientiert. Diese einseitige Sichtweise, so wirft Weidner zu recht ein, lasse aber die „eventuell ganz eigene(n) Charaktere der semiprofessionellen Berufe außer acht“ (Weidner 1995, S.51).
Projiziert man das Konzept der Semi-Profession auf die Pflegeberufe, so muss man zwangsläufig zu dem Schluss kommen, dass es sich beim Pflegeberuf um eine Semi-Profession handelt, da wichtige Merkmale wie Autonomie oder „soziale Durchsetzungsfähigkeit“ im Berufsfeld der Pflege nicht erfüllt sind (vgl. dazu auch Kapitel 2.2.3).
2.2.4 Gegenläufige Bewegungen in der Professionalisierungsdebatte
In den 1970er und 1980er Jahren geriet die klassische Professionalisierungstheorie einschließlich danach bezeichneter Professionen in das Kreuzfeuer der Kritik. Neben der Deprofessionalisierung (vgl. Hartmann/Hartmann 1982) werden unter anderem auch die „Antiprofessionalisierung" (vgl. Illich 1979) als gegenläufige Tendenzen beschrieben.
Deprofessionalisierung
Hartmann und Hartmann (1982, S. 192ff) haben Tendenzen zur Deprofessionalisierung an folgenden Punkten festgemacht. Deprofessionalisierung vollzieht sich demnach
- durch das Medium Computer, der Professionelle ersetzt, zumindest im Bereich, in dem es um die Dimension systematischen Wissens geht;
- durch die Verwissenschaftlichung des Berufsalltags, in dem immer mehr akademisiertes Personal eintritt;
- durch Bürokratisierung, wodurch der Professionelle in seiner Autonomie und Entscheidungsfreiheit eingeschränkt wird;
- durch Partizipation, z.B. Bürgerbewegungen in den demokratischen Ländern
- und in einer kritischen Haltung von Laien gegenüber dem Professionellen.
Die „Entmündung des Experten“ von Ivan Illich
Mit dem Verhältnis zwischen Laien und Experten beschäftigte sich auch Ivan Illich, der den Machtausbau bestimmter Berufsgruppen kritisch betrachtet und insbesondere der Medizin eine nahezu grenzenlose Definitionsmacht zuspricht, die den Laien entmündigt, in dem der Arzt die Bedürfnisse des Patienten bestimmt und ihm Heilung verspricht. Diese „Entmündigung durch den Experten“ geht einher mit der Technologisierung und dem rasanten Fortschritt des Medizinbetriebs, in dem die großen Gewinnspannen und Verdienstmöglichkeiten ethische Aspekte verdrängen (vgl. Illich 1979).
Seine Kritik am Medizinsystem führt Illich dann in den neunziger Jahren fort; nun lehnt er die moderne Medizin gänzlich ab und bezeichnet das heutige Leben nur noch als „Überleben im technischen System“, was nur noch durch „den Verzicht auf Gesundheit und Verantwortung“ möglich ist (Illich zitiert von Zoege 2004, S.241). Eine Selbst - und Mitbestimmung des Patienten, die er in den 70er Jahren noch forderte, sei in der heutigen ausweglosen Zeit nicht mehr möglich.
Sich dennoch einfach der Medizin hinzugeben, ist meiner Meinung nach der falsche Weg, und so ist auch in der Medizin in den letzten Jahren eine deutliche Demokratisierung zu verzeichnen. Gerade im Zuge der aktuellen Debatte um Sterbehilfe wird der Autonomie des Patienten zunehmende Bedeutung und Beachtung zugewiesen. Auch ist die Tendenz zu beobachten, dass gerade Tumorpatienten sich zu Experten bezüglich ihrer Erkrankung entwickeln und nicht mehr eine Meinung eines Arztes bedingungslos akzeptieren, sondern ein deutliches Mitspracherecht in Diagnostik und Therapie einfordern. Auf der anderen Seite stehen weiterhin große Gewinne gerade von Pharmafirmen, die ihre Macht weiter ausbauen und großen Einfluss auf Politik und Medizin besitzen. Die Diskussion um Emanzipation des Laien muss weiter geführt werden und das Gesundheitssystem muss sich weiter in Richtung Gemeinwohl und Menschlichkeit entwickeln; ethische Aspekte müssen weiter an Bedeutung gewinnen.
An diesem Punkt stellt sich natürlich die Frage, ob die Pflege sich aus den genannten Gründen im klassischen Sinne der Professionstheorien überhaupt professionalisieren soll, wenn in den klassischen Professionen bereits Deprofessionalisierungstendenzen zu verzeichnen sind. Eine einseitige Autonomie gegenüber dem Leistungsempfänger, bzw. dem Patienten wäre in der Tat für die Pflege nicht erstrebenswert in einer Zeit, in der sich die Pflege hin zu ganzheitlichen Pflegesystemen und hin zu patientenorientierter Pflege entwickelt. Die wechselseitige Autonomie soll hier eher das Ziel darstellen.
2.2.5 Die feministische Debatte um Professionalisierung
Historisch betrachtet ist das Verhältnis von der Medizin zu den anderen Gesundheitsfachberufen immer schon geschlechterspezifisch geprägt. So blieb z.B. Frauen der Zugang zum Medizinstudium lange Zeit verwehrt, unter dem Vorwand, dass die geschlechtsspezifischen Eigenschaften von Frauen eher zu den Berufen im Gesundheitssystem zugeordneten Tätigkeiten (Pflege im weitesten Sinne) passe (vgl. Zoege 2004). Diese Berufe wurden dann auch der Medizin untergeordnet, die Ärzte bestimmten Inhalt und Umfang der Ausbildung und die Frauen erhielten den Status von Helferinnen (vgl. dazu auch Kapitel 3).
Verschiedene Autorinnen aus dem Bereich der Pflege setzen sich seit etwa 20 Jahren mit der Problematik der Geschlechterdifferenz und der mit der Geschlechterhierarchie verbundenen Machtausübung im Bereich der Professionalisierungsdebatte auseinander. Exemplarisch möchte ich an dieser Stelle die Arbeit von Rabe-Kleberg (1997) nennen, die untersucht hat, weshalb den traditionellen Frauenberufen immer noch die Etikette einer Semi-Profession anhängt. Sie wendet sich von der Betrachtung der klassischen Merkmale einer Profession ab und schlägt statt dessen in Anlehnung an Abbott (1988) vor, vermehrt deren Arbeit in den Mittelpunkt der Betrachtung von Professionen zu stellen. Inwieweit den traditionellen Frauenberufen Verantwortung und Mitbestimmung an Entscheidungen - im Sinne von Autonomie - gegeben wird, ist sozusagen das, was die Professionalität des pflegerischen Handelns ausmacht. In Dienstleistungsberufen ist laut Rabe-Kleberg Professionalität die Fähigkeit und Bereitschaft zur aktiven Balance zwischen gesellschaftlicher Verantwortung auf der einen Seite und eingeschränkter Autonomie auf der anderen Seite (vgl. Rabe-Kleberg 1997, S.297).
Oevermann (1997) stellt dieses professionelle Handeln in den Mittelpunkt seiner Betrachtungen mit dem Unterschied, dass er in seinen Ausführungen die Geschlechterdifferenz gänzlich außer acht lässt. Dennoch spielt der Ansatz von Oevermann gerade für die Professionalisierung der Pflege eine entscheidende Rolle und wird daher an späterer Stelle ausführlich vorgestellt.
2.3 Die Pflegeberufe – eine Semiprofession?
Zuvor soll jedoch auf der Grundlage der bisher dargestellten Professionstheorien und Sichtweisen von Professionalisierung überprüft werden, welchen Grad der Professionalisierung - ausgehend von den klassischen Professionsmerkmalen – die Pflege augenblicklich erreicht hat und wie es zu erklären ist, dass die Pflege momentan eher noch einer Semi-Profession (vgl. Etzioni 1969) zuzuordnen ist.
Dazu werde ich im Folgenden in Anlehnung an Hesse, der die angloamerikanischen Professionstheorien eingehend analysiert hat und eine Liste mit 15 typischen „Charakteristika" der „professions" erstellt hat, die in meinen Augen zentralen Merkmale von Professionen näher beleuchten.
Diese sind – in abgewandelter Form:
1. Autonomie im Sinne eines Berufsverbands als Disziplinargewalt und Kontrollinstanz;
2. Autonomie im beruflichen Handeln;
3. Expertentum, d.h. Spezialisierung und Verwissenschaftlichung von Berufswissen;
4. die Funktion, die demnach eine Profession in der Gesellschaft einnimmt, in dem Falle also die „Ausrichtung am Gemeinwohl“, was einer verbindlichen Berufsethik bedarf.
Anhand dieser Merkmale versuche ich zu einer qualitativen, bzw., quantitativen Bewertung zu gelangen.
1. Autonomie durch einen Berufsverband
Mit einem Berufsverband, der die Angehörigen eines Berufszweiges zur Selbstverwaltung ihrer gemeinsamen berufsständischen Angelegenheiten zusammenfasst, sind Kammern gemeint, sprich Körperschaften des öffentlichen Rechts. Während es für eine Vielzahl von Heilberufen bereits Kammern auf Landesebene gibt, z.B. Landesärztekammer, Psychotherapeutenkammer usw., verfügt die Berufsgruppe der Pflege zurzeit darüber noch nicht, auch wenn es immer wieder Bestrebungen nach Einrichtung einer zentralen Pflegekammer gibt.
Aufgaben einer Pflegekammer wären unter anderem:
- die Mitarbeit in der Diskussion um die Neuordnung des Gesundheitswesens, d.h. als Interessenvertretung
- Beratung und rechtliche Vertretung der Berufsangehörigen
- die Durchsetzung und Überwachung von Pflegestandards zur Qualitätssicherung,
- Öffentlichkeitsarbeit
- sowie die Förderung des Berufsstands durch Berufsausbildung und Fortbildung.
Prowasnik (2004) stellt an die Aus-, Fort- und Weiterbildung konkrete Forderungen, die ihrer Meinung nach eine Pflegekammer durchsetzen könnte:
Die Ausbildung in ihrer derzeitigen Form mit ihrer Unterscheidung in Alten-, Kranken- und Kinderkrankenpflege fördert keine pflegespezifische Identität; somit geraten Pflegekräfte bei der Erfüllung ihrer Aufgaben häufig in den Konflikt mit anderen Berufsgruppen. Die Pflegeausbildung der Zukunft erfordert Curricula, die Fachwissen und Schlüsselkompetenzen fördern, aber auch die Identifizierung mit dem Pflegeberuf unterstützen. Darüber hinaus müssen Fortbildungen für alle Pflegekräfte Pflicht werden[2] "(Prowasnik, 2004, S.166).
Die Diskussion um die Verkammerung der Pflegeberufe wird begleitet von Forderungen nach einer staatlichen Berufsordnung. Im Land Bremen ist zu Beginn dieses Jahres die erste staatliche Berufsordnung für die Pflege in Kraft getreten. In zehn Paragrafen sind dort das Ziel und das Berufsbild festgehalten sowie die „Pflicht zur gewissenhaften Berufsausübung" und die Fortbildungspflicht verankert (Griechen 2005, S.21).
Zudem wird vom Deutschen Pflegerat eine vorerst freiwillige, später verpflichtende Registrierung aller in der Pflege berufstätigen Personen angestrebt mit den Zielen, u.a. alle Berufstätigen zu erfassen, den Qualifikationsstatus zu erfassen, diesen zu überwachen, bzw. zu zertifizieren, Fortbildungen zu kontrollieren sowie eine Grundlage für Arbeitgeber zur Personaleinstellung zu schaffen, um zur „Professionalisierung der Berufsgruppe beizutragen" (DPR 2005).
Man kann also durchaus behaupten, dass der Prozess der Professionalisierung der Pflege gerade in diesem Bereich doch allmählich in Gang kommt, erste Ansätze sind bereits erkennbar, auch wenn sich Vertreter aus Politik und Pflege gegen die Einrichtung von Pflegekammern aussprechen (vgl. Dielmann 1996).
2. Autonomie im beruflichen Handeln
Autonomie im beruflichen Handeln meint in erster Linie einen eigenen, von anderen Berufsgruppen klar abgegrenzten Arbeitsbereich, in dem eigenverantwortlich entschieden werden kann. Der Pflegeberuf hat es, und so wird es auch im nächsten Kapitel 3 deutlich, von je her schwer gehabt, einen sich von der Medizin deutlich abgegrenzten autonomen Handlungsbereich zu verschaffen. Dieser bedingt auch die Definition bestimmter Vorbehaltsaufgaben für die beruflich Pflegenden, welche bisher vom Gesetzgeber für die Pflege immer noch nicht gegeben sind. Gerade im Krankenhausbereich, und dies wurde in einem eigenen studentischen Forschungsprojekt festgestellt ist zu beobachten, dass das Pflegepersonal - arbeitet es im so genannten Bereichspflegesystem - zwar seinen Arbeitsablauf weitgehend selbst bestimmen kann, sich dabei aber vielen anderen Berufsgruppen – hier sei in erster Linie die der Mediziner genannt – unterordnen muss, was unter anderem auf die Weisungsbefugnis bezüglich pflegerischer Assistenzaufgaben und den hohen Status und Einfluss des Arztes zurückzuführen ist. Dennoch besitzen die Pflegekräfte die Möglichkeit, im Bereich der „originären Aufgaben“ ihren Handlungsspielraum durch den Einsatz moderner Pflegesysteme wie z.B. „primary nursing“ oder durch einen ganzheitlich orientierten Pflegeprozess auszuweiten.
3. Verwissenschaftlichung
Wissenschaftliches Wissen spielt nicht nur in den klassischen Professionstheorien eine große Rolle, sondern nimmt auch bei Oevermann eine zentrale Rolle ein. Eine Herausbildung und Einübung des wissenschaftlichen Kurses ist neben dem therapeutischen Bündnis Voraussetzung für professionalisiertes Handeln (vgl. Kapitel 4.2.1).
Anders als in anderen Ländern gab es in Deutschland für die Produktion von Berufswissen in der Pflege lange Zeit keine eigenständige Wissensdisziplin. Erklärungen zur Durchführung von Pflegearbeit wurden mit Hilfe von Kenntnissen aus verwandten Wissensgebieten wie z.B. der Medizin oder den Naturwissenschaften begründet, vernachlässigt wurde lange Zeit die Frage, was überhaupt Pflege ist. In diesem Zusammenhang wird dann oft von tradiertem Erfahrungswissen gesprochen, wie es beispielsweise in einer Denkschrift der Robert-Bosch-Stiftung beschrieben wird:
„Pflegende haben ein umfangreiches Erfahrungswissen, das sich auf Informationen, Beobachtung und Beispiel gründet und ihnen durch implizite Schlussfolgerungen Handlungsmöglichkeiten eröffnet. Durch Versuch und Irrtum verdichten sie subjektiv erworbenes Praxiswissen, das jedoch verhältnismäßig unzusammenhängend und methodisch wenig geordnet bleiben muss. Es wird eher zufällig denn systematisch erworben und bleibt in seiner Anwendung situationsbegrenzt und kaum verallgemeinerbar (Robert-Bosch-Stiftung 1996, S.9).
Mit Beginn der Etablierung der Pflegewissenschaft an Hochschulen zu Beginn der 1990er Jahre erhoffte man sich, das dieses Erfahrungswissen in der Pflege aufgeklärt wird und neue Konzepte für die Pflege entwickelt werden. Pflegewissenschaft solle helfen, „pflegerisches Erfahrungswissen begrifflich zu fassen, zu ordnen, zu überprüfen und weiterzugeben" (ebd. S.60). Allerdings scheinen sich Schwierigkeiten zu ergeben, wie dieses neue Wissen in der Praxis ankommt. So hat zum Beispiel Bögemann-Großheim in Anlehnung an Axmacher (1991) festgestellt, dass die Pflegepraktiker tatsächlich kaum von dem Erkenntnisgewinn durch die Wissenschaft profitieren, sondern dass sie dadurch eher verunsichert würden (vgl. Bögemann-Großheim 2004, S.101). Andererseits spricht sie im Zuge der Etablierung der Pflegewissenschaft dennoch von einem Gewinn für die Disziplin Pflege, da damit eine intersubjektive Sprache entstehe, die „im Prinzip jedem, unabhängig von seinen individuellen Erfahrungen, den Zugewinn an Kenntnissen, Argumenten und Einsichten ermöglicht" und damit auch die Chancen wachsen, „die Berufsangehörigen in der Pflege so auszubilden, dass sie zu professioneller Handlungsfähigkeit befähigt werden" (ebd. S.102).
Das Erfahrungswissen, über das die Pflege verfügt, kann aber auch eine Basis der Professionalisierung darstellen und es gibt Stimmen, die vor einem einseitig auf Akademisierung und wissenschaftliche Fundierung ausgerichteten Verständnis der Professionalisierung warnen[3] (vgl. Gerlach 2005, S.17).
Dennoch ist in meinen Augen ist ein wissenschaftlicher Diskurs unabdingbar für professionalisiertes Handeln in der Pflege und das über die Jahrhunderte gesammelte Erfahrungswissen stellt demnach nur eine Basis für Professionalisierung dar, wenn es gesammelt, systematisiert und in theoretische Konzepte eingearbeitet wird, worin ich noch einen Nachholbedarf für die Pflegewissenschaft sehe. Akademisierung darf auf der anderen Seite natürlich auch nicht mit Professionalisierung gleichgesetzt werden, und da ist man sich auch in der neueren Professionsliteratur einig; die Leistungsfähigkeit wissenschaftlicher Erkenntnisse scheint nach Albert gerade „bei der Lösung von berufs- und lebenspraktischen Problemen“ überschätzt zu werden. Zudem bleibe in diesen Diskussionen meist unberücksichtigt, dass eine Akademisierung hauptsächlich auf der pädagogischen Ebene und der Leitungsebene stattfindet (vgl. Albert 2000).
Auf die Vermittlung von Wissen und auf den Transfer des wissenschaftlichen Pflegewissens wird gegen Ende dieser Arbeit wieder geschaut, wenn es um den aktuellen Stand der Pflegeausbildung und Akademisierung der Pflege geht (vgl. Kapitel 5).
4. Ausrichtung am Gemeinwohl
In den funktionalistischen Professionstheorien wird die Entstehung von Professionen als angemessene Konsequenz gesellschaftlicher Modernisierungsprozesse beschrieben. Sie besitzen ein Monopol zur Erbringung ihrer Dienstleistungen und legitimieren dadurch ihre Privilegien, die sie besitzen sozusagen selbst. Sie dürfen ihre damit verbundene Macht und ihren Einfluss natürlich nicht missbrauchen, aus diesem Grund müssen sie eine „Gemeinwohlorientierung“ ausweisen, was sie nur auf der Grundlage einer verbindlichen Berufsethik legitimieren können (vgl. Daheim 1992, S23f).
Der Pflege hat Hampel diese „Gemeinwohlorientierung" zugewiesen: Demnach kann sie nicht als selbstorientiert, sondern als Dienst an der Gesellschaft gesehen werden (vgl. Hampel 1983, S. 102f). Die Funktion der Pflege verdeutlicht auch die Entwicklung des Pflegeberufs seit der Mitte des 19. Jahrhunderts (vgl. Kapitel 3). Seit 1953 existiert zudem ein internationaler Ethik Kodex für Pflegende, der vom Weltbund der Krankenschwestern und Krankenpfleger (ICN) angenommen wurde. In Deutschland wird der ICN vertreten durch den Deutschen Berufsverband für Pflegeberufe (DBfK). In der zurzeit gültigen und überarbeiteten Fassung des Ethik Kodex von 2000[1] heißt es unter anderem darin, dass ein „universeller Bedarf" an Pflege besteht und dass die Pflegende ihre berufliche Tätigkeit „zum Wohl des Einzelnen, der Familie und der sozialen Gemeinschaft" ausübt.
Fazit
Orientiert man sich an den merkmals-indikatorischen Professionstheorien und misst den Grad der Professionalisierung an den von mir beschriebenen vier zentralen Merkmalen, so muss man zwangsläufig zu dem Schluss kommen, dass der Pflegeberuf lediglich als Semi-Profession eingestuft werden kann, da die Professionskriterien wie Autonomie und Verwissenschaftlichung nicht in dem erforderlichen Maß vorliegen, damit der Pflegeberuf als Profession im klassischen Sinne bezeichnet werden kann. „Gemeinwohlorientierung“ und Organisation im Berufsverband mit einem „code of ethics“ sowie die Registrierung von Pflegekräften können zwar als Faktoren eingestuft werden, die eine Professionalisierung vorantreiben. Solange es sich dabei jedoch nur um vereinzelte Initiativen handelt, keine Verbindlichkeit vorherrscht, die Vielzahl der Pflegekräfte in Deutschland eben nicht in einem Berufsverband organisiert sind und auch der Gesetzgeber es versäumt, Vorbehaltsaufgaben für die Pflege zu definieren, wird die Pflege es schwierig haben, den Status einer Semi-Profession hin zu einer Voll-Profession zu vollziehen.
Es wird deutlich, dass eine derartige Bewertung von professionstheoretischen Merkmalen für die Pflege als unbefriedigend einzustufen ist; darüber hinaus – und an dieser Stelle sei auf die in Kapitel 4 folgende Kritik Oevermanns hingewiesen - klammern sie den Kern des beruflichen Handelns aus.
Grundsätzlich stellt sich auch die Frage, ob ein derartiges Streben nach bestimmten Merkmalen heutzutage überhaupt noch zeitgemäß ist, verfolgt man beispielsweise den Deprofessionalisierungsprozess in den klassischen Professionen wie der Medizin.
Zudem werden die gesellschaftlichen Kontextbedingungen in einer derartigen merkmalsorientierten Betrachtungsweise nicht berücksichtigt, die eventuell verhindert haben könnten, dass die Pflege nicht über den Status einer Semi-Profession herauskommen konnte und die die Herausbildung von professionellem Handeln einschränkten.
3. Die Entwicklung der Pflegeberufe
Im Folgenden soll der Versuch unternommen werden, die ganz eigene Entwicklung des Pflegeberufs darzustellen und aufzuzeigen, warum es der Pflege bisher nicht gelingen konnte, über den Grad einer Semi-Profession hinauszukommen.
Dazu wird die Entwicklung des Pflegeberufs aufgezeigt, welche in Deutschland in der Mitte des 19. Jahrhunderts beginnt, sodass auf vorangegangene Epochen verzichtet wird.
3.1. Anfänge der Ausbildung in der neuzeitlichen Krankenpflege
Die Krankenpflege wird üblicherweise als traditioneller „Frauenberuf" verstanden, der in der Mitte des 19. Jahrhunderts vor allem durch konfessionelle Pflegeorganisationen geprägt wurde. Hierbei spielten zum einen katholische Krankenpflegeorden wie beispielsweise die deutschen Barmherzigen Schwestern, zum anderen auch die protestantische Diakonissen-Krankenpflege mit zahlreichen Mutterhäusern eine bedeutende Rolle. Der weitere Verlauf der Krankenpflegeausbildung ist von diesen Gemeinschaften mitbestimmt worden und bis heute besitzen sie „einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf das Niveau der Krankenpflege (...) und auf die formalrechtlichen Regelungen der Ausbildung durch den Staat" (Kruse 1987, S.27).
Ausbildung in katholischen Pflegeorden
Es existierten im 19. Jahrhundert mehrere katholische Orden, deren Angehörige in der Krankenpflege tätig waren. Von Bedeutung dabei waren vor allem die Clemensschwestern, die in der Stiftung der Barmherzigen Schwestern organisiert waren, die Borromäerinnen sowie die Vinzentinerinnen.
Die Anforderungen die an die zukünftige Ordensfrau gestellt wurden - wollte sie beispielsweise den Barmherzigen Schwestern beitreten - orientierten sich neben absoluter körperlicher Gesundheit vor allem an christlichen Tugenden:
„Einen guten Unterricht in der Religion, gesunder Menschenverstand, Überlegung, Achtsamkeit, Ruhe und Geistesgegenwart, überhaupt natürliche Krankenpflege, wohin füglich gerechnet werden kann, nicht zu wenig Mitgefühl, nicht zu viel Empfindsamkeit und große Liebe zur Reinlichkeit, Ordentlichkeit und Ordnung" (Kruse 1987, S.28).
Die Ausbildung fand auf den Krankenstationen unter Anleitung geübter Schwestern statt. Theoretischer Unterricht wurde überhaupt nicht erteilt.
Bei den Borromäerinnen und den Vinzentinerinnen gestaltete sich die Ausbildung ähnlich, auch dort erfolgte das Erlernen der Krankenpflege ausschließlich durch praktische Mitarbeit auf den Stationen, ohne theoretische Kenntnisse zu besitzen. Eine einheitliche Dauer der Ausbildung existierte ebenso wenig, hinzu war sie immer mit einer Aufnahme in den Orden verbunden, die wesentlich länger dauerte als die eigentliche Ausbildung zur Pflegerin selbst. Oftmals kam es dadurch auch zu Differenzen bezüglich der Ausbildungsinhalte; es entstand ein Spannungsverhältnis zwischen christlicher und weltlicher Erziehung und es lag in der Hand der Generaloberin, wie das Verhältnis zwischen weltlichen und christlichen Inhalten gestaltet wurde (vgl. Mischo-Kelling/Wittneben 1995, S.224f).
Ausbildung in den diakonischen Mutterhäusern
Demgegenüber stand die pflegerische Ausbildung in dem von Theodor Fliedner gegründeten, protestantischen Pflegeorden in Kaiserswerth, die maßgeblich für die Entwicklung der Krankenpflege als Beruf gesehen wird und den Beginn der neuzeitlichen Pflege markiert. Fliedner beabsichtigte die 1836 eröffnete Bildungsanstalt für evangelische Pflegerinnen als „Multiplikator einer qualifizierten Krankenpflege" (Kruse 1987, S.32) in Deutschland zu etablieren.
Erstmals wurden Begriffe wie „praktische Anleitung“ und „theoretische Unterweisung“ gebraucht und Grundlagen der Anatomie und Physiologie unterrichtet. Den theoretischen Unterricht erteilte ein ortsansässiger Arzt, in der Regel eine Stunde wöchentlich. Darüber hinaus hielt Theodor Fliedner selbst mehrere Stunden Unterricht pro Woche. Die praktische Anleitung erfolgte durch die Vorsteherin, der Vorgesetzten aller Diakonissen, die von erfahrenen Diakonissen unterstützt wurde. Dabei begannen die Probediakonissen bei einfachen hauswirtschaftlichen Tätigkeiten, später wurden sie auf der Kinderkrankenstation und der Frauenkrankenstation eingesetzt. Gegen Ende ihrer Ausbildung begleiteten sie die leitende Diakonisse auf der Männerstation. Es wurde also der Weg vom Leichten zum Schweren gewählt, um die Probediakonissen langsam an die physischen und psychischen Belastungen heranzuführen (vgl. Kruse 1987, S.36).
Obwohl im Unterschied zur Ausbildung in den katholischen Orden theoretischer Unterricht erteilt wurde und sich die Pflege nicht nur auf körperliche Aspekte, sondern auch auf den Geist kranker Menschen bezog, wird die Qualität dieser Ausbildung in den Diakonie-Mutterhäusern dennoch überwiegend negativ beurteilt. Eindeutig im Vordergrund der Ausbildung standen christliche Aspekte wie das selbstlose Dienen und die Bereitschaft zur ganzen Lebenshingabe; die fachliche Ausbildung trat gegen Ende des 19. Jahrhunderts immer mehr in den Hintergrund (vgl. Sticker 1989, S.146ff). Das ursprüngliche Ziel von Fliedner, ein Multiplikator für eine qualifizierte Ausbildung zu sein, wandelte sich dahingehend, dass es tatsächlich in erster Linie darum ging, so schnell wie möglich Arbeitskräfte für die Pflege kranker Menschen auszubilden (vgl. Mischo-Kelling/Wittneben 1995, S.228), die schnell einsatzfähig waren. Ursache dafür war die große Nachfrage nach Pflegekräften, die mit der Industrialisierung und dem raschen medizinischen Fortschritt einherging.
Die Ausbildung in den Schwesternschaften des Roten Kreuzes
Neben diesen konfessionellen Vereinigungen bildeten sich verschiedene Vereine, unter anderem der 1859 gegründete badische Frauenverein, der eine zwei bis fünf Monate dauernde Ausbildung zur Krankenwärterin durchführte (vgl. Kruse, 1987, S.44), die mit einer Prüfung abgeschlossen wurde. Sie wurden 1866 zu Schwestern des Roten Kreuzes und ihre Zahl stieg im weiteren Verlauf des Jahrhunderts rasch an. Dabei lebten sie ähnlich wie in einem Mutterhaus des Kaiserwerther Verbands zusammen. Grund dafür war, so Kruse, dass sie durch das Wohnen in der Gemeinschaft sie in ihrem Glaubensleben gestärkt und gestützt wurden, die christliche Religion sahen sie auch als Grundlage ihrer Krankenpflege an (ebd., S.45).
Der theoretische Unterricht wurde von Ärzten und Pfarrern erteilt, die Inhalte des theoretischen Unterrichts bestimmten, welche auf einem eher geringen Abstraktionsniveau angesiedelt waren, um - so vermutet Kruse - den Abstand zwischen Wissenden und Nichtwissenden nicht zu sehr zu verringern und um zu verhindern, dass die gefühlsmäßige Zuwendung der Schwestern nicht zu sehr in den Hintergrund rückt (ebd. S.46f).
Berufsorganisation der Krankenpflegerinnen Deutschlands
Neben den Schwestern, die konfessionellen Orden angehörten oder in Verbänden wie dem Roten Kreuz organisiert waren, gab es die freien Schwestern, deren Interessen von niemandem vertreten wurden. Einen entscheidenden Wandel schaffte zu Beginn des 20. Jahrhunderts Agnes Karll mit der Gründung der Berufsorganisation der Krankenpflegerinnen Deutschlands. Sie trat dafür ein, dass sich die Schwestern ähnlich wie die englischen und amerikanischen Schwestern selbst für ihre Belange eintreten sollten. Für eine Verbesserung der Krankenpflege sollte, so ihre Forderung unter anderem die Ausbildung gründlich, systematisch und über einen Zeitraum von drei Jahren erfolgen, was sie aber nicht durchsetzen konnte. Auch setzte sie sich dafür ein, dass an der Auswahl der Inhalte des theoretischen Unterrichts Krankenpflegerinnen beteiligt waren, da ihrer Meinung nach Ärzte nicht die richtige Grenze ziehen könnten, da „er eben Arzt und nicht Pflegerin ist und vor allem nicht Pädagoge"[4] (Karll zitiert von Kruse 1987, S.61).
Zusammenfassung
Laut Kruse ist durch die Gründung eines Berufsverbands durch Agnes Karll ein erster Ansatz von Professionalisierung der Pflege deutlich erkennbar (ebd. S.68), zumindest sind meiner Meinung nach ihre Bemühungen nach gerechter Bezahlung, das Streben nach Autonomie und die Forderung nach einer fundierten theoretischen Ausbildung Merkmale einer sich heranbildenden Profession. So kommen auch Ostner und Krutwa-Schott (1981) in ihrer Untersuchung der historischen Entwicklung des Krankenpflegeberufs zu dem Ergebnis, dass mit der Arbeit der Freien Schwestern der Beginn der Professionalisierung der Pflege markiert wird. Sie weisen aber darauf hin, dass es der Pflege wie anderen typischen Frauenberufen auch an Autonomie fehle und dass sie daher nicht über den Status einer Semi-Profession herauskommen könne, da „die weibliche Professionalisierung (...) nichts anderes als ein Kompromiss zwischen der weiblichen Seinserfüllung im Dienst für andere und den neuen Erfordernissen beruflicher, u.a. medizinischer Arbeit“ war (ebd. S.63).
Wenn der zu dieser Zeit noch sehr geringe Anteil des theoretischen Unterrichts in der Pflegeausbildung sowohl inhaltlich als auch methodisch von Ärzten und Theologen bestimmt und gehalten wurde und die Auszubildenden überwiegend in christlichen Gemeinschaften lebten, so konnten diese Voraussetzungen auch nicht dazu beitragen, dass sich eine Professionalisierung vollzieht.
Diese Medizindominanz in der Ausbildung und im beruflichen Feld setzte sich auch nach der Jahrhundertwende weiter fort.
3. 2 Bemühungen um staatliche Regelungen der Krankenpflegeausbildung
3.2.1 Vorschriften über die staatliche Prüfung von Krankenpflegepersonen von 1906
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts setzten in Deutschland Bestrebungen um eine staatliche Regelung der Krankenpflegeausbildung ein, die in erster Linie von Ärzten ausgingen, die eine bessere und umfassendere Ausbildung des Pflegepersonals forderten, damit sie mit dem medizinischen Fortschritt mitgehen konnten. Daneben waren es auch Politiker, die durch eine bessere Ausbildung bessere Arbeitsbedingungen schaffen wollten. Eng damit verbunden seien eine Wertsteigerung des Berufs und gesellschaftliche Anerkennung und wirtschaftliche Selbstständigkeit der im Krankenpflegeberuf tätigen Frauen (vgl. Kruse 1987,103f) sowie die Möglichkeit zur Selbstbestimmung.
Die Gegner einer staatlichen Ausbildungsregelung waren vor allem die katholischen Pflegeorden und die Schwesternschaften des Roten Kreuzes, die an dem caritativen Paradigma der Krankenpflege weiter festhielten. Sie sahen die Krankenpflege weiterhin als „Liebesdienst“ an, der durch die Bezahlung von Lohn entwertet wurde.
Am 22. März 1906 beschloss der Bundesrat „Vorschriften über die staatliche Prüfung von Krankenpflegepersonen“, auf dessen Grundlage Preußen 1907 als erstes Land landesrechtliche Vorschriften über die stattliche Prüfung für Krankenpflegepersonen erließ. Diese leiteten damit einen staatlich vorgeschriebenen beruflichen Bildungsweg ein. Die Ausbildung dauerte entgegen den Forderungen von Berufsverbänden nur ein Jahr und fand an staatlich anerkannten Ausbildungsstätten, die in der Regel an Krankenhäusern angegliedert waren, statt. Die theoretische Ausbildung wurde von Medizinern übernommen, denn „es war der Arzt, der für ein gewisses Niveau in der Pflege sorgte, das den Anforderungen einer wissenschaftlichen Krankenpflege genügte“ (Mischo-Kelling/Wittneben 1995, S.236). Zusätzlich wurde die Schulleitung Medizinern übertragen, und der Prüfungsausschuss setzte sich aus drei Ärzten zusammen, womit sich der Einfluss der Medizin in die Krankenpflegeausbildung weiter verstärkte. Die Stellung der weltlichen und christlichen Mutterhäuser blieb dennoch erhalten und die Ausbildung war weiterhin geprägt durch die Vermittlung christlicher Elemente wie Helfen, Dienen und Nächstenliebe (vgl. Kruse 1987, S.104).
Bis in das Dritte Reich hinein gab es keine staatliche Einigung hinsichtlich Struktur der Ausbildung und den Ausbildungsinhalten; die 1929 gegründete „Arbeitsgemeinschaft weiblicher Krankenpflegeorganisationen" trug dazu auch nicht bei, da sie eigene Verbandsinteressen verfolgte (vgl. Mischo-Kelling/Wittneben 1995, S.240). So strebte sie unter anderem eine dreijährige Ausbildung an. Sie wurde 1933 von der Reichsfachschaft deutscher Schwestern (RFS) übernommen.
[...]
[1] Die folgenden Ausführungen sind aus Zoege (2004) übernommen, die Etzioni übersetzt hat.
[2] Hier handelt es sich um eine Forderung, die in ähnlicher Form die SPD in ihrem Antrag zur Novellierung des Krankenpflegegesetzes bereits 1963 gestellt hat. Hierin heißt es unter anderem unter Punkt 3: „Gesetzliche Gewährleistung beruflicher Fortbildung“ (vgl. Kruse 1987, S.127f). Diese Forderung wurde von Vertretern der CDU und FDP damals abgelehnt unter dem Argument, dass der Personalmangel „das Herausnehmen der Pflegekräfte aus ihrer Arbeit illusorisch macht“ (ebd. S.129).
[3] Sie verweisen unter anderem auf Patricia Benners Überlegungen zur Bedeutung impliziten Wissens und Handelns in der Pflege, vgl. Benner 1994 „Stufen zur Pflegekompetenz (from novice to expert)“
[4] Agnes Karll macht hier auf ein wesentliches Problem in der theoretischen Ausbildung aufmerksam, das sich bis in die heutige Zeit überliefert hat trotz der Änderungen des neuen Krankenpflegegesetzes von 2003 und die Betonung auf die Vermittlung pflegerelevanter Kenntnisse (vgl. dazu auch Kapitel 3.5).
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Erstausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2005
- ISBN (Paperback)
- 9783956842061
- ISBN (PDF)
- 9783956847066
- Dateigröße
- 4.7 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Hochschule Ludwigshafen am Rhein
- Erscheinungsdatum
- 2015 (Februar)
- Note
- 1,3
- Schlagworte
- Oevermann Akademisierung generalistische Pflegeausbildung Pflegeberuf Nächstenliebe
- Produktsicherheit
- BACHELOR + MASTER Publishing