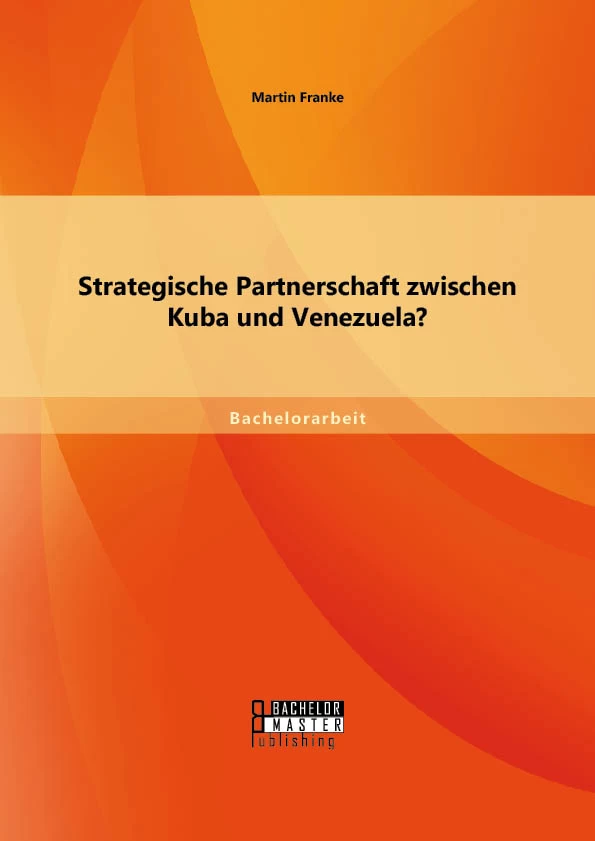Strategische Partnerschaft zwischen Kuba und Venezuela?
Zusammenfassung
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
2. Theoretische Konzepte der internationalen Politik
2.1. Neoliberaler Institutionalismus
„We live in an era of interdependence“ (Keohane/Nye 1989: 3), schreiben die beiden Theorieväter Robert O. Keohane und Joseph S. Nye in ihrem Werk Power and Interdependence (1977), wobei hier zu berücksichtigen ist, dass die beiden als Studenten der späten 1950er und frühen 1960er Jahre durch die „realistische“ Brille sozialisiert wurden. In After Hegemony (1984), einem weiteren Standardwerk, in dem die Interdependenztheorie weiterentwickelt wurde, führt Keohane aus, dass seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges die internationale Kooperation zwischen Industrieländern größer sei als jemals zuvor. Und auch angesichts der Rolle des US-State of Secretary Kissinger ist die Existenz des neoliberalen Institutionalismus als wichtiger Beitrag zum Verständnis des internationalen Systems nicht mehr in Frage zu stellen:
„Now we are entering a new era. Old international patterns are crumbling; old slogans are uninstructive; old solutions are unavailing. The world has become interdependent in economics, in communications, in human aspirations” (Kissinger 1975: 1, zitiert nach Keohane/Nye 1989: 3).
Durch die damalige weltpolitische Einordnung in eine bipolare Stellung ist der Ansatz des neoliberalen Institutionalismus nicht allzu weit entfernt von dem Realismus, der ein Staatensystem erklärt, das durch Unsicherheit und Macht geprägt ist (vgl. Schimmelfennig 2013: 89). Dennoch gibt es wesentliche Unterschiede zum Realismus in der Form, „dass Interdependenz und Regime als wirkungsmächtige Strukturmerkmale des internationalen Systems und zur Anarchie hinzutreten“ (Schimmelfennig 2013: 90). Beim Realismus sind Staaten darauf angewiesen, nach Macht zu streben, da sie nur so der Anarchie als bestimmendes Strukturmerkmal gerecht werden können beziehungsweise im internationalen System überlebensfähig sind. Für den neoliberalen Institutionalismus ist der Handlungsspielraum größer. Der Anarchie und damit der existentiellen Unsicherheit kommt nur eine untergeordnete Bedeutung zu. Mit anderen Worten, „leugnet [der neoliberale Institutionalismus] weder den Interessen-Egoismus in der Staatenwelt noch ihr Gewaltpotential. Er sieht aber die Möglichkeit, dieses Potential zu bändigen, die Konflikte zwischen den Staaten einzuhegen“ (Müller 1993: 1).
Es gilt zunächst die Annahme, es handle sich um einheitliche und egoistisch-zweckrational handelnde Staaten, die somit auch ihre Ziele und Verhaltensweisen darauf ausrichten. „Sie streben […] nicht in erster Linie nach Macht, sondern nach (absoluten) Gewinnen“ (Schimmelfennig 2013: 90). Daher sind Staaten in der Regel auf Kooperation mit anderen Staaten angewiesen – es sei denn sie können aus eigener Stärke auf eine solche Zusammenarbeit verzichten.[1] Interdependenz als eine auf Kooperation basierende Dynamik kann als die wechselseitige Abhängigkeit von Staaten definiert werden, in der ein Staat auf andere Staaten angewiesen ist, um seine eigenen Ziele zu verwirklichen (vgl. Schimmelfennig 2013: 92). Eine engere und gehaltvollere Definition spricht nur dann von Interdependenz, „wenn zentrale Funktionen der Staaten betroffen sind, vor allem die Sicherheit nach außen und innen, die Stabilität der staatlichen Ordnung“ (ebd.) und weitere.
Für Keohane und Nye sind drei Merkmale der komplexen Interdependenz von Bedeutung: sogenannte Multiple Channels, die Gesellschaften und deren einzelne Bestandteile miteinander verbinden (zum Beispiel Regierungen, Nichtregierungsorganisationen und transnationale Organisationen); mit der absence of hierarchy among issues meinen sie, dass zwischenstaatliche Beziehungen nicht von einer konsistenten Hierarchie geprägt sind, sondern auf der Grundlage von innenpolitischen Diskursen entstehen; und im dritten Charakteristikum befinden sie, dass militärische Gewalt von Regierungen nicht gegenüber anderen Regierungen eingesetzt wird (vgl. Keohane/Nye 1989: 24 f.). Aus dem Verständnis für den Interdependenzansatz entsteht die Notwendigkeit von Kooperation[2]: „Cooperation requires that the actions of separate individuals or organizations [...] be brought into conformity with one another through a process of negotiation, which is often referred to as policy coordination” (Keohane 1984: 51). Darüber hinaus besteht einerseits das Problem, dass Kooperation zu einer Spannung zwischen Wirtschaft und Politik führen kann. Andererseits können bei kooperativen und interdependenten Strukturen negative Einflüsse wie Arbeitslosigkeit oder Inflation auf die Partnerländer übertragen werden genauso wie positive Faktoren.
Zur Interdependenz kommen internationale Regime als zweiter zentraler Baustein des Institutionalismus hinzu, die als „problemspezifische und handlungsleitende Regelwerke“ (Schimmelfennig 2013: 102) gekennzeichnet sind. Normalerweise werden sie schriftlich fixiert und liegen als vertragliche Vereinbarungen vor. Konkret setzen sie sich aus Normen, Regeln, Prinzipien und Verfahren zusammen und bearbeiten Konflikte zwischen konkurrierenden Staaten. „Regime sind Institutionen, d.h. dauerhafte Ordnungen für interpersonales Handeln und Kommunikation; sie bestehen aus einem Geflecht von Rollen, die durch Regelungen oder Konventionen zusammengehalten werden“ (Müller 1993: 26). Keohane schreibt, dass das Konzept vom internationalen Regime komplex sei, da es sich über diese vier Komponenten definiert, die sich in ihrem Ausmaß wiederum gegenseitig beeinflussen können. Zu den vier Begriffen, die Keohane definiert, zählen Normen als Verhaltensstandards, die sich im Rahmen von Rechten und Verpflichtungen der Mitglieder manifestieren; Regeln zeigen genauer an, wie diese Rechte und Verpflichtungen gestaltet sind; Prinzipien implizieren die Ziele, nach denen die Mitglieder streben; und Verfahren beinhalten die Art und Weise zur Implementierung der Prinzipien und zur Änderung der Normen (vgl. Keohane 1984: 58 f.).
Die Indikatoren für eine Operationalisierung des neoliberalen Institutionalismus eröffnen sich mit Annahmen, die die Interdependenz betreffen:
1. Die Notwendigkeit von Kooperation ist gegeben (d.h. Dependenz liegt vor).
2. Zentrale Funktionen der Staaten (z.B. die Stabilität der staatlichen Ordnung) sind von der Partnerschaft abhängig.
3. Die Kooperation hat Einflüsse auf wirtschaftliche Strukturen wie Inflation, das Bruttoinlandsprodukt und den Arbeitsmarkt.
Bezüglich der internationalen Regime kann man viertens davon ausgehen, dass Abkommen und Verträge diese Partnerschaft in vollem Maße begründen. Mit anderen Worten sind die Normen, Regeln, Prinzipien und Verfahren allein in Verträgen ausgehandelt – auch zur eigenen Absicherung der Kooperationspartner.
2.2. Konstruktivismus
„Sehr allgemein gesprochen kann man sagen, dass konstruktivistischen Ansätzen in den Internationalen Beziehungen Vorstellungen […] zugrunde liegen, die von der Konstruktion von sozialer Welt ausgehen“ (Ulbert 2005: 9). Die Anhänger dieser systemischen Theorie stehen mit dieser Aussage den konventionellen Theorien entgegen, darüber hinaus ist der Konstruktivismus erst aus der Reflexion über das internationale System entstanden.
Alexander Wendt fragt ganz zu Beginn seiner Ausführungen in Social Theory of International Politics (2000)[3] zur Annäherung an die konstruktivistische Theorie: „How we explain the real world?“ (Wendt 2000: 6). Mit dem Ende des Kalten Krieges hatte sich ein (welt-) politisches Phänomen aus der Wirklichkeit verabschiedet, das die zu diesem Zeitpunkt etablierten Theorien der politologischen Teildisziplin IB nicht oder nur schwer erklären konnte (vgl. Wendt 2000: 4). Auch wenn es aus sozialtheoretischer Sicht eine lange Tradition[4] konstruktivistischen Denkens gab, schien doch, dass bis zum Ende der bipolaren Weltkonstellation vor allem Eigeninteressen und Zwang die internationale Politik beherrschten und dass das internationale System kein sozialer Platz sei (vgl. Wendt 2000: 2). Der Konstruktivismus entwickelte sich vor allem im angloamerikanischen Wissenschaftsbetrieb als wesentliche Gegenposition zu allen bisherigen Theorien (vgl. Schimmelfennig 2013: 160). Die zentrale Kritik von Wendt an Realisten und Institutionalisten war, dass die beiden nicht anerkennen würden, dass das internationale System die Identität und Interessen eines Staates forme. Während beim Realismus und neoliberalen Institutionalismus die internationale Politik stark materialistisch geprägt ist – insbesondere bei der Verteilung von materiellen Ressourcen und Macht – spielen beim Konstruktivismus vor allem nicht-materielle Ressourcen in Form von intersubjektiven Strukturen und angemessenem Verhalten von Akteuren eine bedeutende Rolle. Die Strukturen basieren auf der Annahme, dass sie nicht nur das Handeln der Akteure regulieren, sondern bereits deren Wünsche und Ziele bilden (vgl. ebd.). Doch wer konstruiert überhaupt? Wendt argumentiert für einen Staatskonstruktivismus[5], der „die konsequenteste Engführung der konstruktivistischen Perspektive auf die internationale Politik“ (Weller 2005: 49 f.) ist. „No one can see the state or international system” (Wendt 2000: 5). Deshalb ist es von zentraler Bedeutung, dass nach der innergesellschaftlichen Konstruktion der Staat als Staat unus inter pares auch international anerkannt und damit konstruiert wird. Wendt macht deutlich, dass nicht die Prozesse innerhalb eines Staates im Mittelpunkt stehen, sondern die Prozesse und Strukturen zwischen Staaten. Darüber hinaus vermenschlicht er die Staaten mit der Aussage „States are people too“ (Wendt 2000: 215) und bringt somit das internationale System auf eine einfache Formel: Staaten verhalten sich wie Menschen.
Des Weiteren behaupten die Vertreter des Konstruktivismus, dass Akteur und Struktur sich gegenseitig konstruieren, abgeleitet aus Giddens´ Strukturierungstheorie: „Soziales Handeln [kann] nur erklärt werden, wenn man davon ausgeht, dass sowohl Strukturen das Handeln von Akteuren ermöglichen oder beschränken, als auch dass Akteure die Strukturen, innerhalb derer sie handeln, aktiv gestalten und verändern können“ (Ulbert 2005: 17).
Im Umgang mit dem Konstruktivismus müssen Annahmen formuliert werden, anhand derer später die Wirklichkeit gemessen werden kann: Erstens besagt die Logik der Angemessenheit, dass Akteure nicht handeln, um den eigenen Nutzen zu maximieren, sondern „um ihren normativen Verpflichtungen nachzukommen, moralischen Prinzipien Genüge zu tun oder gesellschaftlichen Regeln und Erwartungen zu entsprechen“ (Schimmelfennig 2013: 163). Dieser Grundsatz verneint die Bedeutung der rationalen Entscheidung, dass jeder Akteur nutzenmaximierend handelt. Mit der Annahme besteht sogar die Möglichkeit, einen Nachteil aus der gewählten Handlungsoption zu erzielen. Zweitens ist unter dem Aspekt ideeller Strukturen zwischen kausalen und instrumentellen Ideen und prinzipiellen Ideen zu unterscheiden: Wissen als Ergebnis kausaler und instrumenteller Ideen ist als „gemeinsame Überzeugungen hinsichtlich von Ursache-Wirkungs-Zusammenhängen und Problemlösungen“ (Schimmelfennig 2013: 164) definiert. Ideen sind nicht notwendigerweise real, sondern entstehen im Kopf. Alles was davon übrig bleibt, führt Wendt als Wissen auf. „It can be a key determinant of how states frame international situations and define their national interests […]” (Wendt 2000: 141).[6] Prinzipielle Ideen gelten als Oberbegriff für Werte und Normen. Drittens beschreiben „politische Werte […] die erwünschten Merkmale und Zwecke politischer Ordnung“ (Schimmelfennig 2013: 165). Teilen Staaten dieselben Werte, spricht man auch von einer Wertegemeinschaft. Werte spielen in der Hinsicht eine wichtige Rolle, als dass sie zu gemeinsamen Annahmen über das Verständnis von Demokratie, Freiheit oder Sicherheit führen. Viertens sind Normen als kollektive Standards angemessenen Verhaltens zu nennen: „Während sich Werte auf wünschbare politische Zustände und Zwecke politischer Ordnung beziehen, geht es bei Normen um das erwünschte Verhalten der Akteure“ (ebd.). Diejenigen Gruppen, die diese kollektiven Standards teilen, können entsprechend als normative Gemeinschaften bezeichnet werden. Als fünfte Annahme ist Identität aufzuführen: Rollenkonzepte oder kulturell determinierte Handlungsrepertoires, die in der Folge zur Unterscheidung von sogenannten in-groups und out-groups führen. Wichtig ist auch die Tatsache, dass „jedes Individuum, jede Gruppe [und Staaten] […] durch Übernahme der entsprechenden Ideen eine neue Identität annehmen“ (ebd.) können. Diese fünf zentralen Annahmen sind konstruktivistische Einflüsse auf die Interessenbildung. Und die Erklärungen von Macht und Interessen setzen Ideen voraus. Daher kann laut Wendt ein maßgeblicher Anteil staatlicher Handlungen mit Ideen erklärt werden: „The claim is rather that power and interest have the effects they do in virtue of the ideas that make them up“ (Wendt 2000: 135).
Die Frage nach der Operationalisierung ist dabei von essentieller Bedeutung: Wie wird beispielsweise der soziale Standard der Angemessenheit definiert? Welches Wissen, welche Werte und Normen können als messbare Größe für die folgende Analyse dargestellt werden? Für dieses Unterfangen müssen dementsprechende Indikatoren festgelegt werden:
1. Ideen, Werte, Normen, Identität, etc. werden im Kontext der Beziehungen genannt oder durch Abkommen festgelegt.
2. Die Begründung dieser Ideen, Werte, Normen, Identität, etc. als zentrale Notwendigkeit der Beziehungen.
3. Die Umsetzung dieser Ideen, Werten, Normen, Identität, etc. innerhalb der Beziehungen.
3. Strategische Partnerschaft zwischen Kuba und Venezuela?
3.1. Ausgangssituationen in Kuba und Venezuela
Kuba ist im Grunde seit der spanischen Besetzung im 16. Jahrhundert wirtschaftlich abhängig von externen Akteuren: erst war die „Zuckerinsel“ eine spanische Kolonie, seit Anfang des 20. Jahrhunderts stand sie unter der Vormundschaft der USA. Nach der Revolution 1959 entwickelte sich Kuba zum Weggefährten der UdSSR, die nicht nur politisch auf gleicher Linie war, sondern der auch als Absatzmarkt, Erdöllieferant und Finanzier eine bedeutende Rolle zukam. Mit den RGW-Staaten wickelte die sozialistische Karibikinsel drei Viertel ihres Außenhandels ab, im Austausch standen „über dem Weltmarkt liegende Preise für kubanischen Zucker und weit unter dem Weltmarkt liegende Preise für sowjetisches Erdöl“ (Hoffmann 2009: 96). „Der Preis der Annäherung an die UdSSR war vor allem technischer Rückschritt“ (Zeuske 2012: 57), die Importstrukturen ersetzten weitestgehend den Aufbau einer eigenen Industrie. Auch forderte das wirtschaftliche Entgegenkommen des Moskauer Politbüros Strukturanpassungen im politischen System Kubas, sodass 1976 eine sozialistische Verfassung verabschiedet wurde, die die Kommunistische Partei als „führende Kraft in Gesellschaft und Staat“ (Hoffmann 2009: 97) etablierte. Die 1970er Jahre „legten den Grundstein dafür, dass Kuba zum ersten Sozialstaat Lateinamerikas werden konnte“ (Zeuske 2012: 59). Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion erfasste Kuba eine über Jahre dauernde Wirtschaftskrise.
Die reformatorischen Antworten der Castro-Brüder[7] auf die tiefe Krise seit Ende der 1980er und wesentlich verstärkt seit Beginn der 1990er Jahre, bestanden vor allem in dem Versuch, mit dieser selbsternannten Período Especial en Tiempos de Paz (Sonderperiode in Friedenszeiten) umzugehen. Ein Reformansatz auf die Quasikriegswirtschaft, in der fast alle Waren rationiert wurden, war die Legalisierung des US-Dollars, um mit einer harten Währung den Wertverfall des kubanischen Pesos zu stoppen. Außerdem wurde versucht, mit kleineren Wirtschaftsreformen die Binnennachfrage wieder herzustellen. Auch wenn eine teilweise Dynamisierung der Wirtschaft „auf der Grundlage von Tourismus, Nickel-Export, den Devisen aus den Überweisungen[8] der Exilkubaner“ (Optenhögel 2010: 80) aus eigener Kraft gelang, wurde spätestens hier die fehlende Kompetenz der castristischen Kampagnenpolitik deutlich. Bis zur Machtübergabe an seinen Bruder Raúl im Jahr 2006, „wurde Kuba […] mehr von einer kleinen Beratergruppe um Fidel regiert als von der Regierung und ihrer Administration“ (Optenhögel 2010: 79). Mit der Abhängigkeit von anderen Staaten gab es kaum das Interesse, die eigene wirtschaftliche Wertschöpfung voranzutreiben. Was Ende der 90er Jahre für die politische Elite auf Kuba wichtig war, kann auf die Verbindung zu Venezuela als Lebensanker reduziert werden:
„Die internationale Entwicklung kam der kubanischen Regierung dabei entschieden zur Hilfe. Im ölreichen Venezuela kollabierte das etablierte Parteiensystem, das über Jahrzehnte hinweg eine korrupte, aber ungemein stabile Zwei-Parteien-Demokratie geprägt hatte. Der Oberstleutnant Hugo Chávez […] gewann die Präsidentschaftswahlen 1998 mit breiter Mehrheit“ (Hoffmann 2009: 115 f.).
Die kubanische Politik ist sehr stark auf eine Person konzentriert. Mit der Institutionalisierung des politischen System Kubas und der Reduzierung auf ein Ein-Parteien-System, „erklärte man deren ersten Sekretär – Fidel Castro – zugleich zum Vorsitzenden des Staatsrates, d.h. Präsidenten des Landes [...]“ (Krämer/Krüger 2008: 371). Das Staatsoberhaupt war und ist eingebettet in ein schwaches Kontrollsystem aus Parlament und außerparlamentarischer Opposition. Dem Parlament – die Asamblea Nacional (Nationalversammlung) – das sich zwar durch Wahlen alle fünf Jahre neu zusammensetzt, kommt dennoch kaum Bedeutung zu, da es nur zweimal pro Jahr zusammentritt und über keine besonderen Entscheidungsbefugnisse verfügt (vgl. Krämer/Krüger 2008: 372). „Fidel Castro ist weiterhin von seiner Fähigkeit, das politische System in seinem Sinne zu führen, tief überzeugt“ (ebd.): Die meisten Bestandteile seiner politischen Agenda – und auch die seines Bruders – können auf wenige zentrale Elemente reduziert werden: den Sozialismus als Formel für eine gemeinsame Identität der kubanischen Gesellschaft[9], den Anti-Amerikanismus und die Kontrolle durch den Staat, „das prägende Merkmal der Gesellschaft“ (ebd.).
Von der spanischen Besetzung bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts war Venezuela vor allem landwirtschaftlich geprägt. Die innenpolitischen Geschehnisse waren durch Konflikte zwischen Ex-Generälen, Caudillos [10] und Großgrundbesitzern ausgetragen, ehe „Venezuela [im 20. Jahrhundert] strategische Bedeutung im kapitalistischen Weltsystem“ (López Maya 2011: 27) erhielt aufgrund seines Erdölreichtums. „Seit der Demokratisierung im Jahr 1958 sind dem Land gewaltsame Regimewechsel erspart geblieben und die damit zumeist verbundenen massiven Menschenrechtsverletzungen ebenfalls“ (Boeckh 2011: 9). Doch wie fast überall in Lateinamerika – als Ausnahme bis zu einem gewissen Grad zählt mit Sicherheit Kuba seit der Revolution – ist die soziale Ungleichheit stark ausgeprägt. Die Sozialstrukturen in Venezuela sind ein historisches Abbild der Kolonialzeit; Land und Kapital ist hier, auch während der Präsidentschaft von Chávez, überaus ungleich verteilt gewesen: Obwohl die Ergebnisse der Umfrageinstitute teilweise politisch beeinflusst wurden, zeigt sich, dass „in den vergangenen 20 Jahren […] immer etwa mindestens die Hälfte der Venezolanerinnen und Venezolaner von Armut betroffen [waren]“ (Rommel 2011: 55). Und paradoxerweise nahm die Armutsquote in den Jahren vor der Amtsübernahme von Chávez deutlich ab, wie Abbildung 1 zeigt.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
„Mit dem „schwarzen Gold“ avancierte es zu einem der reichsten Länder Amerikas, der rasante Modernisierungsprozess umfasste alle Bereiche der Gesellschaft. Ab 1958 konsolidierte sich eine präsidentielle Demokratie [...]“ (López Maya 2011: 27). Dennoch haben die Wirtschaftskrisen der 1980er und 1990er Jahre Spuren hinterlassen, die „die für Lateinamerika typischen sozialen Gegensätze“ (Rommel 2011: 51) zeigen. Bis dato wurden die Probleme von Armut und Ungleichheit aufgeschoben. Aus wirtschaftlicher Sicht handelt es sich bei Venezuela um einen Rentierstaat[11], der „unter Einrechnung des Schweröls im Orinobecken mit 360 Mrd. Fass über die größten nachgewiesenen Ölreserven der Welt“ (Boeckh 2011: 397) verfügt. Dementsprechend waren auch im Venezuela vor Chávez typische Merkmale eines Rentierstaates vorzufinden: Einerseits floss nur ein geringer Teil der Rente an die Gesellschaft, was die Sozialstrukturen widerspiegeln. Andererseits wurden die Mittel- und Oberschicht durch Unterbesteuerung entlastet. Ihnen kam demnach eine direkte Transferleistung zu (vgl. Boeckh 2011: 399). Ein weiterer Mechanismus der internen Rentenverteilung war die Überbewertung der Währung. Vom Standpunkt ausgehend, dass das Renteneinkommen keine Leistung im Sinne von Arbeit ist, dem beispielsweise Kapitalinvestitionen gegenüberstehen, wird die Rente auch als „parasitäres Einkommen“ (ebd.) bezeichnet. Daher ist es nicht überraschend, dass der schnelle Wandel vom Agrarstaat zum Erdölexporteur strukturelle Probleme hinterlassen hat, die Venezuela noch heute zwingen, Nahrungsmittel zu importieren. In der Agrarwirtschaft sind heutzutage noch elf Prozent der Bevölkerung tätig, doch aufgrund mangelnder Entwicklungspolitik auf dem Land und zaghafter Agrarreformen, war die Gewährleistung der Nahrungssicherheit in der Vergangenheit Venezuelas nicht vorhanden (vgl. Schneider 2004).
In Venezuela ist die Bedeutung von Parlament und Staatsoberhaupt ähnlich gewichtet wie in Kuba. Das Parlament ist schwach und stellt nicht das institutionelle Gegengewicht zur Exekutive dar (vgl. Kestler 2008: 588). Der Präsident hat als Chef der Exekutive vor allem ausführende Gewalt, indem er Minister ernennt und entlässt. Seine legislative Bedeutung ist bisher beschränkt gewesen, wobei sich seit der Präsidentschaft von Chávez und dem Inkrafttreten einer neuen Verfassung 1999 das funktionierende System von checks and balances aufgelöst hat und dem Parlament mit der Reduzierung auf ein Ein-Kammer-System die gesetzgeberische Verantwortung de facto entzogen wurde (vgl. Kestler 2008: 587 f.). Auch wenn es ihr nicht gelungen ist, strebte die bolivarianische Bewegung nach der Beseitigung des venezolanischen Parteiensystems. Die Verfassung von 1999 macht deutlich, dass den Parteien keine privilegierte Stellung mehr zukommt und nennt sie formal „Gruppierungen mit politischen Zielen“ (Kestler 2008: 592). Auch spricht für die Demontage der Parteiendemokratie die Tatsache, dass mit der neuen Verfassung die Parteienfinanzierung verboten wurde.[12]
Ganz allgemein war das Verhältnis Venezuelas zu den USA seit den 1950er Jahren weitestgehend sehr stabil im Vergleich zu anderen Staaten Lateinamerikas (vgl. Kelly/Romero 2002: 2): Die strategische Bedeutung als vertrauter Partner der USA und Erdöllieferant machte das südamerikanische Land zu einer der wichtigsten Rohstoffquellen für den nordamerikanischen Nachbarn. Aus dieser engen und freundschaftlichen Kooperation kann auch die venezolanische Außenpolitik vor der Ära Chávez verstanden werden: Mit dem Aufstieg zu einem der größten Erdölexporteure und Gründungsmitglied der OPEC 1960 ist Venezuela auch in eine größere außenpolitische Rolle hineingewachsen (vgl. Werz 2011: 368). Durch die Ölkrise 1973 stieg nochmals die außenpolitische Bedeutung des Landes, bevor durch einen fallenden Ölpreis die Relevanz Venezuelas in der Internationalen Politik wieder sank.
[...]
[1] Die Möglichkeit zur Gestaltung zentraler Aufgaben im Staat unterteilt Schimmelfennig in ein Kontinuum: Autarkie, in der Staaten keinen Nutzen von internationaler Kooperation haben, Autonomie, in der Staaten auf solch eine Kooperation nicht angewiesen sind, jedoch von ihr profitieren würden, und Dependenz. Bei dieser Form sind Staaten auf Kooperation angewiesen (vgl. Schimmelfennig 2013: 93).
[2] Kooperation ist hier nicht als Ziel von Staaten zu verstehen, sondern als Mittel zum Zweck.
[3] Das Buch ist 1999 zum ersten Mal erschienen.
[4] Wendt nennt an dieser Stelle Hugo Grotius, Georg W. F. Hegel und Immanuel Kant; in der Nachkriegszeit haben vor allem Karl Deutsch, Ernst Haas und Hedley Bull der Theorie zu einer Annäherung an die internationale Politik beigetragen.
[5] Es gibt nicht „den“ Konstruktivismus, sondern mehrere verschiedene Ansätze und Prämissen (siehe auch Weller 2005). Alexander Wendt hat in seinem Beitrag vornehmlich Staaten als die zentralen Akteure beziehungsweise Konstrukteure festgelegt.
[6] In Abgrenzung zu privatem Wissen nennt Wendt sozial geteiltes Wissen Kultur (vgl. Wendt 2000: 141 f.).
[7] Fidel Castro wurde erst 1976 formal zum Präsidenten gewählt. Seinen Bruder Raúl setzte Fidel als Wirtschaftsreformer ab Anfang der 1990er Jahre ein.
[8] Überweisungen aus dem Ausland – im Spanischen remesas genannt - machen einen erheblichen Teil des durchschnittlichen kubanischen Pro-Kopf-Einkommens aus, da die meisten kubanischen Familien Verwandte im Ausland haben, vor allem in den USA.
[9] Spiegelt sich in socialismo o muerte (Sozialismus oder Tod) wider, ein Ausspruch, mit dem Fidel Castro seit Ende der 1980er Jahre seine Reden schließt.
[10] Caudillos (dt. Anführer) sind in der Militärkaste der postkolonialen Phase Venezuelas einzuordnen, die nach dem Unabhängigkeitskampf versuchten, den Staat zu kontrollieren (siehe auch López Maya 2011: 33).
[11] Für eine ausführliche Darstellung zu Venezuela als Rentierstaat, siehe auch Boeckh 2011, S. 397-426.
[12] Artikel 67 nennt explizit das Verbot der Parteienfinanzierung: „No se permitirá el financiamiento de las asociaciones con fines políticos con fondos provenientes del Estado“ (Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 1999).
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Erstausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2013
- ISBN (Paperback)
- 9783956842276
- ISBN (PDF)
- 9783956847271
- Dateigröße
- 1.5 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Johannes Gutenberg-Universität Mainz
- Erscheinungsdatum
- 2015 (Februar)
- Note
- 1
- Schlagworte
- Internationale Beziehungen (IB) Lateinamerika Sozialismus des 21. Jahrhundert Interdependenztheorie Konstruktivismus
- Produktsicherheit
- BACHELOR + MASTER Publishing