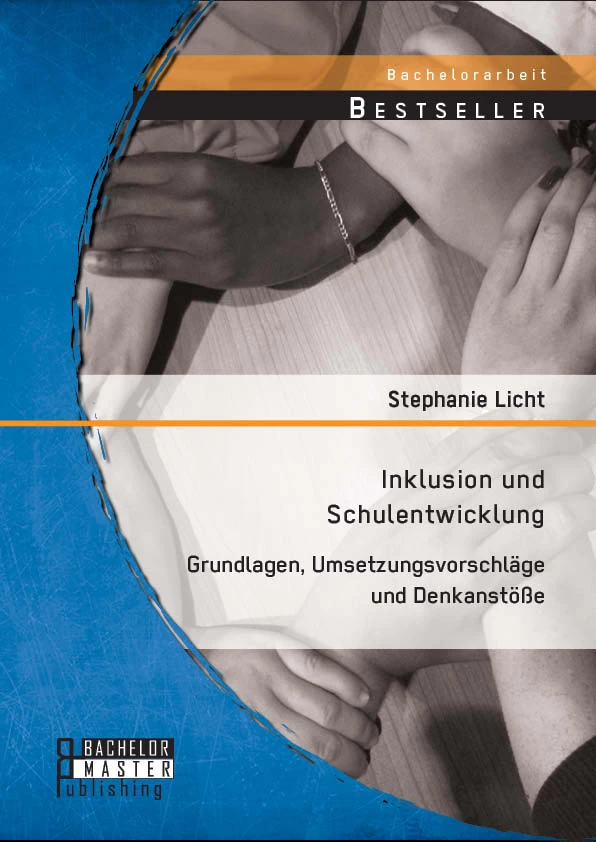Inklusion und Schulentwicklung: Grundlagen, Umsetzungsvorschläge und Denkanstöße
Zusammenfassung
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1 Begriffliche Erläuterungen
1.1 Bildung, Bildungsgerechtigkeit und –benachteiligung
Unter der Rubrik ‚Bildung‘ auf den Internetseiten des Thüringer Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur steht geschrieben: „Das Thüringer Schulsystem bietet mit seiner Vielfalt für jeden Schüler die richtige Schule“ (TMBWKa). Sollte aber nicht die (allgemeine) Schule so vielfältig sein, dass sie jedem Schüler das Richtige bieten kann? Zunächst soll jedoch geklärt werden, was die Begriffe ‚Bildung‘, ‚Bildungsgerechtigkeit‘ und ‚Bildungsungerechtigkeit‘ umfassen.
Der Thüringer Bildungsplan für Kinder bis zehn Jahre versteht unter Bildung einen Prozess, der mit der Geburt beginnt und ein ganzes Leben andauert (vgl. TMBWKc, 14). So heißt es hier weiter:
Bildung bezeichnet den Prozess und das Ziel des Bildungsprozesses: die Entwicklung einer selbstverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, die sich in personaler, sozialer und sachlicher Hinsicht in der Welt vorfindet und mit dieser auseinandersetzt (vgl. ebd., 17).
Bildung ist zunächst jedoch auf Erziehung angewiesen, denn nur durch Erziehung kann es einem Menschen gelingen „Wissen über die und Orientierung innerhalb der Kultur, [in die er hineingeboren wird] zu erwerben“. Jedoch kann Bildung als das umfassendere Phänomen angesehen werden, welches „das bewusste und begründete Entscheiden in der jeweiligen Gesellschaft, der jeweiligen Kultur [darstellt und überhaupt ermöglicht]“ (ebd., 14) und somit die Eigentätigkeit des Kindes in den Vordergrund stellt. Bildung als die tätige Auseinandersetzung mit der Umwelt stellt außerdem einen offenen und unabschließbaren Prozess dar. Offen, weil jedes Kind die Auseinandersetzung mit der Umwelt auf seine eigene Weise begeht, und unabschließbar, weil der Mensch ein Leben lang immer wieder neue Auseinandersetzungen mit der Welt ausfechten muss, der Prozess also keinen definiten Endpunkt besitzt. Bildung umfasst also sowohl den aktiven Erwerb von Wissen, die Fähigkeit dieses Wissen mit bereits vorhandenem Wissen zu verknüpfen sowie es in verschiedenen Handlungskontexten anzuwenden, als auch kulturelle und lebenspraktische Fähigkeiten, soziale und personale Kompetenzen. Dazu zählen beispielsweise auch Verantwortungsbewusstsein, Selbstvertrauen, ein Wertebewusstsein, Haltungen (Einstellungen) und die Handlungsfähigkeit im jeweiligen Kontext. Bildung kann sowohl schulisch (im Unterricht), als auch außerschulisch (in Museen, bei Angeboten der offenen Kinder- und Jugendarbeit, etc.) stattfinden und zieht sich somit durch alle Lebensbereiche. (vgl. ebd., 14ff)
Grundsätzlich hat seit der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der UN von 1948 „jeder […] das Recht auf Bildung“ (UN 1948, Art. 26) und im UN-Sozialpakt von 1966, den Deutschland 1973 ratifizierte (vgl. Beck; Degenhardt 2010, 58), ist in Artikel 13 festgehalten, „‘dass die Bildung auf die volle Entfaltung der menschlichen Persönlichkeit und des Bewusstseins ihrer Würde gerichtet sein muss‘“ und weiter, dass jedem Menschen ermöglicht sein muss, „‘eine nützliche Rolle in einer freien Gesellschaft zu spielen‘“ (ebd.). Der Sonderberichterstatter für das Recht auf Bildung, Herr Vernor Muñoz, hat Deutschland im Jahr 2006 einen Besuch abgestattet, um zu prüfen, wie hier das Recht auf Bildung umgesetzt wird, inwieweit Bildung gerecht für alle zugänglich ist und welche Hindernisse und Mängel noch bestehen. Vor allem bemängelt er einerseits das uneinheitliche Bildungssystem Deutschlands, das dadurch zustande kommt, dass Bildungsangelegenheiten auf Länder- und nicht Bundesebene beschlossen werden und andererseits das mehrgliedrige Schulsystem, was seiner Ansicht nach einen klaren Zusammenhang zwischen sozialem oder Migrationshintergrund der Schüler und deren Bildungsergebnissen offenlegt. Muñoz kritisiert diese Selektion und damit verbundene Diskriminierung scharf und rät, das System in dieser Weise abzuschaffen und stattdessen ein Schulsystem aufzubauen, „das den spezifischen Lernbedürfnissen jedes einzelnen Schülers besser entgegenkommt“ (UN 2007, 2). Er stellte weiter fest, dass sich die Einordnungssysteme zu den einzelnen Schulformen insbesondere negativ auf Kinder mit Migrationshintergrund, Kinder aus benachteiligten sozialen Milieus sowie Kinder mit Behinderungen auswirken. Somit ist ein gerechter Zugang zu Bildung, also Bildungsgerechtigkeit, für ihn nicht gegeben und er mahnt daher an, dass gleiche und gerechte Bildungsmöglichkeiten für jedes Kind gewährleistet werden müssen, besonders „für diejenigen, die dem marginalisierten Bereich der Bevölkerung angehören“ (ebd.), um die vorliegenden Bildungsbenachteiligungen aufheben zu können. Für Muñoz bedeuten Ungleichheiten im Bildungsbereich auch immer soziale Ungleichheiten. (vgl. ebd., 2ff)
1.2 Heterogenität
Heterogenität, vom griechischen ‚heterogenis‘ – verschiedenartig, anders – abgeleitet, meint die Verschiedenartigkeit in der Zusammensetzung von Mengen oder Gruppen (vgl. Wortbedeutung.info). Im pädagogischen Kontext bezeichnet Heterogenität die Unterschiedlichkeit der Schüler innerhalb einer Lerngruppe, wobei sich die Diversität in verschiedenen Merkmalen zeigen kann. So können sich Schüler beispielsweise in „Alter, Geschlecht, Interessen, Erwartungen, Motivation, ethnische[r], kulturelle[r] und soziale[r] Herkunft, soziale[r] Kompetenz und psychische[r] Entwicklung, sowie in Bezug auf ihre kognitive, emotionale und physische Leistungsfähigkeit“ (Netzwerk Heterogenität) unterscheiden. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) gibt die Bedeutung von Heterogenität im Klassenzimmer mit „Alle sind verschieden – Alle sind gleich“ an. Gemeint ist hier, dass sich die Schüler zwar in den oben bereits genannten Merkmalen unterscheiden können, sie sich aber auch gleichen in ihrem „gleichen Anspruch auf optimale Entwicklung und Unterstützung.“ Damit ist nicht nur „das Erkennen und Herausfordern aller Potenziale“ gemeint, sondern auch der „Ausgleich, das Abmildern und die Förderung bei Schwächen“ (ebd.).
Karl Dieter Schuck spricht davon, dass als Voraussetzung für Heterogenität im Unterricht eine „innere Differenzierung“ des Unterrichtsstoffes sowie der Unterrichtsmethoden stattfinden muss, die sich schon aus der „Unterschiedlichkeit der Schüler und der Erwartung, die Lernziele einer Klassenstufe oder einer Schulform mit allen Schülerinnen und Schülern zu erreichen“ (Schuck i.E., 9), ergibt. Die innere Differenzierung steht der organisatorischen „äußeren Diefferenzierung“ (ebd.) nach bestimmten Schulformen gegenüber. Das deutsche Schulsystem ist mit seiner viel zu frühen Selektierung und äußeren Differenzierung eher auf homogene Lerngruppen eingestellt, deren Leistungsvorteile in allen neueren Untersuchungen nicht mehr bestätigt werden konnten (vgl. ebd., 3ff).
Heterogenität im Unterricht, als Leitgedanke der Inklusion, erfordert einen professionellen Umgang der Lehrkräfte und aller anderen Beteiligten mit der Verschiedenheit der Schüler, der „allergrößte Bedeutung für den schulischen Erfolg der […] Schüler, für die Berufszufriedenheit der Lehrkräfte, aber auch für Qualität und Chancengleichheit des Schulsystems insgesamt“ (Netzwerk Heterogenität) hat.
1.3 Inklusion
Obwohl es unzählige Definitionen von Inklusion gibt, scheinen sich die verschiedensten Autoren jedoch in einem Punkt einig zu sein: Immer wieder wird die Heterogenität der Klassen, Schulen, ja der Gesellschaft in den Mittelpunkt gestellt. Dabei wird darauf bestanden, dass „Behinderung […] nur ein Aspekt der Heterogenität der Schüler/innen neben geschlechtlicher, ethnischer, kultureller, religiöser und sozialer Verschiedenheit [ist]“ (Biewer 2009, 126). Weiterhin stellt wohl gerade die Verschiedenheit der Schüler den Ausgangspunkt des Schulkonzeptes der inklusiven Schule dar und wird sogar als positiv, als Vorteil für alle angesehen.
Inklusion, vom englischen ‚inclusion‘, also ‚Einbeziehung‘, abgeleitet, verlangt vom Schulsystem, dass es sich grundlegend ändert, um dieser Verschiedenheit gerecht zu werden (vgl. ebd.). In den Vordergrund rücken hier also eindeutig Bestrebungen hin zu einer ‚Theorie der Vielfalt‘ und weg von der ‚Zwei-Gruppen-Theorie‘ (vgl. Schmidt; Dworschak 2011). So sollen nicht mehr nur die beiden Kategorien behindert und nichtbehindert existent sein, sondern jedes Kind soll mit all seinen individuellen Bedürfnissen, Fähigkeiten und Besonderheiten zur Vielfalt der Gruppe beitragen, welche dann im Resultat aus verschiedenen Mehr- und Minderheiten besteht. Diese Überlegungen beziehen sich natürlich nicht nur auf den Aspekt der Behinderung / Nichtbehinderung, sondern können ebenso auf andere, oben bereits erwähnte, Aspekte der Heterogenität angewendet werden.
Nun gibt es auf der einen Seite „Inklusionsfürsprecher, die für behinderte Kinder und Jugendliche in Regelklassen spezielle pädagogisch-therapeutische Programme (…) außerhalb des gemeinsamen Unterrichts als Option offen halten“ (Theunissen 2009, 220). Diese Möglichkeiten wären besonders für Kinder mit spezifischen Lernbedürfnissen oder schweren Verhaltensauffälligkeiten von Bedeutung. Theunissen verweist hier auf den besonderen Stellenwert des Modells ‚resource room with special education teacher‘, also beispielsweise Einzelunterricht außerhalb der Klasse (vgl. ebd.).
Auf der anderen Seite findet man das ‚Inclusive Schools Movement‘, das die Überzeugung einer totalen Inklusion (‚full inclusion‘) vertritt und sich vielmehr für eine „uneingeschränkte Aufnahme aller behinderten Schüler in Regelklassen einsetzt. […] Durch ‚itinerant services‘ (z.B. ‚mobile Stützlehrer‘), ‚collaborative teaching model‘ (Zwei-Pädagogen-System), ‚peer-tutoring‘, ‚special friends programs‘, ‚peer support networks‘ (unterrichtliche Hilfen und Unterstützung durch nichtbehinderte Mitschüler oder freiwillige Vertrauenspartner) sowie Formen eines ‚kooperativen Lernens‘ [möchten die Vertreter dieser Richtung] auf spezielle Hilfen außerhalb des allgemeinen Unterrichts verzichten“ (ebd.). Für sie bedeutet jede therapeutische oder sonderpädagogische Zuwendung außerhalb des Unterrichts wieder eine Einteilung in die zwei Kategorien behindert und nichtbehindert. Also diejenigen, die noch extra Zuwendung benötigen und diejenigen, die eben auch ohne diese gut zurechtkommen. Vielmehr fordern die Vertreter, dass im gemeinsamen Unterricht alle Kinder von der extra Zuwendung profitieren, wie die oben genannten Beispiele deutlich machen, und so dann gar nicht mehr offensichtlich ist, für wen speziell oder ausschließlich sie vorgesehen war.
Wirft man einen Blick in die oft zitierte und für den Umbruch im pädagogischen Denken und Handeln ausschlaggebende Salamanca-Erklärung von 1994, findet man die wohl beste Definition von inklusiver Bildung. Diese Tatsache hängt damit zusammen, dass erst die Salamanca-Erklärung sowohl zur weltweiten Verbreitung des Begriffes Inclusion geführt hat als auch zur Normierung des Begriffes beigetragen hat, denn es gab (und gibt) viele verschiedene inhaltliche Vorstellungen zu diesem Thema.
„The Inclusive School
The fundamental principal of the inclusive school is that all children should learn together, wherever possible, regardless of any difficulties or differences they may have. Inclusive schools must recognize and respond to the diverse needs of their students, accommodating both different styles and rates of learning and ensuring quality education to all through appropriate curricula, organizational arrangements, teaching strategies, resource use and partnerships with their communities. There should be a continuum of support and services to match the continuum of special needs encountered in every school.” (Salamanca Framework for Action, 1994, Paragraph 7)
In der deutschsprachigen Fassung von 1996, übersetzt von der österreichischen UNESCO-Kommission, wurde fälschlicherweise ‚inclusion‘ mit ‚Integration‘ übertragen, was dem Konzept und der Erklärung natürlich eine andere Bedeutung beimisst. Mögliche inhaltliche Veränderungen oder Bedeutungsverschiedenheiten wurden hier nicht in Betracht gezogen und scheinbar „bestand zum damaligen Zeitpunkt noch kein Bewusstsein darüber, dass diese Übersetzung möglicherweise den Sachverhalt nicht genau trifft“ (Biewer 2009, 125). Erst mehrere Jahre später kam es zu inhaltlichen Aufarbeitungen, in denen dann ‚inclusion‘ von Beginn an mit ‚Inklusion‘ übertragen wurde (vgl. ebd.).
Als Erweiterung der Salamanca-Erklärung, die vorrangig über Kinder mit ‚special needs‘ spricht, können die ‚Guidelines für Inclusion‘ der UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) von 2005 betrachtet werden. Die Autoren gehen davon aus, dass Kinder mit Behinderungen nur eine von vielen Gruppen darstellen, die von Ausgrenzung und Randständigkeit bedroht sind, neben sprachlichen, religiösen oder ethnischen Minderheiten, Kindern, die in Armut leben oder Kindern mit Migrationshintergrund (vgl. UNESCO 2005, 11). Insofern heißt eine inklusive Schule jedes Kind willkommen und sorgt dafür, dass alle Kinder vom Unterricht und dem Zusammensein in der Schule profitieren, nicht nur die zuvor exkludierten Kinder.
Das Enabling Education Network beantwortet die Frage, was inklusive Bildung und Erziehung sei, so: „[Inclusive education is] about changing the education system so that it is flexible enough to accommodate any learner [and not] about trying to change the learner so that he/she can fit more conveniently into an unchanged system” (EEN) (Abb. 1)
Abbildung 1: What is Inclusive Education? (vgl. EEN 2012)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Inclusion is about changing the education system to make it flexible enough for all learners.
Diese Aussage spiegelt eindeutig die Sicht wieder, die inklusive Bildung und Erziehung auf das Kind hat. Der inklusiven Praxis liegt ein systemischer Ansatz zugrunde, der Barrieren, Hindernisse und Schwierigkeiten im System (Schule) zu ergründen und zu beseitigen sucht und nicht länger die individuumzentrierte Problemsuche beim Kind selbst.
Wie sich der Begriff der Inklusion entwickelt hat und welche ‚Stationen‘ in der Geschichte zu diesem ‚neuen‘ Begriff und Verständnis geführt haben, wird im nächsten Kapitel thematisiert.
2 Geschichtlicher Rückblick
2.1 Allgemeine Pädagogik und Sonderpädagogik
Seit der Entstehung der Sonderpädagogik haben sich die Allgemeine und die Sonderpädagogik zunächst als scharf voneinander getrennt entwickelt, in verschiedene Richtungen voneinander entfernt und abgegrenzt. Erst im Laufe der Zeit haben die beiden Fachrichtungen wieder zueinander gefunden. Zur Darstellung des zurückgelegten Weges bietet sich eine „fünfstufige Einteilung der Entwicklung des Bildungswesens“ (Scholz 2007) an, wonach die Entwicklung von Exklusion zu Segregation / Separation über Integration und Inklusion hin zu Vielfalt als Normalfall (vgl. ebd.) führt. Diese Entwicklung soll hier im Folgenden dargestellt werden.
Bevor sich die Sonderpädagogik als Teildisziplin der Allgemeinen Pädagogik entwickeln konnte, war es Kindern mit Behinderungen (fast) nicht möglich, an einer Schulbildung teilzuhaben. Die Bildungsfähigkeit von Menschen mit Behinderungen sowie ihr Recht auf Bildung wurden genauso wenig anerkannt, wie ihr Nutzen für die Gesellschaft. Dieser Abschnitt in der Entwicklung des Bildungswesens kann als Exklusion bezeichnet werden und meint den „kategorischen Ausschluss“ (ebd.) aus dem Bildungssystem. Die Geschichte der Sonderpädagogik begann ungefähr Ende des 18. Jahrhunderts mit der Gründung der ersten Anstalten für zunächst ‚Taubstumme‘ und Blinde in Frankreich und wenig später auch in Deutschland, welche den Beginn des Sonderschulwesens in Europa darstellen. Die Bildungsfähigkeit ‚schwachsinniger Kinder‘, wie sie zu dieser Zeit noch bezeichnet wurden, war damit nachgewiesen und weitere Einrichtungen, vorrangig von kirchlichen Trägern oder privaten Personen, wurden eröffnet. Die Schüler wurden anhand von bestimmten Kriterien, beispielsweise Lernleistung oder körperlichen und geistigen Voraussetzungen, harmonisierenden Gruppen zugeteilt, woraus sich in dieser Phase der Segregation / Separation die verschiedenen sonderpädagogischen Fachrichtungen entwickelt haben. „Hintergrund [für diese scharfe Trennung] ist die Einstellung oder der Glaube, dass Schüler in möglichst harmonischen Gruppen die optimalen Lernvoraussetzungen haben“ (ebd.). Die sich anschließende Phase der Integration umschreibt die Möglichkeit, die Kinder mit Behinderungen nun hatten, mit angemessener Unterstützung am Unterricht und Schulalltag an einer allgemeinen Schule teilzunehmen, jedoch blieben die anderen, segregierenden Gruppen noch bestehen, was bedeutete, dass eine Integration nicht für alle Kinder möglich war, sondern nur einen geringen, bestimmte Anforderungen erfüllenden Teil der Schüler betrifft. Der Blick auf diese Schüler war noch immer defizit- und individuumzentriert, was sich in der anschließenden Phase der Inklusion grundlegend ändert. Hier geht man nun, wie bereits beschrieben, davon aus, dass jedes Kind von vornherein ein Recht darauf hat, eine allgemeine Schule zu besuchen und von einer bestmöglichen Schulbildung zu profitieren. Die Leitidee dieser Phase – „Heterogenität als Normalität“ (ebd.) – spiegelt dieses Menschenbild auch wieder. Die letzte Phase in dieser fünfstufigen Entwicklung stellt mehr oder weniger noch eine Vision dar, in der Inklusion zu einer Selbstverständlichkeit und somit Vielfalt zum (als) Normalfall geworden ist (vgl. ebd.). Obwohl der Abschnitt der Integration in dieser Geschichtsdarstellung in der Vergangenheitsform beschrieben ist, ist dies bedauerlicherweise wohl am ehesten die Stufe auf der sich Deutschland im Moment noch befindet. Ohne Zweifel ist aber eine Weiterentwicklung zur nächsten Stufe bitter nötig und längst überfällig.
Die Stufen Integration und Inklusion sollen in ihrer Entwicklung im Folgenden Abschnitt noch einmal genauer betrachtet werden.
2.2 Integration und Inklusion vor und nach der Salamanca-Erklärung
Bewusst soll hier nur der Weg dargestellt werden, der beschritten wurde, um Menschen mit Behinderungen ein möglichst chancengleiches Leben zu ermöglichen, auch wenn sich ähnliche Veränderungen für andere bisher benachteiligte Minderheiten ebenso ergeben haben. Diese jedoch alle darzustellen, würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen.
Den Grundstein für inklusives Denken hat wohl die Declaration on the Rights of Disabled Persons der Vereinten Nationen von 1975 gelegt. Diese Erklärung war die erste überhaupt, die die Rechte und Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen anerkennt und einfordert (vgl. Peters 2007, 120). So sollte es Menschen mit Behinderungen ermöglicht werden, sich in ein ‚normales‘ Leben zu integrieren. 1982 treten die Entwickler des World Programme of Action für spezifische Rechte behinderter Menschen ein, so zum Beispiel das Recht auf Chancengleichheit und Gleichbehandlung. Sie fordern weiter, dass es, wo immer es einzurichten geht, jedem Kind ermöglicht werden sollte, an einer regulären Schulbildung teilzuhaben sowie dass der Blick auf die Fähigkeiten gerichtet werden müsse und nicht auf die Defizite. The Convention on the Rights of the Child, die die Vereinten Nationen 1989 abhielten, unterstützt die vorangetroffenen Aussagen und erklärt weiterhin, dass jedem Kind Zugang und Integration zugesichert werden müsse, fügt allerdings den Vorbehalt hinzu, die Ressourcen hierfür müssten stimmen und die Umsetzung angemessen sein. Die UN Standard Rules von 1993 fordern eine Entwicklung hin zu einem sozialen System inklusiver Bildung ohne Vorbehalte. Jedoch auch hier fehlen Überlegungen zur qualitativen Umsetzung, wieder werden nur die Chancengleichheit und die Möglichkeit des Zugangs erwähnt (vgl. ebd).
Eindeutig beginnt ein neuer Abschnitt mit der Unterzeichnung der Salamanca Erklärung im Jahre 1994, in welcher 92 Nationen und 25 internationale Organisationen nicht nur darin übereinstimmen, dass jedem Kind der Zugang zur regulären Schule gewährt werden müsse, sondern auch darin, dass jedem Kind eine bestmögliche, qualitativ hochwertige Bildung zustehe (vgl. Biewer 2009, 128; Peters 2007, 120). Die 75 Paragraphen der Erklärung beschreiben sowohl allgemein die Kinder, die es betrifft, als auch die inklusive Schule, die entstehen muss. So kann diese Erklärung als erstes Dokument angesehen werden, dass auch konkrete Anweisungen oder Anregungen zur Umsetzung gibt. Jedoch ergibt sich die erste Schwierigkeit zur Umsetzung schon daraus, dass beispielsweise bei der Übersetzung ins Deutsche ‚inclusion‘ mit ‚Integration‘ übersetzt wurde. Wie dem auch sei, viele Konzepte für inklusive Schulen wurden seit dem entwickelt oder angedacht, in manchen Ländern sofort, in anderen wiederum eher schleppend, wozu sicher auch Deutschland zählt. Wenn man bedenkt, dass diese Erklärung mit all ihren Umsetzungsvorschlägen und –anweisungen nunmehr vor 17 Jahren unterzeichnet wurde und dann in Betracht zieht, in wie weit sich das deutsche Bildungssystem verändert bzw. weiterentwickelt hat, muss man leider eine traurige Bilanz ziehen.
Die UN-Behindertenrechtskonvention von 2006, die seit dem 26. März 2009 für Deutschland verbindlich ist (vgl. Staatenbericht zur UN-Konvention 2011, 4), fordert in Artikel 24 von den Vertragsstaaten, das „Recht von Menschen mit Behinderung auf Bildung [anzuerkennen] sowie dieses durch die Gewährleistung eines „Inclusive Education System“ auf allen Ebenen „ohne Diskriminierung und auf der Grundlage der Chancengleichheit zu verwirklichen“ (UN-BRK 2006, 36). In der deutschen Übersetzung der Konvention ist, ebenso wie bei der Salamanca-Erklärung, fälschlicherweise ‚inclusive‘ mit ‚integrativ‘ übersetzt worden, was natürlich zu grundlegenden Bedeutungsunterschieden führt.
Diese Bedeutungs- und konzeptuellen Unterschiede sollen Gegenstand des nächsten Abschnittes sein.
2.3 Unterschiede zu Integration und GU-Konzept
Die Existenz beider Begriffe – Integration und Inklusion – sollte doch schon implizieren, dass es sich hierbei auch um zwei verschiedene Konzepte handelt. Jedoch kann ganz und gar nicht von einem „begrifflich oder konzeptionell einheitliche[n] Gepräge“ (Theunissen 2009, 220) gesprochen werden. Im Gegenteil, „so werden in der angloamerikanischen Fachliteratur mitunter die Begriffe der Integration und Inklusion synonym benutzt“ (ebd.), was natürlich zu Irritationen und Missverständnissen führen kann. Weiterhin verwirrend ist die zunehmende Verwendung des Begriffes der Inklusion in aktuelleren Veröffentlichungen, wobei die konzeptionellen Unterschiede zur Integration nicht immer transparent sind und sich durchaus von anderen Ausführungen zum Thema unterscheiden können. Zunächst lässt sich jedoch eines festhalten:
Inklusion ist umfassender als das, was man früher mit Integration zu erreichen meinte. Sie ist ein gesellschaftlicher Anspruch, der besagt, dass die Gesellschaft ihrerseits Leistungen erbringen muss, die geeignet sind, Diskriminierungen von Menschen jeder Art und auf allen Ebenen abzubauen, um eine möglichst chancengerechte Entwicklung aller Menschen zu ermöglichen. (Reich 2012, 39)
Für eine genauere Unterscheidung der beiden Konzepte, erweist sich die Gegenüberstellung von Andreas Hinz (2002) (In: Biewer 2009, 127) als besonders aussagekräftig. Insgesamt nennt er 15 Punkte (Tabelle 1), in denen sich die Praxis der Integration von der Praxis der Inklusion unterscheidet. Einige dieser Punkte sollen hier auswertend gegenübergestellt werden.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tabelle 1: Unterschiede von Inklusion und Integration (Hinz 2002, In: Biewer 2009, 127)
Betrachtet man die verschiedenen Kriterien (Tabelle 1), so stellt man fest, dass es hauptsächlich eine Frage der Einstellung, der Betrachtung oder auch der Überzeugung ist. Integrative Praxis geht davon aus, dass das Kind selbst das Problem darstellt und versucht, das Kind so an das Umfeld, in diesem speziellen Fall die Schule, anzupassen, bis es dort funktionieren kann. Im Gegensatz dazu, auf dem systemischen Ansatz begründet, fordert die inklusive Praxis, dass sich das System Schule so verändern muss, dass es den Bedürfnissen jedes Kindes gerecht werden kann, unabhängig von Behinderung, Herkunft oder Religion. So steht auf der einen Seite eben, dass es sich um eine Eingliederung von Kindern mit bestimmten Bedürfnissen in die allgemeine Schule handelt (Integration), wohingegen die zweite Seite von vornherein davon ausgeht, dass alle Kinder in der allgemeinen Schule gemeinsam Leben und Lernen, ohne dass dies erst einer besonderen Eingliederung bedarf (Inklusion). Weiterhin stehen sich individuelle Curricula für Einzelne und ein individualisiertes Curriculum für alle gegenüber. Ressourcen sollen für das gesamte System Schule entdeckt, bereitgestellt und genutzt werden und nicht nur einzelnen Schülern zugeteilt werden. Einer speziellen Förderung für behinderte Kinder auf der Seite der Integration begegnen Vertreter der Inklusion mit der Forderung nach gemeinsamem und individuellem Lernen für alle. So wird in Integrationsklassen der Sonderpädagoge zur Unterstützung von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf eingesetzt, wohingegen er in Inklusionsklassen zur Unterstützung des Klassenlehrers, der gesamten Klasse und Schule dient.
Der Gemeinsame Unterricht (GU) grenzt sich ebenso von einer inklusiven Schulpraxis ab. Laut dem Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur „sollen [durch die Einführung von Gemeinsamem Unterricht] integrative Formen von Unterricht und Erziehung in allen Schulformen angestrebt werden. […] Im Gemeinsamen Unterricht lernen Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf zusammen mit Schülern der allgemeinen Schulen“ (TMBWKb), mit dem Ziel, die Lernziele des jeweiligen Bildungsganges zu erreichen. Grundsätzlich gibt es gemeinsamen Unterricht lernzielgleich oder lernzieldifferent: Beim lernzielgleichen Unterricht sollen alle Schüler einer Klasse das gleiche Lernziel erreichen, wobei, wenn nötig, Schüler mit Behinderungen bei Prüfungen oder anderen Leistungsfeststellungen einen Anspruch auf Nachteilsausgleich erhalten. Im zieldifferenten gemeinsamen Unterricht werden die Lernziele für jeden Schüler individuell festgelegt und der Unterrichtsstoff dementsprechend differenziert. Die Realisierung soll durch den Einsatz eines Mobilen Sonderpädagogischen Dienstes gewährleistet werden, der stundenweise, zum Teil mehrere Schulen und Klassen bedienend, Schüler mit einem sonderpädagogischen Förderbedarf unterstützt (vgl. ebd.). In dieser Aussage spiegelt sich der größte Unterschied zur Inklusion wider, denn, wie bei der Integration, auch beim gemeinsamen Unterricht geht es um einzelne ‚förderbedürftige‘ Schüler, die unterstützt werden ‚müssen‘. Inklusive Praxis würde hier, wie oben auch schon im Vergleich mit Integration beschrieben, antworten, dass Sonderpädagogen nicht zur Unterstützung einzelner Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf, sondern „als Unterstützung für Klassenlehrer, Klassen und Schulpädagogik“ (Hinz 2002, Tabelle 1) dienen sollen.
Nach diesen Ausführungen bleibt zu sagen, wie wichtig es sicherlich ist, zu begreifen, dass sich nicht die Schüler sondern das System Schule und nicht zuletzt die Einstellungen der Lehrer – ja, der Gesellschaft – gegenüber dieser inklusiven Praxis ändern müssen, um jedem Kind mit all seinen Bedürfnissen gerecht werden zu können. Welche Veränderungen hier im Speziellen gemeint sind, wird Schwerpunkt des nächsten Kapitels sein.
[...]
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Erstausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2012
- ISBN (Paperback)
- 9783958200326
- ISBN (PDF)
- 9783958205321
- Dateigröße
- 4.4 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Universität Erfurt
- Erscheinungsdatum
- 2015 (Februar)
- Note
- 1
- Schlagworte
- Index of Inclusion Bildungsgerechtigkeit Bildungsungerechtigkeit Lehrerrolle schulische Entwicklung
- Produktsicherheit
- BACHELOR + MASTER Publishing