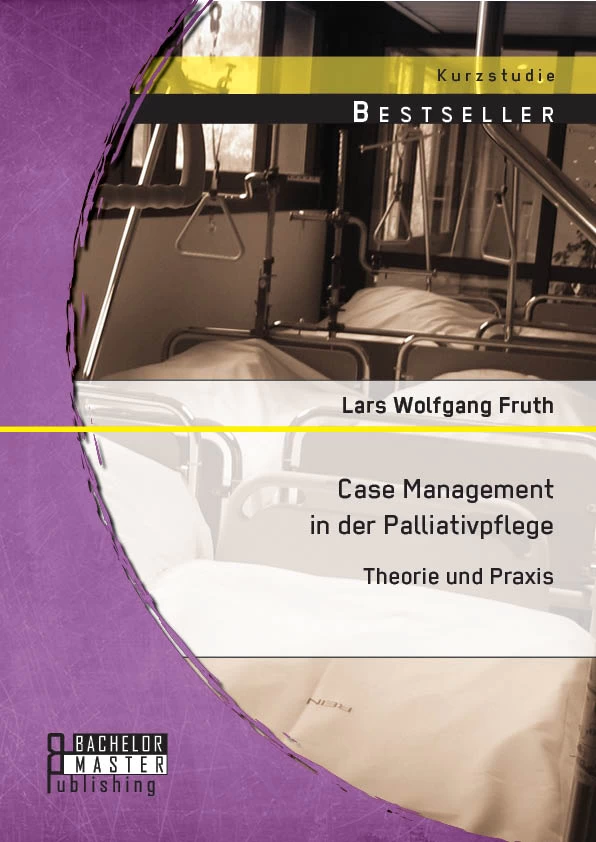Case Management in der Palliativpflege: Theorie und Praxis
Zusammenfassung
Dieses Buch zeigt die Schnittstellenproblematik auf, die im Rahmen einer palliativen Versorgung zwischen dem stationären und ambulanten Setting besteht und entwirft Lösungsmöglichkeiten durch gezielte Case Management-Prozesse.
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
2. Fallbeispiel
Der im Folgenden beschriebene Fall zeigt auf, wie umfassend sich die Problemstellungen in der Versorgung onkologisch Erkrankter darstellen können. Eine progrediente Krankheitsentwicklung, wie sie häufig auftritt, verstärkt den Bedarf an medizinischer, pflegerischer und psychosozialer Begleitung, und mehrt das Bedürfnis nach immateriellen Hilfestellungen im Kontext der palliativen Versorgung.
2.1 Fallbeschreibung Herr H.
Übersicht (2008-2010) Herr H. ist zum Jahresende 2010 im Alter von 55 Jahren an den Auswirkungen einer schnell fortschreitenden Krebserkrankung verstorben. Herr H. lebte gemeinsam mit seiner Ehefrau (53 J.) in dem gemeinsamen Haus in Düsseldorf und führte noch weit bis in das Vorjahr seines Todes hinein und bereits stark durch Erkrankung und Therapie gekennzeichnet das gemeinsame Familienunternehmen, ein Fachbetrieb für Kälte- und Klimatechnik. Eine rheumatologische Vorerkrankung zwang den Selbstständigen bereits in den Jahren zuvor zu häufigen Arztkonsultationen und zur Einnahme zahlreicher analgesierender und entzündungshemmender Medikamente. Einen krankheitsbedingten Ausfall konnte sich Herr H. aufgrund mangelnder Rücklagen finanziell kaum leisten, der eigene Sohn (Klimatechniker, 29 J.) jedoch konnte die Aufträge mittlerweile eigenständig übernehmen und so die Ausfälle teilweise kompensieren. Der erste große Einbruch traf die Familie im Januar 2008, als Herr H. von der Diagnose Darmkrebs (Colorektales Karzinom) getroffen wurde. Die behandelnden Ärzte entschlossen sich zu einer Entfernung eines Darmabschnittes mit Anlage eines vorübergehenden künstlichen Darmausganges (protektiver Anus praeter). Die aufgrund einer Metastasierung in einige umgebende Lymphknoten fortgeschrittene Erkrankung musste anschließend mit einer Chemotherapie behandelt werden (adjuvante CHT). Diese ging mit vielen Nebenwirkungen einher und Herr H. konnte nur noch eingeschränkt seiner Arbeit nachgehen. Der Alltag ließ sich zunehmend schlechter selbstständig gestalten, der Hilfebedarf nahm rapide zu. Im Laufe des Jahres stellte sich bei Nachuntersuchungen ein Krankheitsprogress dar, nun waren auch Leber und Bauchfell mit Metastasen besiedelt. Weitere Chemotherapien führten zu keinem Erfolg, gemeinsam haben sich Familie und Behandler auf ein palliatives Prozedere verständigt, so dass die reine Kontrolle von Schmerzsymptomen sowie Übelkeit und Erbrechen im Vordergrund stand. Ständig neu auftretende Stuhlverhalte, Infektionen und Inappetenz führten zu wiederholten Klinikaufenthalten, Frau H. und Sohn zeigten sich mit der häuslichen Versorgung überfordert. Im Februar 2010 schließlich verstarb Herr H. im Rahmen eines erneuten Klinikaufenthaltes im Beisein seiner Familie. Die Firma erlosch noch vor seinem Ableben, da der Sohn diese nicht weiterführen konnte und die Geldmittel aufgebraucht waren. Detaillierter Fallverlauf Herr H. konsultiert erstmals im Januar 2008 seinen Hausarzt, weil er beeinträchtigende Stuhlgangsunregelmäßigkeiten festgestellt hatte. Dieser verweist Herrn H. routinemäßig zur weiteren Abklärung zu einer ambulanten Darmspiegelung an das nächstgelegene Krankenhaus, das sich nur wenige Autominuten von dem Haus der Familie befindet. Dabei zeigte sich nach erfolgter Untersuchung mit Entnahme einer Gewebeprobe (Histologe), wie die untersuchende Oberärztin Herrn H. später in einem vertraulichen Gespräch mitteilte, ein bösartiger (maligner) Tumor, über dessen Ausbreitung sie zu diesem Zeitpunkt jedoch noch keine Aussage treffen konnte. Klar war jedoch, dass eine Operation erfolgen und der Tumor entfernt werden müsste. Herr H. nahm die Diagnose augenscheinlich gefasst an und fand bei seiner Ehefrau, mit der ihn eine innige, vertrauensvolle Partnerschaft seit über 30 Jahren verband, festen Halt. Sie haben einen gemeinsamen Sohn und führen ein eher isoliertes Sozialleben. Es gibt keine Vereinsmitgliedschaften und einen nur kleinen Freundeskreis. Lediglich die Eltern von Frau H. leben noch, wohnen aber im ca. 200 Kilometer entfernten Koblenz. Der Diagnoseschock war vorerst ohne externe Hilfe überwunden und Herr H. konnte bis zum Operationszeitpunkt seine Firma weiterführen und war auch aktiv an Montagearbeiten beteiligt. Dabei unterstützte ihn sein Sohn, der allerdings erst wenig Berufserfahrung in der Branche vorweisen konnte. Als Herr H. zur Operation stationär aufgenommen wurde, hatte er die Geschäfte weitestgehend an seinen Sohn übertragen. Doch noch während der OP-Vorbereitungen führt Herr H. Kundengespräche. Er lässt sich täglich dringliche Unterlagen von seiner Frau mitbringen, die nun verstärkt mit der Buchführung der Firma beauftragt ist. Schließlich wird Herr H. operiert. Dabei wird eine Entfernung eines unteren Dickdarmabschnittes durchgeführt (Sigmaresektion) und ein künstlicher Darmausgang angelegt. Dieser ist protektiv und würde nach sechs bis acht Wochen wieder zurückverlegt, um der intraoperativ geschaffenen Neuverbindung der verbliebenen Darmanteile die Chance zur Heilung zu geben. Die Operation verläuft plangerecht und ohne Komplikationen. Herr H. wird durch Pflegefachkräfte und Physiotherapie täglich mehrfach mobilisiert, allerdings zeigen sich die vorbestehende rheumatoide Arthritis und ein mittleres Übergewicht als Erschwernisfaktoren bei der postoperativen Belastung. Dennoch kann Herr H. zeitgerecht genesen. Die Anlage des künstlichen Darmausganges akzeptiert Herr H. gut. Nach einigen Tagen lernt er schnell und suffizient, das Stoma selbstständig zu versorgen. Das Entleeren übernimmt er nach Anleitung durch die Pflegenden selbstständig. Eine spezialisierte Stomatherapeutin wird informiert und übernimmt intensivere Patientenanleitungen und die Auswahl der geeigneten Produkte. Sie wird Herrn H. auch noch nach dem klinischen Aufenthalt im häuslichen Rahmen weiterbetreuen. Im Verlaufe der stationären Rekonvaleszenz wird auch der Sozialdienst auf den Pat. aufmerksam gemacht. Dieser wird standardisiert bei Krebspatienten hinzu gezogen, etwa um eine onkologische Rehabilitation einzuleiten. Herr H. ist aufgrund seiner Selbstständigkeit privat versichert. Aufgrund der weiteren drohenden und nicht ausreichend abgesicherten Verdienstausfälle und einer geringen Kostenübernahme der PKV verzichtet Herr H. auf eine Rehabilitationsmaßnahme. Bereits jetzt erwägen Herr und Frau H. eine Hypothek auf ihr Eigenheim aufzunehmen. Im Rahmen der Darmkrebsbehandlung wird Herr H. auch einer psychoonkologischen Betreuung zugeführt. Das Krankenhaus ist als Darmzentrum zertifiziert und bietet daher den psychologischen Dienst an. Die Psychoonkologin führt zunächst ein Interview mit Herrn H. durch. Sie wendet das sogenannte Disstress-Thermometer an. Dieses zeichnet anhand von sieben Globalfragen zu körperlicher und geistiger Verfassung auch ein grobes Bild von Belastungen im familiären, sozialen und beruflichen Umfeld. Herr H. erreicht bei dem Interview einen hohen Schwellenwert, der der Psychoonkologin einen weiterführenden Betreuungsbedarf anzeigt. Sie wird den Kontakt zu Herrn H. halten. Für ihn sind die Sorgen um Haus, Einkommen und Zukunft der Familie dominant. Die Angst um die eigene Gesundheit scheint derzeit nicht zu überwiegen. Es wird deutlich, dass sich Herr H. auf den Krankheitsverlauf bezogen, fast kontinuierlich in einer instabilen Phase befindet. (Corbin & Strauss, 2004; 280) Wichtige Ressourcen zu einem neuen Lebensentwurf fehlen. Die Psychoonkologin gibt Herrn H. noch einige Tipps zu Entspannungsübungen und weist ihn auf mögliche Bewältigungs- und Copingstrategien im Umgang mit seiner Krebserkrankung hin. Herr H. nimmt diese dankend an. Zum Ende des ersten Klinikaufenthaltes wird Herr H. von der zuständigen Onkologin über die notwendige ambulante Weiterbehandlung in der an die Klinik angeschlossenen onkologischen Ambulanz aufgeklärt. Hier soll eine adjuvante Chemotherapie erfolgen, da die histologische Befundung des Operationspräparates die entsprechende Indikation dafür ergeben hatte. Dabei erklärt die Ärztin, dass aufgrund eines ausgeprägten Lymphknotenbefalles bereits ein fortgeschrittenes Stadium vorliegt (Stadium III). Die Chemotherapie soll über 6 Monate verabreicht werden, erst danach könne auch der künstliche Darmausgang zurückverlagert werden. Herr H. ist irritiert und fühlt sich zurückgeworfen. Mit Chemotherapie habe er ja fast gerechnet, aber ein halbes Jahr lang den künstlichen Darmausgang zu behalten, sieht er zunächst nicht ein. Ein erster Vorstellungstermin für die Chemotherapie wird noch am Krankenbett vereinbart. Herr H. ist entlassen und die ersten Rechnungen der Klinik treffen ein. Sie drängen den Unternehmer in finanzielle Schwierigkeiten. Herr H. verhält sich seiner Frau gegenüber mürrisch und ist nach der Arbeit stark erschöpft. Zudem belastet die Versorgung des künstlichen Darmausganges die Paarbeziehung. Es überwiegen Schamgefühle und Herr H. lehnt Hilfestellungen seiner Ehefrau kategorisch ab. Die wöchentlichen Besuche der Stomatherapeutin hingegen nimmt er dankend an. Schon nach drei Wochen beherrscht er die Stomaversorgung komplett selbstständig. Herr H. findet sich zur ersten Chemotherapie in der onkologischen Ambulanz ein. Aufgrund seiner Rheumaerkrankung und starken Schmerzen in den Kniegelenken benötigt Herr H. mittlerweile Unterarmgehstützen. Die Chemotherapie kann aufgrund der guten Venenverhältnisse über einen Venenverweilkatheter verabreicht werden. Die Anlage eines implantierten PORT-Systems war bislang nicht vakant. Herr H. erhält moderne Antiemetika zur Vorbeugung von Übelkeit als eine der möglichen Hauptnebenwirkungen der Chemotherapie. Einmal wöchentlich finden Blutbildkontrollen statt. Nach einem Monat Chemotherapie greifen jedoch auch die Antiemetika nicht mehr und Herr H. leidet stark an Übelkeit, Erbrechen und Durchfällen. Sein Allgemeinzustand zeigt sich zunehmend reduziert. Seine Blutparameter zeigen pathologische Veränderungen. Insbesondere die weißen und roten Blutkörperchen und der rote Blutfarbstoff (Leukozyten, Erythrozyten, Hämoglobin) sind als Folge der Chemotherapie stark abgefallen. Schließlich sogar soweit, dass eine Klinikeinweisung wegen der hohen Infektionsgefahr und der zunehmenden Belastungsdyspnoe (Sauerstoffarmut) unumgänglich ist. Die Ehefrau Frau H. muss unterdessen erneut einen Spagat leisten, indem sie die Firma gemeinsam mit dem Sohn leitet, den Haushalt führt und gleichzeitig ihren Ehemann mehrmals täglich im Krankenhaus besucht. Sie übernimmt jetzt sogar grundpflegerische Tätigkeiten, da sich Herr H. nur ungern von fremden Krankenschwestern waschen lässt. Doch alleine schafft er es nicht. Mittlerweile hat sich der Hilfebedarf stark gesteigert. Herr H. ist auf eine Teilübernahme der Grundpflege am Waschbecken angewiesen, die Mobilität ist stark eingeschränkt und von Hilfsmitteln abhängig. Herr H. wirkt psychisch labil, streitet oft mit seiner Ehefrau. Hinzu kommen die Geldsorgen, die das Ehepaar schwer treffen. Nach einigen Bluttransfusionen und einer antibiotischen Behandlung stabilisiert sich der Zustand von Herrn H. wieder, jedoch auf einem niedrigeren Niveau als vor der Einweisung. Die zuständigen Pflegekräfte haben die Veränderungen im Hilfebedarf erkannt und nochmals den Sozialdienst zwecks einer Einstufierung in eine Pflegestufe vor der Entlassung nach Hause informiert. Der Mitarbeiter nimmt daraufhin Kontakt mit der privaten Krankenversicherung auf, die schließlich über den MDK eine Pflegestufe I nach Aktenlage bewilligt. Der Sozialdienst veranlasst die Anlieferung eines Toilettenstuhles und eines Rollators zum Zeitpunkt der Entlassung. Herr H. kann zunächst wieder entlassen werden, kann jedoch nicht mehr die gewohnte Arbeitsleistung erbringen. Die Chemotherapie hat er vorläufig abgebrochen. Sein Augenmerk gilt jetzt wieder dem Engagement für seine Firma, die er nur noch vom Wohnzimmer aus administrativ führen kann. Darunter leidet er sehr. Gerne würde er das Unternehmen an seinen Sohn übertragen. Dies geht jedoch nicht, da dieser noch keinen Meistertitel erlangt hat. Der Sohn macht sich Gedanken, wie es weitergehen soll und schlägt vor, einen Geschäftsführer einzustellen. Herr H. jedoch lehnt ab und begründet dies mit der finanziellen Englage. Nach zunehmender gesundheitlicher Stabilisierung wird die Chemotherapie fortgesetzt. Dieses Mal verträgt Herr H. die CHT besser. Nach ca. einem halben Jahr seit der Operation und mit Beendigung der CHT stand nun der Termin für die Rückverlagerung des künstlichen Darmausganges an. Zuvor erfolgte im stationären Rahmen ein sogenanntes Re-Staging, also eine Nachuntersuchung zur Feststellung eines Erkrankungsrückganges oder Fortschreitens. Dabei stellte sich heraus, dass, trotz CHT, Metastasen die Leber infiltriert hatten und auch das Bauchfell von Tumorzellabsiedelungen betroffen ist. Für die Familie H. ein erschütternder Rückschlag. Erstmals wird von ärztlicher Seite nicht mehr von Kuration gesprochen. Aufgrund der neuen Befundlage wird von einer Stomarückverlagerung abgesehen, da mit Heilungskomplikationen zu rechnen sei. Herr H. wird eine nochmalige intensivierte CHT offeriert, mit dem Ziel ein weiteres Fortschreiten der Erkrankung zu verhindern. Herr H. willigt ein, ebenso in die Implantation eines PORT-Systemes. Kurze Zeit nach der Anlage des Kathetersystemes wird Herr H. entlassen und zur Weiterbehandlung an die Ambulanz übergeben. Zunächst geht alles seinen gewohnten Gang und das Ehepaar H. bewältigt die Chemotherapiezyklen routiniert. Tiefe Einschnitte in den Alltag durch Nebenwirkungen der CHT jedoch prägen das Jahr 2009. Zugleich nehmen Inappetenz und Tumorschmerzen zu. Häufige Klinikaufenthalte sind die Folge. Herr H. konnte bereits ein Jahr lang seine Geschäfte nicht mehr führen, die Firma musste aufgegeben werden. Der Sohn ist bei einem fremden Unternehmen angestellt. Das Ehepaar erhält Grundsicherung. 2010 schließlich kommt es zu einer erneuten Einweisung mit dem hochgradigen Verdacht auf einen Darmverschluss. Dieser bestätigt sich, Therapieoptionen gibt es keine mehr. Symptomkontrolle steht jetzt im Vordergrund. Es finden mehrere Gespräche von ärztlicher Seite aus mit der Familie statt, dass „man nun nichts mehr tun könne“. Im Rahmen der wöchentlichen Palliativkonferenzen wird Herr H. vorgestellt und die palliativmedizinische Komplexbehandlung für Herrn H. eingeleitet. Diese umfasste intensivere Gespräche, die Betreuung durch Psychoonkologen, Physiotherapie mit dem Fokus auf physikalische Methoden zur Entspannung und Kunsttherapie. Auch Frau H. wird in die Betreuung miteinbezogen, und nimmt Hilfestellungen für sich selbst an. Sie stützt auch den Sohn, der immer noch für das Leben seines Vaters „kämpft“ und die absehbare Endlichkeit des Vaters nicht akzeptieren kann. Gemeinsam mit Herrn und Frau H. überlegt sich das Behandler-Team eine Verlegung in ein Hospiz. Hier stehen jedoch derzeit keine Plätze zur Verfügung. Jeden Tag hofft Frau H. auf eine neue Nachricht über freie Kapazitäten. Als sich Herr H. bereits in der Sterbephase befindet, ermöglicht die Station die Unterbringung der Ehefrau bei Herrn H. auf dem gleichen Zimmer und ein Bett wird bereit gestellt. In den letzten Stunden erhält Herr H. Morphin subkutan und ist zunehmend eingetrübt. In Begleitung einer Pflegefachkraft für Palliativpflege kann Frau H. von Ihrem Ehemann Abschied nehmen. Er schläft friedlich und ohne Schmerzen ein. Die Ehefrau erfährt bis dato Unterstützung durch einen ehrenamtlichen Hospizverein und hat dort neue Bekanntschaften knüpfen können.
2.2 Krankheitsverlaufskurve
In der nachstehenden Grafik werden die Phasen dargestellt, die die Belastungen des im Fallbeispiel von Krebs Betroffenen im Verlauf seiner Erkrankung kennzeichnen. Dabei wird die Definition nach Corbin & Strauss aus dem Jahr 2004 zu Grunde gelegt, die im „Trajekt-Modell“ ihre praktische Anwendung findet. Dieses interdisziplinär nutzbare Modell stellt die Krankheitsbewältigung als zentralen Ausgangspunkt für die Versorgung dar. Es ist aus zahlreichen Interviews im stationären und ambulanten Sektor entstanden, basierend auf der Methode der Grounded Theory, einem interpretativen Paradigma.
„Der Begriff Verlaufskurve weist nicht nur auf die potenzielle physiologische Entwicklung einer Krankheit hin, sondern auch auf die Arbeit, die zu deren Bewältigung erforderlich ist, auf die Auswirkungen der Krankheit und auf die Veränderungen im Leben des Kranken und seiner Familie, was sich dann wieder auf deren Bewältigung der Krankheit selbst auswirkt.“ (Corbin & Strauss, 2004; 31)
Aufgrund des schleichenden Verlaufs kann insbesondere die Krebserkrankung zum sozialen Rückzug führen, der oft nicht wahrgenommen wird. Diese weitreichenden Beeinträchtigungen können zum Hilfebedarf durch Familie und Umfeld oder professionellen Dienstleistern führen. (Lubkin, 2002; 212) Abhängig vom weiteren Verlauf der Erkrankung (Krankheitsstadium) spielt der Allgemeinzustand des Patienten, der Leidensdruck als auch die Einschränkung in der Lebensqualität für das diagnostische und therapeutische Vorgehen eine wesentliche Rolle. Unter Arbeit verstehen Corbin & Strauss den „Umgang mit der Krankheit an sich“. (Corbin & Strauss, 2004; 18) Für die Patienten bedeutet eine chronische Erkrankung in der Regel Krankheitsanpassung. Die Behandler sind dabei behilflich, diese mit dem Krankheitseinbruch einhergehenden Verunsicherungen und Probleme zu lösen oder geben Möglichkeiten der Gestaltung des Lebens mit einer chronischen Erkrankung (Schaeffer, 1995; 146). Die Kurve für das Fallbeispiel ist geprägt durch einen ständigen Wechsel der verschiedenen Phasen, wobei der deutliche Trend eine Abwärtsbewegung nach zunächst eher episodenhaftem Verlauf ist (Abb. 1). Es zeigt den schwerpunktmäßigen Interventionsbedarf, der sich zur palliativen Phase hin sichtlich intensiviert hat. Eine kontinuierliche Anpassung der Hilfeleistungen musste auf den tatsächlichen Bedarf des Betroffenen angepasst sein. Die Herausforderung an die professionellen Akteure besteht im Allgemeinen darin, die jeweilige Phase im Krankheitsverlaufs zu identifizieren und einen angepassten Maßnahmenplan zu initialisieren, mit denen der Krankheitsverlauf bewältigt werden kann (Corbin & Strauss, 2004; 51ff.). Hier spielen Instrumente zum Coping2 und zur Krankheitsbewältigung sowie Assessment- und Screeninginstrumente der Psychoonkologie eine Hauptrolle. Die psychischen Hauptbelastungen werden in Abb. 2 dargestellt.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Beim Trajekt-Modell nach Corbin & Strauss handelt es sich um ein Modell, das auf die spezielle Pflegesituation chronisch kranker Menschen ausgerichtet ist. Die englische Bezeichnung „trajectory“ bedeutet wörtlich übersetzt „Flugbahn“ und veranschaulicht somit den Verlauf einer chronischen Erkrankung in ihren unterschiedlichen Stadien und Phasen. Es handelt sich um ein ganzheitliches, fallbegleitendes Bezugspflegesystem, das darauf gründet, bei chronischen und schweren Krankheitsverläufen die Biographie des Patienten sowie sein soziales Umfeld miteinzubeziehen. Dabei wird er als partizipierender Partner bei Gesundheit, Prävention, Krankheit und Rehabilitation behandelt. Die Bezugspflegekraft hilft, den Patienten in seiner Selbständigkeit, Selbsthilfe und Selbstautonomie zu unterstützen. Sie befähigt ihn, ein möglichst „normales“ Leben zu führen. Sie vermittelt Hilfestellungen beim Zugang zu Ressourcen der Gesundheits- und Sozialleistungen, schafft dabei ein Versorgungskontinuum. Das Modell sieht vor, Case Management praktisch umzusetzen. Chronische Krankheiten sind ernste Erkrankungen, die unter Umständen das gesamte Leben des Betroffenen über andauern. Sie beeinflussen das psychische, emotionale und soziale Wohlbefinden der Person. In vielen Fällen haben sie negativen Einfluss auf die Lebensqualität. Der Betroffene benötigt auf seinem Weg für die Krankheitsbewältigung Unterstützung durch das Gesundheitssystem. Im Sinne des Trajekt-Modells (TM) soll daher ein vertrauensvoller Beziehungsaufbau zwischen der betreuenden Pflegekraft und dem Patienten geschaffen werden.“
Corbin und Strauss haben die Phasen des Krankheitsverlaufes wie folgt zusammengefasst: Das erste Stadium eines Krankheitsverlaufes wird bereits als die Zeit vor dem Eintreten der Erkrankung definiert, also vor dem Auftreten von Symptomen und bevor eine offizielle Diagnose erstellt worden ist. Die Einbeziehung dieser Phase in die Abbildung des Krankheitsverlaufes hebt die Bedeutung der Krankheitsprävention hervor. Sobald Anzeichen oder Symptome für eine Erkrankung auftreten, stellen diese den Ausbruch der Erkrankung bzw. den Beginn der Krankheitsverlaufskurve dar. Dieser Zeitpunkt bedeutet eine signifikante Gesundheitsgefährdung (Krise) für den Patienten, bezogen auf die ganzheitliche Situation des Betroffenen, also seinen Körper, seine Psyche und sein soziales Umfeld. Dieser Krankheitsbeginn kann sich in einer akuten Krankheitsperiode äußern, die aktive Interventionen erfordert, gewöhnlich durch den stationären Aufenthalt in einer Klinik (akute Phase). Bereits hier sollten die angestrebten Versorgungsstrukturen greifen, um eine Verschlechterung der Situation zu vermeiden oder das Auftreten von Komplikationen zu verhindern, die mit den Auswirkungen der Erkrankung zusammenhängen. Sind diese Maßnahmen und Interventionen effektiv, kann eine stabile Phase erreicht werden, die unterschiedliche Grade an Unterstützungen erfordert, um den erreichten Zustand aufrecht zu erhalten (stabile Phase). Bei chronischen Verläufen ist es dennoch nicht vermeidbar, dass neue Krankheitsschübe auftreten können, die direkt oder indirekt mit der Erkrankung zusammenhängen. Diese Situation verlangt eine Neubeurteilung und Anpassung der Maßnahmen, für gewöhnlich ohne stationäre Einweisung, um Stabilität und Bewältigung des Schubes zu fördern (instabile Phase). Reaktionen auf diese Interventionsschwerpunkte zur Erholung des Patienten können an einigen Stellen nicht erfolgreich sein und der Zustand des Patienten kann sich verschlechtern (abfallende Phase), bis zu einem Punkt, wo der Patient unheilbar krank ist (Sterbephase).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
3. Analyse der Schnittstellen- und Versorgungsprobleme Das deutsche Gesundheitssystem ist gekennzeichnet durch die weiterhin immanente Trennung der Versorgungsbereiche ambulant, stationär, Rehabilitation und Pflege, Gesundheits- und Sozialwesen, Professionellen-Hilfe und Laienarbeit (Ehrenamt). Das daraus resultierende eher unkoordinierte Parallelwirken verschiedener Leistungserbringer in den Versorgungsstrukturen führt so nicht zu geeigneten bzw. bedarfsgerechten Lösungen für betroffene Erkrankte, da die Verantwortungsreichweiten der einzelnen „Dienstleister begrenzt sind, und nur ein bedingtes Verantwortlichkeitsgefühl daraus resultiert. Zudem verliert der Nutzer den Überblick bei der Vielzahl an Angeboten und kann das für ihn passende nicht heraus selektieren. Das zu Grunde liegende Fallbeispiel zeigt, dass nicht die für den Erkrankten sinnvollste und optimale Versorgung gewählt wurde. Die Zuführung zu den optimalen Versorgungsstrukturen und eine kontinuierliche Begleitung wären jedoch angezeigt gewesen. Anstatt den gesamten Krankheitsverlauf zu begleiten und daraus den aktuellen Bedarf abzuleiten wurde bisher lediglich nur auf einzelne Abschnitte Bezug genommen, so dass die Diskrepanz zwischen den wirklichen Bedürfnissen des Betroffenen und dem Angebot der Krankenversorgung immer größer wird und eine Unter- bzw. Überversorgung, wenn nicht gar eine Fehlversorgung daraus resultiert.
3.1 Diskontinuität / Desintegration und deren Folgen
Mit dem continuum of care (Weil, 1985) und dem Konzept des Unterstützungsmanagements (Wendt, 1995) gibt es bereits umfangreich diskutierte Ansätze zur Lösung der Fragen nach einer von der WHO 1978 bei der Konferenz in Alma-Ata festgeschriebenen Forderung nach einer kontinuierlichen Gesundheitsversorgung. Diese scheint jedoch auch heute noch nicht erfüllt. Diskontinuität und Desintegration sind nach wie vor ein präsentes Problem in der Gesundheitsversorgung. Nach Ewers bezeichnet der Begriff Integration die räumliche Dimension des Versorgungsgeschehens und dabei die Systemperspektive. Greifen die notwenigen Strukturen und Prozesse innerhalb des Versorgungssystems nicht ineinander wird dies als Desintegration bezeichnet. Häufig liegt dieser ein Festhalten an strukturellen und professionsbezogenen Grenzen zu Grunde. Ist die zeitliche Dimension der Versorgung in Hinsicht auf die Nutzerperspektive und ein episodenhaftes Agieren, so ist die anfangs beschriebene Kontinuität nicht mehr gewährleistet.
In der Folge stellt sich Diskontinuität ein. (Ewers & Schaeffer, 2003; Schaeffer 2000b) Diskontinuität und Desintegration als wesentliche Problemstellungen der Gesundheitsversorgung werden im Fallbeispiel wie folgt deutlich: In erster Linie treten Kommunikationsdefizite in den Fokus der Falldarstellung. Ebenso kommen Schnittstellenprobleme zum Tragen. Zuletzt mangelt es an Kooperation und Vernetzung der Leistungserbringer und Versorger. Ein fehlendes Angebot ist das Resultat dieser Konstellation. Die so entstandenen Versorgungsdefizite, die zu einem Teil auch als Folge der Medikalisierung auftreten ( näher behandelt in Kapitel 3.2) und mit einer defizitären Patienten- und Ergebnisorientierung einhergehen, bewirken in der Konsequenz nachteilige Effekte auf Krankheitsverlauf, Krankheitsbewältigung und Begleitung in der palliativen Erkrankungsphase. Zudem werden die „Co-Erkrankten“, in diesem Fall vorwiegend die Ehefrau als familiäre Hauptbezugsperson, hinsichtlich der eigenen Belastungen nicht ausreichend berücksichtigt und begleitet.
Die Kommunikationsdefizite im Einzelnen: Onkologische Erkrankungen sind geprägt durch die psychosozialen Belastungen, wie sie für das Fallbeispiel exemplarisch in Abb. 2 dargestellt sind. Im Vordergrund steht die Bewältigung alltagspraktischer Probleme, emotionaler Sorgen, psychischer Belastungen, spiritueller/religiöser Belange und körperlicher Probleme, die sowohl krankheitsbedingt, als auch therapieinduziert sein können. In den Phasen von Diagnoseschock über Remission, Progredienzangst bis hin zur Palliation sind die vorher benannten Kernelemente des täglichen Lebens ständig in Frage gestellt und bedürfen daher einer kontinuierlichen Betreuung durch professionelle Akteure. In dem Beispiel von Herrn H. sieht sich der Betroffene auf sich alleine gestellt. Lediglich die behandelnde Onkologin nimmt sich für das Aufklärungsgespräch ausreichend Raum und Zeit, wobei diese Herrn H. nicht über die Eventualität einer CHT hinreichend informiert hat. Eine Erstbetreuung durch einen Psychoonkologen hat nicht stattgefunden. Ebenso gab es seitens der Klinik keine ausreichende Kommunikation an dem Hausarzt, dessen Rolle im gesamten Erkrankungszeitraum eine untergeordnete Rolle spielte. Auch wurden die Belange der Ehefrau nicht zur Kenntnis genommen. Diese hatte im Krankheitsverlauf die Last der Erkrankung ihres Ehemannes alleine zu tragen. Hinzu kam die Doppelbelastung in Bezug auf die berufliche/finanzielle Problematik und das Krankheitsgeschehen. Sie war es zudem, die auch den besorgten Sohn betreute. Eine externe Hilfestellung blieb aus. Dies war ein Grund mit dafür, dass Frau H. nicht den geeigneten Umgang mit ihrem schwer erkrankten Ehemann erlernen konnte. Häufige Konflikte führten zu einer weiteren Belastung der Paarbeziehung und machten stellten eine außerordentliche Hürde bei der Krankheits- und Alltagsbewältigung dar.
Die Schnittstellenprobleme im Einzelnen: Schnittstellenprobleme treten erstmalig bei der Entlassung nach der ersten Operation zu Tage. Zwar hat es ein Entlassungsmanagement, wie es der nationale Expertenstandard (DNQP) vorsieht, gegeben, jedoch ist dieses nur auf kurze Sicht und nicht prognostisch ausgelegt worden. Mit einem Case Management-Ansatz hätte die Reichweite der Versorgung vergrößert werden können. Auch wenn nach dem zweiten Klinikaufenthalt in 2009 wegen starker Nebenwirkungen unter der CHT der Sozialdienst mit der Pflegeeinstufung und der Hilfsmittelversorgung befasst war, so kam es schließlich doch zu Versorgungsbrüchen auf der beruflich, sozialen Ebene, da das selbstständige Ehepaar mittlerweile erhebliche Finanzprobleme zu lösen hatte. Die Beantragung von finanziellen Hilfen stellte das Ehepaar auf eine weitere Probe, da dieses die Beiträge für die PKV zu zahlen nicht mehr in der Lage war. Schließlich zeigen sich erhebliche Versorgungslücken in der Phase der Verschlechterung. Lediglich die Klinik stellte sich als Ansprechpartner heraus, ambulante Hilfeleistungen wurden von Herrn und Frau H. nicht in Anspruch genommen. Durch die geringe Integration und Information des Hausarztes kam es zu häufigen Klinikeinweisungen und eine schleichend einsetzende Symptomkontrolle. Erst als die Beschwerden zu groß wurden, suchte Herr H. erneut die Klinik auf, eine hausärztliche Betreuung war jedoch in mehreren Phasen angezeigt. Eine ambulante palliative Versorgung war schließlich durch einen Mangel an Angeboten nicht möglich, so dass Herr H. im Krankenhaus verstarb.
Der Mangel an Kooperation und Vernetzung der Leistungserbinger im Einzelnen: Besonders deutlich wird das mangelnde Versorgungsnetz im vorliegenden Fall durch die diskontinuierliche psychosoziale Betreuung und die ausbleibende ambulante Weiterversorgung durch einen niedergelassenen psychologischen Dienst. Die Informationseinholung über die Krebserkrankung und die Therapieoptionen wurde vollständig dem Patienten überlassen. Eine den Krebsbetroffenen aufsuchende Hilfestellung jedoch hätte womöglich einen Compliance- und Coping-fördernden Effekt bewirken können. Die geringe Kooperation mit dem Hausarzt hat den „Drehtüreffekt“ verstärkt und hat den Abbruch der ersten CHT mitbedingt. Die auf die initale Weiterversorgung beschränkte Intervention durch den Sozialdienst, in diesem Fall die Ausstattung mit Hilfsmitteln für das häusliche Umfeld, kennzeichnet die fehlende Vernetzung von stationären und ambulanten Leistungserbringern. So konnte eine Sicherstellung der Beantragung von weiteren Hilfestellungen, insbesondere finanzieller Hilfen nicht erfolgen. Es gab auch keine rückkoppelnden Aktionen seitens der Sozialberatung der Klinik. Die fehlende Kooperation mit ambulanten Dienstleistern, wie Palliativ-Pflegedienst, ökumenische Hospizbewegung, und anderen hat Herrn H. durch ein fehlendes Netzwerk wiederholt und auch in der letzten Lebensphase in das klinische Umfeld getragen.
3.2 Medikalisierung / Desintegration und palliative Ethik
Anders als bei akuten oder subakuten Erkrankungen werden dem von einer Krebserkrankung Betroffenen in jedem Bereich seines Lebens kontinuierliche Anpassungsleistungen an den Krankheitsverlauf abverlangt, wie auch das Fallbeispiel aufzeigt. Dabei erfordern insbesondere die vielfältigen Übergänge von der einen in die andere Phase des Krankheitsverlaufs mit den dazugehörigen Krisen nach einem hinreichend integrierten und kontinuierlichen Begleitungs- und Versorgungsangebot. (Corbin & Strauss, 1993; Corbin, 1994; Schaeffer & Moers, 1993; Schaeffer, 1995b) Bei derartigen chronischen Erkrankungen ist demnach nicht nur eine Orientierung an akuten Problemlagen erforderlich, „vielmehr ist ein Denken in längerfristigen und komplexen Versorgungszusammenhängen notwendig, das systematisch bereits im präventiven Vorfeld von Krankheit und Kranksein beginnt und, über die akute Kuration hinaus, langfristige Ein- und Ausgliederungsprozesse von Gesunden und Kranken im Blick behält“ (Schwartz et al. 1995 in Ewers, 1996). Daneben wird aufgrund dieser Anpassungsdefizite sowohl eine Über- oder Unterversorgung als auch eine ungerichtete Überinanspruchnahme vorwiegend ärztlicher Leistungen beobachtet und konnte auch in diesem Fallbeispiel dargestellt werden. Herr H. erhält medizinische Therapien, kann aber in Bezug auf psychosoziale Auswirkungen seiner Erkrankung nur unzureichend betreut werden. Diese Entwicklung bezeichnet Ewers in Verbindung mit der traditionellen Unterbewertung nicht-medizinischer Berufsgruppen als massive Medikalisierung von Versorgungsproblemen, die nach einhelliger Meinung mit biomedizinischen Verfahren nur unzureichend zu bewältigen sind. (Baidock & Evers, 1991; Rosenbrock, 1992; Schaeffer, Moers & Rosenbrock, 1994) Aber auch die Desintegration von stationärer und ambulanter Versorgung erweist sich zunehmend als problematisch und verlangt nach einem Mehr an Patientenorientiertheit. Diese Problematik betrifft die gesamte deutsche Gesundheitsversorgung, die von hochwertigen Einzelleistungen geprägt ist, jedoch infolge der Fragmentierung der Leistungsträger und der Leistungserbringung, trotz der Einführung des SGB IX, durch mangelnde Kooperation und Integration der einzelnen Versorgungsmodule gekennzeichnet ist3 Im Zusammenhang mit einem palliativ orientierten Prozedere wird die Lücke deutlich, die Desintegration und Medikalisierung in Form von vernachlässigter Patientenorientiertheit hinterlässt. Eine rechtzeitige Vorbereitung auf eine Nichtheilbarkeit und die Bereitstellung von Hilfen zur Anpassung an diese Lebenssituation entspricht einer ethischen Grundforderung und kann helfen, Krankheitsverläufe wie die von Herrn H. „verarbeitbar“ zu machen. Die Flucht in eine Maximalmedizin mit dem Fokus auf Kuration scheint wie eine Maske, hinter der sich die Behandler verstecken, um nicht mit der Frage der Endlichkeit seines Patienten konfrontiert zu werden. Haben schließlich alles Therapien versagt, bleiben oft nur die Worte „Wir können jetzt nichts mehr tun“ im Raum stehen. Dahinter aber verbergen sich Ohnmacht, Hilflosigkeit und ein Trugschluss. Den auch die Symptomkontrolle, das Leiden verhindern, die Schmerzstillung sind Dinge, die getan werden können. Ebenso die menschliche Begleitung und die Hilfestellung in sozialen Fragen sind Maßnahmen, die genauso Bestandteile der Gesundheitsversorgung sein sollten, wie die primär verfolgten medizinischen Ansätze. Hier kann Case Management in Form von anwaltschaftlichen und vermittelndem Handeln her unterstützen und agieren.
[...]
2 Begriffsklärung Die Begriffe „Bewältigung“ und „Coping“ weisen dem Grunde nach die gleiche Bedeutung, weisen jedoch eine unterschiedliche Herkunft auf. Das deutsche Wort „Bewältigung“ ist ursprünglich von „walten“ (stark sein, beherrschen) abgeleitet, bildete sich über „Gewalt“ (außerordentliche Größe, Stärke, Macht) sowie „überwältigen“ (sich einer Sache gewaltig zeigen) im 15. Jhd. heraus und bedeutet „mit etwas fertig zu werden, sich nicht unterkriegen zu lassen und sich von Widerfahrenem nicht überwältigen zu lassen.“ „Coping“ hingegen kommt aus dem Englischen „to cope with“, was soviel wie „sich messen können, gewachsen sein und es mit etwas aufnehmen können“ heißt. Beide Begriffe werden oft synonym verwendet, da es in der Bewältigungsforschung keine Einigung auf eine einheitliche Definition gibt. Innerhalb ihrer Arbeiten haben jedoch einige Forscher/innen der jeweiligen Theorie angepasste Definitionen entwickelt, so z. B. die Auslegung von Muthny, wonach Coping jede zur Bewältigung eines kritischen Ereignisses eingesetzte und erfolgsunabhängige Anstrengung bezeichnet. (Baldegger 2000; 126) Krankheitsbewältigung kann im Wesentlichen handlungs-, kognitions- oder emotionsbezogen auftreten und Veränderungen der Situation, der Umwelt oder des Umgangs mit der eigenen Person inklusive der krankheitsbezogenen Gefühle zum Ziel haben.
3 vgl. Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen, Gutachten 2007, Kooperation und Verantwortung – Voraussetzung einer zielorientierten Gesundheitsversorgung.
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Erstausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2011
- ISBN (Paperback)
- 9783956843518
- ISBN (PDF)
- 9783956848513
- Dateigröße
- 5.5 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Universität Bielefeld
- Erscheinungsdatum
- 2015 (Februar)
- Schlagworte
- Onkologische Pflege Chronische Krankheit Gesundheitsdeterminant Coping Krankheitsbewältigung Palliativtherapie kurativ Linderung Symptom
- Produktsicherheit
- BACHELOR + MASTER Publishing