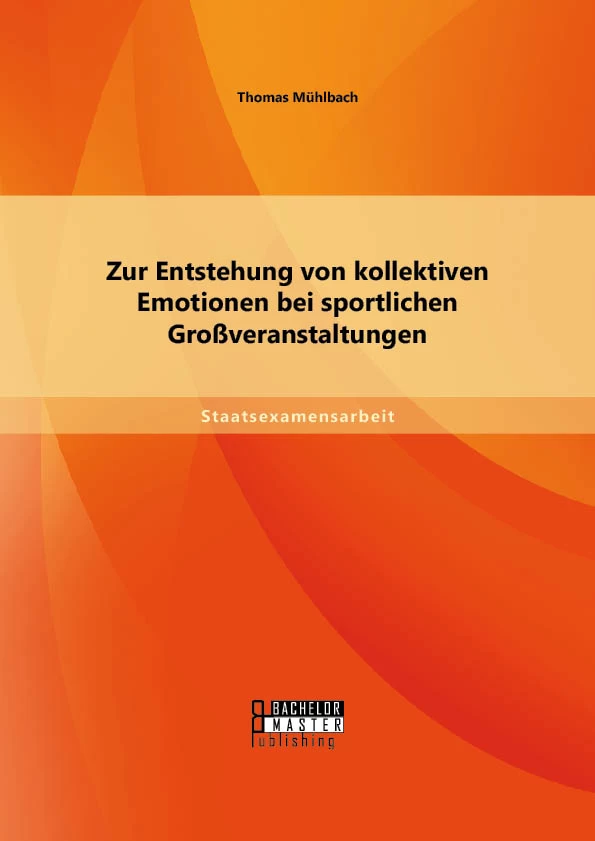Zur Entstehung von kollektiven Emotionen bei sportlichen Großveranstaltungen
©2013
Examensarbeit
70 Seiten
Zusammenfassung
Die vorliegende Studie beschäftigt sich mit dem gesellschaftlichen Phänomen von kollektiven Emotionen. Nachdem herausgearbeitet wird, was genau Emotionen sind und wie sie entstehen und wirken, werden soziologische Erklärungsansätze für Emotionen geschildert. Der Autor setzt sich mit den soziologischen Emotionsmodellen von Kemper (1978), Gerhard (1988) und Riedl (2006) auseinander, um auf Grundlage der Modelle Erklärungsansätze für kollektive Emotionen zu geben. Anschließend werden die Motive von Stadionbesuchern dargestellt und es wird eine Antwort auf die Frage gegeben, worin die Anziehungskraft von sportlichen Großveranstaltungen besteht.
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Tempo auf wie selten zuvor in diesem Spiel, Götze gibt die Richtung vor
und Reus ebnet mit einem wunderbaren Hackentrick den Weg für Le-
wandowski. Der Angreifer umkurvt Willy und sorgt mit seinem Treffer in
der 40. Spielminute für eine Eruption der Emotionen auf den Tribünen.
Halbzeit. Nach der Halbzeitpause steht das Spiel auf Messers Schneide.
Jedes Tor kann nun das Spiel entscheiden und so kommt, was kommen
musste und was den Dortmunder Signal Iduna-Park zum kollektiven
Schweigen bringt. Der FC Málaga schießt sich in der 82. Spielminute mit
2:1 in Führung. Das heißt nun für die Dortmunder, sie müssen in den
noch verbleibenden acht Spielminuten plus Nachspielzeit zwei Tore e r-
zielen, um noch das Halbfinale der UEFA-Champions League zu errei-
chen. Doch die Dortmunder Spieler finden kein Mittel gegen die Abwehr-
reihe von Málaga. Und jetzt, da die Nachspielzeit anbricht, hält es kein
Zuschauer im Stadion für möglich, das da noch etwas passiert. Doch jetzt
langer Ball von Hummels auf Subotic, Pass in die Mitte, aber Abpraller
vom Verteidiger vor die Füße von Reus und der schiebt ein ins leere Tor.
2:2. Geht hier noch was? Auf der Tribüne entwickelt sich eine leichte
Aufbruchsstimmung. Die Anfeuerungsrufe werden wieder lauter. Dort-
mund schlägt jetzt immer wieder den Ball in Richtung des gegnerischen
Strafraums. Die vierte Minute der Nachspielzeit bricht an. Wieder langer
Ball, doch auch der wird zum Einwurf geklärt. Einwurf auf Lewandowski,
der flankt in die Mitte. Unübersichtliche Situation. Santa fällt der Ball vor
die Füße und er drückt ihn über die Linie. TOOOOOORRRRR. 3:2 für
Dortmund. Das nicht mehr für möglich Gehaltene ist wahr: Borussia
Dortmund erzielt den benötigten Treffer. Das Stadion explodiert, alle
springen auf und jubeln. Über 60.000 Kehlen kreischen gemeinsam und
jeder umarmt jeden, egal ob man sich kennt oder nicht. Auch für meine
Begleiter und mich gibt es jetzt kein Halten mehr und das obwohl wir
keine Fans der Borussen sind. Der Schiedsrichter pfeift ab. Das Spiel ist
4
aus. Unbeschreiblicher Jubel, egal wo man jetzt hinschaut. Wie kann so
etwas passieren?
Wie kommt es zu solchen kollektiven Emotionen? Mit diesem gemein-
schaftlichen Phänomen wird sich die Arbeit beschäftigen. Im zweiten K a-
pitel der Arbeit werden Emotionen im Allgemeinen beschrieben und he r-
ausgearbeitet, was es mit Emotionen auf sich hat? Darauffolgend geht es
um die soziologischen Erklärungsansätze für Emotionen. In diesem Kap i-
tel wird sich mit den soziologischen Emotionsmodellen von Kemper
(1978), Gerhards (1988) und Riedl (2006) auseinandergesetzt, um im sp ä-
teren Verlauf dieser Arbeit, auf Grundlage der Modelle, Erklärungsansät-
ze für kollektive Emotionen zu geben.
Anschließend sollen die Motive von Stadionbesuchern dargestellt und
erklärt werden. Was macht die Anziehungskraft von sportlichen Großver-
anstaltungen aus? Wenn im Folgenden von einer Großveranstaltung ge-
sprochen wird, ist die Definition der Arbeitsgemeinschaft der Leiter der
Berufsfeuerwehren (AGBF) zu benutzen.
,,Veranstaltungen im allgemeinen Sinne sind organisierte Tref-
fen von Menschen über eine bestimmte Zeit an einem be-
stimmten Ort oder mehreren Orten gleichzeitig zu einem vor-
her festgelegten Zweck. Veranstaltungen werden zeitlich vor-
her geplant. Großveranstaltungen, neudeutsch häufig als
,,Event" vermarktet, sind solche Veranstaltungen mit einer sehr
großen Zahl von erwarteten Teilnehmern, wobei
a) diese von unterschiedlicher Nationalität, Sprache, sozialer
Schichtung, politischer Anschauung und religiösem Bekennt-
nis sein können und einen differenzierten kulturellen Hinter-
grund besitzen können,
b) die Einwohner ebenfalls besonders involviert sind,
c) die Veranstaltung von besonderer Bedeutung für die Region,
national oder sogar international ist,
5
d) die Veranstaltung meistens im Kern der Stadt oder auf b e-
sonderen Flächen angesiedelt ist.
Großveranstaltungen erfordern eine behördliche Genehmigung
sowie eine qualifizierte Zusammenarbeit der Behörden und
Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) mit den Veran-
staltern und anderen Beteiligten."(AGBF, 2009, S. 1)
Im fünfen Kapitel geht es um die kollektiven Emotionen, wie sie bei sportli-
chen Großveranstaltungen entstehen und welche Merkmale sie haben. Ab-
schließend wird das Phänomen der kollektiven Ekstase als extremste Form der
kollektiven Emotionen erläutert.
2
Was sind Emotionen
Das Wort ,,Emotion" leitet sich aus dem lateinischen Begriff ,,emovere"
ab, was so viel bedeutet wie herausbewegen bzw. emporwühlen (Kluge,
2011, S. 243). Im Allgemeinen sind Emotionen: ,,Vorkommnisse von z.B.
Freude, Traurigkeit, Ärger, Angst, Mitleid, Enttäuschung, Erleichterung,
Stolz, Scham, Schuld, Neid sowie von weiteren Arten von Zuständen, die
den genannten genügend ähnlich sind" (Meyer/ Schützwohl/ Reisenzein,
1993, S. 23).
Das Ausdrücken und Erleben von Emotionen ist in unserer Gesellschaft
und insbesondere in der Freizeit unumgänglich und erwünscht. Dies fällt
besonders bei Großveranstaltungen auf.
Für die Auseinandersetzung mit Emotionen scheint es notwendig zu sein,
die Ausmaße von diesen zu erklären. Denn wenn man sich mit Emotionen
befasst, stellt man schnell fest, dass der Begriff sehr viele Ebenen auf-
weist und die Begriffsdefinition sehr unterschiedlich sein kann. Somit
steht Anfangs die Eingrenzung des Emotionsbegriffs für die folgende
Verwendung im Vordergrund. Hierbei wird der Schwerpunkt auf soziolo-
6
gische Aspekte erfolgen. Danach soll geklärt werden, wie Emotionen so-
ziologisch entstehen und wie sie bedingt sind, wobei jedoch darauf geach-
tet werden soll, dass es nicht zu einer generellen Trennung zwischen der
psychologischen und der soziologischen Sichtweise kommt.
Emotionen wirken in erster Linie, als wären sie nur personengebundene
und personenbezogene Umstände, da sie ja auch von Einzelnen gefühlt
und erlebt werden. So sind nach Ciompi (1997, S. 67) Emotionen als eine
,,von inneren oder äußeren Reizen ausgelöste, ganzheitliche psycho -
physische Gestimmtheit von unterschiedlicher Qualität, Dauer und Be-
wusstseinsnähe."
Des Weiteren haben Emotionen auch immer einen physiologischen A s-
pekt. Beispielsweise können Menschen vor Scham erröten oder deren Puls
steigt bei Wut an. Durch die äußeren Reaktionen einer Person erkennen
wir als erstes, dass Emotionen im Spiel sind (Riedl, 2006, S. 91). Für die-
se Arbeit ist die psychologische Betrachtung der Emotionen nicht ausrei-
chend, da kollektive Emotionen ein soziales Phänomen darstellen. Diese
Arbeit soll keinen weitreichenden Überblick über den aktuellen Stand der
Forschung geben, sondern nur die für das Thema wichtigen Ausführungen
beleuchten. In diesem Sinne wird das Ziel verfolgt, die vorhandenen E r-
gebnisse zu selektieren und für den Erkenntnisgewinn der Ausarbeitung
zu nutzen.
So soll an dieser Stelle die Arbeit von Hochschild (1990, 1998) genann t
werden, da sie annimmt, dass ,,das Selbst" fähig ist, Gefühle zu erleben,
zu reflektieren und zu managen (Flam, 2002, S. 127). Hochschild führt
die Begriffe ,,Gefühlsarbeit" und ,,Gefühlsregeln" ein. Hiernach kommen
Emotionen zuerst auf der Mikroebene vor und werden dann durch die
Steuerung und die Macht von Organisationen und Eliten auf die Makro-
ebene weitergeleitet. Somit sind die Eliten einer Gesellschaft die gewäh-
rende Institution derselben.
7
Gerhards (1988) beschreibt in seiner ,,Soziologie der Emotionen", dass
sich das Individuum nicht der Kontrolle der Emotionen verschrieben hat.
Es versucht vielmehr, negative Emotionen zu vermeiden. Nach Ciompi
(1997, S. 239) ist damit gemeint, dass das Erreichen von angenehmen
Gefühlen zur gesellschaftlichen Norm wird (Ciompi, 1997, S. 239). Emo-
tionen sind Gerhards (1988) zur Folge immer das Resultat von sozialen
Konstellationen und den darauf folgenden Reaktionen. So jubeln Fans bei
einem positiven Ergebnis ihres Lieblings oder ihrer Lieblinge. Emotionen
beziehen sich demnach auf ein Ereignis, womit klar ist, dass bei der Ent-
stehung von Emotionen die Frage nach den sozialen Bedingungen gestellt
werden muss. Gleichzeitig geben unsere Emotionen aber auch den sozia-
len Zusammenhängen des täglichen Lebens Struktur. So entscheiden wir
oftmals im Alltag ,,aus dem Bauch heraus", ohne rationale Entscheidun-
gen zu treffen. Die Höhe der Wahrscheinlichkeit eines positiven Aus-
gangs des Spiels unseres Lieblingsteams entscheidet, ob wir das Spiel
besuchen oder nicht. So sind die Stadien erfolgreicher Mannschaften vo l-
ler als die von Mannschaften, die eher verlieren bzw. bei denen der An-
spruch der Zuschauer höher ist als die tatsächliche Siegwahrs cheinlich-
keit. Eine andere Dimension von Emotionen ist die der kulturellen Kodi e-
rung. Diese Kodierung ist zum Teil angeboren und zum Teil unserer S o-
zialisation geschuldet. Watson (1919) bewies schon Anfang des 20. Jahr-
hunderts mit einer Reihe von Experimenten an Kleinkindern, dass die
Kinder schon zu den drei grundlegenden Emotionen Liebe, Wut und
Trauer fähig sind. In dieser Studie stellte er auch fest, dass Emotionen
einer gewissen Konditionierung unterliegen und damit antrainierbar sind.
Die Art, wie äußere Reize wahrgenommen werden, kann sich mit fort-
schreitendem Alter verändern. So können Situationen, die bei Kleinkin-
dern Wut hervorrufen, bei Erwachsen zu Angst führen. Diese gelernten
kulturellen Kodierungen entstehen durch Wertebildungen und gesell-
schaftliche Normen früherer Generationen, die sich im Laufe der Zeit ma-
8
nifestiert haben (Tritt, 1992, S. 168). Damit scheinen Emotionen ein we-
sentlicher Bestandteil unseres gesellschaftlichen Lebens zu sein.
Dennoch ist dieses Feld nicht einfach zu bearbeiten, da auch andere Fak-
toren eine erhebliche Rolle spielen. Schmidt (2005, S. 16) bemerkt aber,
dass es nicht wichtig ist, ob Emotionen hauptsächlich biologische oder
soziale Phänomene sind, sondern wie diese Faktoren bei der Entstehung
von Emotionen zusammenwirken. So stehen die biologischen und sozia-
len Faktoren der Emotionsentstehung, des Ausdrucks, des Auslebens und
der Bewertung von Emotionen in engem Zusammenhang. Diese Faktoren
bedingen einander und sind in einer dynamischen Gesamtstruktur mite i-
nander verbunden. So kann das Individuum nicht unterscheiden, ob eine
Emotion kognitiv, biologisch, körperlich oder soziokulturell entstanden
ist (Schmidt, 2005, S. 16).
,,Emotion ist ein seltsames Wort. Fast jeder denkt, er versteht, was es
bedeutet. Bis er versucht es zu definieren. Dann behauptet praktisch
niemand mehr es zu verstehen." (Wenger, Jones und Jones 1962 , S. 3,
zit. nach Schmidt-Atzert, 1996, S. 18)
Da es bisher keine Einigkeit über eine allgemein gültige Definition gibt,
ist diese Feststellung von Wenger, Jones und Jones sehr treffend.
In unserer Gesellschaft und Umgangssprache verbinden wir mit dem Wort
Emotionen zwei unterschiedliche Dinge. Zum einen bezieht sich die Be-
deutung des Wortes auf das Erleben, z.B. wenn jemand sagt, sie oder er
sei traurig. Dafür sollte lieber der Überbegriff ,,Gefühl" verwendet wer-
den. Die zweite Bedeutung ist vielschichtiger, sie impliziert neben dem
Gefühl auch den körperlichen Zustand und den Ausdruck. Schmidt-Atzert
(1996, S. 18ff.) verweist darauf, dass schon McDougall (1923) auf eine
Notwendigkeit der Unterscheidung von Gefühl und Emotion hingewiesen
hat und Carlson und Hatfield (1992) angemerkt haben, dass Psychologen
in ihren Definitionen eher die einzelnen Aspekte von Emotionen betonen.
Dabei vergleichen sie die Definitionsbildung von Emotionen mit blinden
9
Menschen, die einen Elefanten berühren und diesen Elefanten danach be-
schreiben. Der Elefant verändert bei jedem von ihnen seine Gestalt, da
diese davon abhängig ist, an welcher Stelle der Elefant berührt wurde.
Kleinginna und Kleinginna (1981) haben 92 Definitionen zusammenge-
tragen und versucht, diese in zehn verschiedene Kategorien einzuteilen
(Schmidt-Atzert, 1996, S. 18ff.). Dies beweist, dass es, wie bereits er-
wähnt, etliche verschiedene und nur in einzelnen Bereichen überschnei-
dende Definitionen für Emotionen gibt. Eine exakte Definition ist nicht
die Voraussetzung, sondern Resultat wissenschaftlicher Anal ysen. Somit
ergibt sich die Notwendigkeit, je nach Forschungsschwerpunkt eine Ar-
beitsdefinition anzufertigen. Diese soll unkontrovers und für möglichst
viele Forscher akzeptabel sein. Die Arbeitsdefinition dient zur Phän o-
menbeschreibung und zur Abgrenzung des Forschungsgebietes. Somit
verhindert sie eine Ausweitung der Vielfalt der Themen, die unter dem
Stichwort der Emotionen behandelt werden und ermöglicht damit eine
ungefähre Beschreibung von Emotionen. Die Arbeitsdefinition versucht
möglichst allen theoretischen Annahmen gerecht zu werden und hat nur
vorläufigen Charakter, damit sie dem aktuellen wissenschaftlichen Stand
angepasst werden kann. Es gibt nun zwei grobe Zugänge für eine Ar beits-
definition. So können nur Emotionen beispielhaft genannt werden oder es
wird nach definierenden Merkmalen gesucht (Schmidt-Atzert, 1996, S.
18).
Festzuhalten ist also, dass es nicht die eine Definition von Emotionen
gibt, sondern dass man sich aufgrund der Vielzahl auf eine Arbeitsdefini-
tion einigt, die zur Untersuchung der Forschungsthese dienlich ist. Für
diese Arbeit ist es aber nicht wichtig, eine eigene allgemein gültige Defi-
nition zu entwerfen, sondern das Feld der Emotionen etwas zu systemati-
sieren.
Meyer, Schützwohl und Reisenzein (1993, S. 22ff.) geben eine allgemein
gehaltene Definition zu Emotionen. Auf diese Grundlage stützte Riedl
10
(2006, S. 93ff.) seine Überlegungen zu einem emotionssoziologischen
Modell zur Steuerung des Emotionserlebens im Publikum.
Nach Meyer, Schützwohl und Reisenzein (1993, S. 24ff.) gibt es vier
Merkmale von Emotionen:
1.
Emotionen sind aktuelle Zustände von Personen
2.
Emotionen unterscheiden sich nach Qualität und Intensität
3.
Emotionen sind in der Regel objektgerichtet
4.
Emotionen haben einen Erlebnisaspekt, Verhaltensaspekt und phy-
siologischen Aspekt
Die aktuellen psychischen Zustände einer Person dienen der Abgrenzung
ihrer allgemeinen ,,emotionalen Disposition", also ihrer überdauernden
Personenmerkmale. Eine emotionale Situation ist meist ein relativ kurzer
und zeitlich geschlossener Zustand. Mit emotionaler Disposition ist nun
die erhöhte Bereitschaft bzw. Neigung zu emotionalen Zuständen g e-
meint. In der ,,emotionalen Disposition" geht es um die Voraussetzung,
die ein Mensch mitbringt, um auf Situationen emotional zu reagieren
(Meyer/ Schützwohl/ Reisenzein, 1993, S. 25f.). Es geht um seine Um-
weltbedingungen, mit welcher Voraussetzung die Person in eine Situation
geht. Ist sie verliebt oder gibt es generelle Ablehnung zu solchen Situat i-
onen aus Vorerfahrungen? Als Beispiel hierfür sind Personen zu nennen,
die in ähnlichen Situationen immer mit Angst reagieren oder schnell reiz-
bar sind, also sich schneller über Dinge ärgern als andere in vergleichba-
ren Situationen. ,,Emotionale Dispositionen" können sehr ,,objekt- oder
situationsspezifische", kurz andauernde emotionale Zustände sein. Sie
können aber auch zu sehr ,,globalen" bzw. ,,generellen Anlagen" werden.
So kann aus einer Verliebtheit für einen Abend eine lebenslange Liebe
werden. Sie kann aber auch nach dem Abend wieder verflogen sein und
aus dieser Disposition der Liebe ergeben sich unterschiedliche emotionale
Zustände (Meyer/ Schützwohl/ Reisenzein, 1993, S. 25f.).
11
Das zweite Merkmal der Emotionen nach Meyer, Schützwohl und Reisen-
zein (1993) soll konkrete Emotionsgeschehnisse gruppieren, dabei we r-
den sie zu Typen oder Klassen zusammengefasst. Qualität meint in die-
sem Zusammenhang die Ausprägung der Emotion, also ob sie positiv oder
negativ ist. Die Qualitätstypen sind z.B. Freude, Angst, Wut, Liebe, Är-
ger, etc.
Emotionen besitzen immer eine unterschiedlich starke Ausprägung, somit
werden sie von schwach bis stark charakterisiert, nachdem ihre Qualität
gekennzeichnet wurde. Beispiele hierfür wären schwache, mittlere, ex t-
reme Angst, also z.B. eine Tierphobie, die unterschiedliche Intensitäten
haben kann (Meyer/ Schützwohl/ Reisenzein, 1993, S. 24f.).
Bei der Intensität geht es in diesem Zusammenhang um das zeitliche An-
halten einer Emotion. Emotionen haben einen sehr unterschiedlichen zeit-
lichen Verlauf, womit sie je nach Intensität einen anderen zeitlichen Ab-
lauf besitzen. Sie können z.B. langsam oder schnell zum Intensitätsmaxi-
mum kommen (Meyer/ Schützwohl/ Reisenzein, 1993, S. 24).
Emotionen beziehen sich immer auf etwas. Man kann Angst vo r etwas
haben, sich über etwas freuen, jemanden lieben oder um jemanden t rau-
ern. Dieser Bezugspunkt stellt immer das Objekt dar, das nicht real exis-
tieren muss. Daher können wir Angst oder Freude vor zukünftigen Ereig-
nissen haben, z.B. können wir uns auf einen Urlaub freuen oder Angst vor
Prüfungen haben. In diesen Fällen kann der Urlaub z.B. verregnet und das
Hotel schlecht sein. Die Prüfung kann bestanden werden, vielleicht sogar
mit sehr gut. Die Angst bzw. die Freude hätten sich dann als nicht richtig
herausgestellt. Entscheidend hierfür ist, dass die Person der Überzeugung
bzw. Meinung ist, dass Sachverhalte und Ereignisse existieren, stattge-
funden haben oder sich im Bereich des Möglichen befinden. Es geht also
um die Vorstellbarkeit, nicht aber um die reale Existenz von Ereignissen.
Natürlich sind die Objekte meist trotzdem existent: So ist die Freude über
12
den Sieg des eigenen Teams komplett real (Meyer/ Schützwohl/ Reisenz-
ein, 1993, S. 26f.).
Eine Emotion hat immer verschiedene Aspekte. Personen, die sich in
emotionalen Zuständen befinden, haben ein charakteristisches Erleben.
Dies ist der Erlebnisaspekt von Emotionen und somit die subjektive
Komponente, welche auch als Gefühl bezeichnet wird. Daher werden
emotionale Menschen als heißblütig beschrieben, weil sie emotionaler
sein sollen als andere. Daraus folgt, dass sich Emotionen scheinbar auf
charakteristische Weise von anderen bewussten Zuständen unterscheiden
(Meyer/ Schützwohl/ Reisenzein, 1993, S. 27ff.).
Bei der Anwesenheit von Emotionen treten auch häufig bestimmte kö r-
perliche Veränderungen auf. Diese als ,,peripher-physiologischen Verän-
derungen" bzw. Reaktionen bekannten Zustände finden in der Peripherie
des Nervensystems statt. Zu ihnen gehören z.B. Erröten, Veränderung des
Pulses, Schwitzen der Hände, Atmungsveränderung, etc. Diese Veränd e-
rungen sind nicht aktiv gesteuert, sondern sie geschehen im unwillkürli-
chen und autonomen Teil des Nervensystems. Sie können auch viszerale
Veränderungen genannt werden, da sie vor allem die inneren O rgane und
Drüsen betreffen. Dies ist der physiologische Aspekt von Emotionen
(Meyer/ Schützwohl/ Reisenzein, 1993, S. 30).
Der Verhaltensaspekt der Emotionen umfasst zwei Teilaspekte. Der ex-
pressive oder auch Ausdrucksaspekt, ist für die Gegenüber klar sichtbar
und geht meist mit einem unwillkürlichen Ausdrucksverhalten einher.
Dazu gehören die Mimik und Gestik, die Körperhaltung und Körperorie n-
tierung, unwillkürliche Körperbewegungen und eine mögliche Verände-
rung der Sprechstimme. Hingegen umfasst der instrumentelle bzw. Hand-
lungsaspekt zielgerichtete Handlungen bei Emotionen, so z.B. ein direk-
tes Angriffsverhalten bei einer Wut-Situation (Meyer/ Schützwohl/ Rei-
senzein, 1993, S. 30f.).
13
Den für diese Arbeit wichtigsten Punkt nennen Meyer, Schützwohl und
Reisenzein in ihrem dritten Merkmal. Emotionen haben immer einen Ob-
jektbezug. Wie erwähnt muss dieser nicht der Realität entsprechen, die
momentane Auffassung einer Person ist dafür von Bedeutung. Den Ver-
haltens- und physiologischen Aspekt des vierten Merkmals bemerken wir,
wenn z.B. das Herz vor Wut zu rasen anfängt. Nach Gerhards sind Emoti-
onen
,,eine positive oder negative Erlebnisart des Subjektes, eine subje k-
tive Gefühlslage, die als angenehm oder unangenehm empfunden
wird. Emotionen entstehen als Antwort auf eine Bewertung von
,,Stimuli und Situationen", sie können mit einer physiologischen Er-
regung einhergehen und können in Form von Emotionsexpressionen
zum Ausdruck gebracht werden. Sie wirken selbst wieder struktu-
rierend auf den sozialen Zusammenhang zurück."
(Gerhards, 1988,
S. 16)
Emotionen werden demnach subjektiv beschrieben. Sie können positiv
oder negativ erlebt werden, je nach dem eigenen Empfinden. Sie sind da-
mit Reaktionen auf und Folge von Situationsinterpretation auf Zustände
und Reize. Daraus folgt, dass dieselbe Situation von unterschiedlichen
Personen unterschiedlich bewertet werden kann. Ein Tor bei einem Spiel
ist für die eine Person eine Situation des Glücks und für eine andere ein
Grund zur Trauer. Je nach Bewertung können physiologische Erregung
und Gefühlsausbrüche daraus resultieren, diese sind aber nicht zwingend
notwendig. Im Gegenzug strukturieren Emotionen selbst den sozialen In-
teraktionszusammenhang, aus dem sie entstanden sind (Gerhards, 1988,
S. 16ff.).
Cordsen und Deilmann (2005) sehen die Entstehung von Emotionen als
einen
,,sukzessiven, kognitiven Verarbeitungsprozess in der Gegen-
wart wahrgenommener Reize [...], aus dem eine spezifische
Reaktion resultiert im Rückgriff auf in der Vergangenheit
14
erworbenes Wissen und orientiert an in der Zukunft liegenden
Wünschen und Handlungszielen." (Cordsen/ Deilmann, 2005,
S. 314)
Damit ergänzen sie Gerhards` Definition um weitere wichtige Punk-
te. Bei ihnen kommt das zeitliche Element zum Vorschein. Emotio-
nen geschehen demnach zeitnah, können aber durch Erfahrungen in
der Vergangenheit sowie in der Zukunft liegende Ziele kognitiv b e-
einflusst werden. Diese Definitionsversuche von Emotionen vermit-
teln zunächst ein ausreichendes Grundverständnis. Auf der einen
Seite steht mit Meyer, Schützwohl und Reisenzein eine psychologi-
sche Perspektive und auf der anderen Seite werden von Gerhards
sowie Cordsen und Dielmann sozialkonstruktivistische Aspekte auf-
gegriffen.
Eine wichtige Hilfestellung zur Ordnung der strukturellen Komponenten
bietet Schmidt (2005) mit der von ihm vertretenen Differenzierung der
Bezugnahme auf das Emotionsgeschehen in fünf Ebenen:
,,die neuronale Ebene im Hinblick auf körperliche Grundlagen
und Prozesse; die psychische Ebene im Bezug auf das bewuss-
te Erleben von Gefühlen; die kognitive Ebene hinsichtlich des
Wissens von Emotionen; die kommunikativ-mediale Stufe im
Hinblick auf die Emotionsperformanz in allen ihren Aspekten
und die soziokulturelle Ebene, die sich auf den Stellenwert, die
Interpretation und Bewertung von Gefühlen im individuellen
wie im gesellschaftlichen Bereich bezieht." (Schmidt, 2005, S.
26)
Für Schmidt (2005, S. 27) gibt es zwei Richtungen von Bezugnahmen von
Emotionen auf Referenzbereiche. Zum einen gibt es die Richtung des
Körpers, des Gehirns, des Bewusstseins und der Kognition, zum anderen
die Richtung der Sprache, der Kommunikation, der Gesellschaft und der
Kultur.
15
Die für diese Arbeit wohl beste Erklärung zu Definitionen bietet Lyon
(1995, S. 244). Für sie sind Emotionen (mit ihrem Ausdruck, ihren Ge-
fühlen, Motivationen und ihrer Darstellung) das Produkt der jeweiligen
Perspektive des kulturellen Konstrukts, welches durch die individuelle
Sozialisation und Erfahrung in einem bestimmten soziokulturellen Kon-
text geschieht. Es lässt sich schließlich festhalten, dass aus der großen
Menge an soziologischen Perspektiven zum Thema Emotionen ein be-
stimmter Bereich gefunden wurde. So sind in diesem Zusammenhang im
Sinne der sozialkonstruktivistischen Denkweise Emotionen als Ergebnis
und auch als Reaktion auf soziale Konstellationen zu verstehen. Wie er-
wähnt wird das Erleben von Emotionen als subjektiv und als positiv oder
negativ beschrieben. Emotionen geschehen zeitnah, können aber durch
Erfahrungen in der Vergangenheit sowie in der Zukunft liegende Ziele
kognitiv beeinflusst werden. Im Folgenden werden die Komponenten
Kommunikation und Kultur schwerpunktmäßig erfasst, wobei Emotionen
generell als multikomplexes System verstanden werden, welches in seiner
Ganzheit kaum zu erfassen ist.
3
Emotionssoziologische Erklärungsansätze
Im folgenden Kapitel soll nun ein Überblick über drei wichtige soziolog i-
sche Emotionsmodelle gegeben werden. Diese Modelle sollen nicht zu
einem eigenen Model führen, sondern als Erklärungsansätze für kollekti-
ve Emotionen dienen. Die drei Modelle sind die sozialkonstruktivist i-
schen Arbeiten von Kemper (1978), Gerhards (1988) und Ried l (2006).
Die Arbeit von Kemper stellt hierbei den Ausgangspunkt dar, wird durch
Gerhards Gedanken ergänzt und im Folgenden durch Riedls Aspekt der
Kommunikation als strukturelle Kopplung zwischen psychischen und s o-
zialen Systemen vervollständigt.
16
Für Gerhards (1988) sind Emotionen das Ergebnis sozialer Beziehung s-
muster, aber auch gleichzeitig die ,,Konstrukteure der Wirklichkeit". Die-
se Überlegungen stützt er auf die ,,Social Interactional Theory of Emoti-
ons von Kemper (1978).
3.1
Das emotionssoziologische Strukturmodell von
Kemper
Diese Theorie schließt für Kemper den Raum zwischen der Makro-und
Mikrosoziologie, da er Gefühle zum Produkt, aber auch zur Quelle sozia-
ler Verhältnisse macht (Flam, 1999, S. 183). Für Kemper führen soziale
Situationen zu spezifischen physiologischen Zuständen, welche spezifi-
sche Emotionen auslösen. Er unterscheidet drei intervenierende Interakti-
onsebenen: die Sozialstruktur, die Emotionen und die Physiologie (Flam,
2002, S. 134ff.; vgl. Gerhards, 1988, S. 124). Kemper versucht die Ver-
knüpfung dieser drei Ebenen in seinen Arbeiten zu erläutern. Die Dime n-
sionen Macht und Status sind für Kemper (1978, S. 26-42) die elementa-
ren im Bereich des Sozialen. Er bemerkt, dass alle Interaktionen zwischen
zwei Individuen mit diesen Dimensionen erklärt werden können. Emoti o-
nen resultieren demnach aus dieser realen, vorgestellten oder antizipierten
Stellung im sozialen Raum. Als jede Chance innerhalb einer sozialen Be-
ziehung den eigenen Willen durchzusetzen definiert Kemper (1978, S. 29)
die Machtdimension. Diese Machtdimension impliziert ein gehorsames
und unterwürfiges Verhalten. Im Bereich der Statusdimension hingegen
geht es um die Gewährung von Akzeptanz, Achtung oder Sympathie, also
eher um positive Verhaltensweisen. Des Weiteren sind in der Statusdi-
mension gebende, unterstützende und liebevolle Aktionsweisen vorhan-
den (Riedl, 2006, S. 108). Für Kemper sind nur die Mächtigen der Gesell-
schaft in der Lage, die Macht- und Statusdimension zu ordnen (Flam,
2002, S. 150). Auf der eben beschriebenen Grundlage entwickelte Kemp-
17
er ein aus wenigen Elementen bestehendes Modell, mit dem er Emotionen
beschreiben kann. Im idealen Zustand gibt es demnach nur zwei mitei-
nander agierende Akteure, welche er als Ego (lat. Ich) und Alter (lat. der
Andere) bezeichnet. Egos Emotionen sind ein Ergebnis der Position im
sozialen Raum und der Bewertung des eigenen Verhaltens und des Ver-
haltens von Alter. Dies teilt Kemper in die Dimensionen exzessiv, ad ä-
quat oder insuffizient ein.
Kemper erweitert diese Grundstruktur des Modells um einen dritten Ak-
teur, dieser wird als ,,agency" bezeichnet. Mit der dritten Komponente ist
eine weitere Variable benannt, die dann zum Einsatz kommt, wenn Ego
weder sich selbst noch seinem Gegenüber die Verantwortung zuschiebt.
Sie kann sowohl ein konkretes Individuum sein, als auch eine unpersönli-
che Kraft wie ,,das System", ,,das Schicksal", ,,Gott", ,,die Krankheit",
,,das Alter" (Kemper 1978, S. 44f.). In Abhängigkeit der Verantwortungs-
zuschreibung verspürt der Akteur unterschiedliche Emotionen, was an
folgendem Beispiel von Kemper veranschaulicht wird. Wenn Person A
Person B liebt, B aber das Interesse an A verliert, dann hängen die Emo-
tionen von A davon ab, wem sie diese Veränderung zuschreibt. Sieht sie
die Ursache in eigenen Fehlern, wird sie Selbstmitleid empfinden. Wenn
sie diese eher der Unentschlossenheit von B zuschreibt, wird sie sich über
diese ärgern. Falls sie das wachsende Interesse von einer Person C an B
als Ursache ansieht, ist sie eifersüchtig auf C. A kann diese drei Emotio-
nen auch gleichzeitig empfinden, wenn sie alle beteiligten Akteure als
Auslöser betrachtet (Kemper, 1978, S. 45f.).
Somit können durch die unterschiedlichen Variablen und der daraus resul-
tierenden Menge an Kombinationsmöglichkeiten unterschiedliche Emot i-
onen bei den Personen hervorgerufen und damit ihre Entstehung erklärt
werden (Kemper, 1978, S. 50-69). Das Modell in Abbildung 1 ist eine
Zusammenfassung von Gerhards (1988, S. 130) beruhend auf dem Modell
18
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Erstausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2013
- ISBN (Paperback)
- 9783958201132
- ISBN (PDF)
- 9783958206137
- Dateigröße
- 2.2 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Philipps-Universität Marburg
- Erscheinungsdatum
- 2015 (Februar)
- Note
- 1,7
- Schlagworte
- Kemper Strukturmodell Emotionserleben Unterhaltung Gemeinschaft
- Produktsicherheit
- BACHELOR + MASTER Publishing