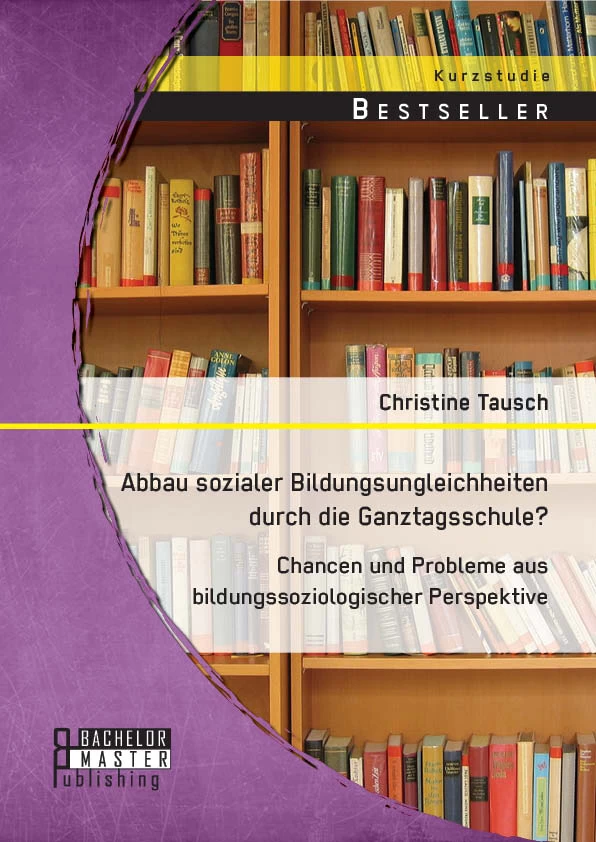Abbau sozialer Bildungsungleichheiten durch die Ganztagsschule? Chancen und Probleme aus bildungssoziologischer Perspektive
Zusammenfassung
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
2.2 Bildung als zentrale Dimension sozialer Ungleichheit
Bildung ist eine zentrale Dimension sozialer Ungleichheit. Sie ist nicht nur „Inbegriff menschlicher Selbstentfaltung und Selbstverwirklichung“ (Büchner 2003: 8), sondern stellt über formale Bildungsnachweise eine Voraussetzung zum Zugang zu qualifizierten Berufspositionen dar. Der Zusammenhang zwischen höheren Bildungsabschlüssen und besseren Lebenschancen ist dabei klar erwiesen, denkt man etwa an höhere Einkommenschancen, niedrigeres Risiko von Arbeitslosigkeit und höheres Prestige (vgl. Geißler 1994: 112-115; Hradil 2001: 152). Ungleiche wirtschaftliche und soziale Positionen werden also wesentlich durch Bildung vermittelt. Ungleiche Bildungserfolge sind jedoch nicht per se ungerecht. Als Prinzip der Verteilung knapper Positionen ist in demokratischen Gesellschaften die Leistungsgerechtigkeit anerkannt: Akzeptiert werden ungleiche Bildungserfolge samt ihrer Folgen dann, wenn sie auf unterschiedlichen individuellen Leistungen beruhen. Das Prinzip der Chancengleichheit kann daher als elementare Grundanforderung an das Bildungssystem betrachtet werden. Es verlangt nicht die Gleichheit der Bildungserfolge, erschöpft sich aber auch nicht in einer bloß formalen Gleichheit beim Zugang zu Bildung. Vielmehr erfordert Chancengleichheit, dass leistungsfremde Faktoren keinen Einfluss auf den Zugang zu Bildung und den Erwerb von Bildungsabschlüssen haben. Dies verlangt auch, dass unterschiedliche Startbedingungen, die beim Eintritt in die Schule etwa aufgrund von familiären Merkmalen gegeben sind, durch die Schule nicht reproduziert, sondern ausgeglichen werden müssen (vgl. Becker 2004: 165f.; Merten 2005: 114-117).
Problematischer ist die Forderung nach proportionaler Chancengleichheit, nach der der Anteil sozialer Gruppen an den unterschiedlichen Bildungsgängen ihrem Bevölkerungsanteil entsprechen soll. Dies setzt voraus, dass Begabung von dem jeweiligen sozialen Merkmal unabhängig ist. Für Merkmale wie Ethnie und Geschlecht erscheint dies angemessen, nicht jedoch für die soziale Herkunft: Wenn Bildungserfolg lediglich von der individuellen Leistung abhinge, würden Personen mit hoher Leistung tendenziell auch einen hohen sozialen Status erreichen. Individuelle Leistung geht aber unter anderem auf Begabungen zurück, die zumindest teilweise auf die Kinder vererbt werden (vgl. Hradil 2004: 132f.).
Die Betrachtung sozialer Bildungsungleichheit bleibt in dieser Arbeit auf den Bereich der allgemeinbildenden Schulen beschränkt, da dieser auf die Verteilung von Lebenschancen einen größeren Einfluss hat als die darauf aufbauende Tertiärbildung. Schulen haben in modernen Gesellschaften – neben der schon beschriebenen Statuszuweisungsfunktion – weitere wichtige Aufgaben zu erfüllen: sie leisten die Qualifizierung der nachfolgenden Generation, sie sozialisieren diese, indem sie zur Bewältigung des Alltags und der Entwicklung einer eigenständigen Persönlichkeit nötige Kenntnisse vermitteln (vgl. Hradil 2001: 149f.), und sie sollen einen Konsens von Grundwerten und Umgangsformen in der Gesellschaft sicherstellen (vgl. Hurrelmann 2002: 214f.; Hradil 2004: 134).
3.Ungleichheit der Bildungschancen in Deutschland
Die PISA-Studie bestätigte den von der Bildungsforschung seit langem nachgewiesenen Fakt, dass in Deutschland „Schule ganz erheblich und unverändert mit zur ‚sozialen Vererbung’ von sozialen Ungleichheiten“ beiträgt (Merten 2005: 120). Im Folgenden sollen zunächst Ausmaß und Struktur dieser Ungleichheiten und danach zentrale theoretische Erklärungsansätze vorgestellt werden. Abschließend wird versucht, die höchst komplexen Ursachenzusammenhänge mit Blick auf den heutigen Erkenntnisstand der Forschung zusammenfassend zu skizzieren.
3.1 Ausmaß der Ungleichheit
Bereits in den 1960er-Jahren wurden die großen sozialen Disparitäten der Bildungsbeteiligung in Deutschland erkannt und standen im Mittelpunkt der Bildungsreformen. Diese förderten die bereits in den 1950er-Jahren einsetzende Ausweitung höherer Schulbildung, die sogenannte Bildungsexpansion. 1960 verließen 17 % der Schulabgänger ohne Abschluss die Schule, 54 % erwarben einen Hauptschulabschluss, 15 % einen Realschulabschluss, und nur 6 % machten Abitur. Mitte der 1990er-Jahre blieben nur noch etwa 8 % ohne Abschluss, 23 % erwarben lediglich einen Hauptschulabschluss, während 39 % mit der mittleren Reife und 30 % mit der Hochschulreife die Schule verließen (vgl. Hradil 2001: 158). Die Bedeutung von Schulabschlüssen wurde zwar einerseits aufgewertet, da ein höheres Bildungsniveau immer stärker Voraussetzung für den Zugang zu höheren beruflichen Stellungen wurde. Andererseits verminderte sich im Sinne einer „Bildungsinflation“ der Wert der einzelnen Schulabschlüsse (vgl. Geißler 1994: 115f.). Im besonderen Maße gilt dies für den Hauptschulabschluss, der heute nur noch in geringem Maße Zugang zum Arbeitsmarkt ermöglicht (vgl. Solga/Wagner 2004).
Von der Bildungsexpansion profitierten zwar Kinder nahezu aller Berufs-, Einkommens- und Bildungsschichten. Dennoch blieben die ungleichen Bildungschancen zwischen den Schichten weitgehend stabil[1] – anders als die vormals starke Bildungsbenachteiligung von Mädchen, die mittlerweile jedenfalls im Bereich der allgemeinbildenden Schulen tendenziell ins Gegenteil verkehrt wurde (vgl. Zinnecker/Stecher 2005: 300f.). Soziale Disparitäten wurden von der Bildungsforschung nicht erst seit der PISA-Studie empirisch vielfach nachgewiesen. So besuchten 2003 27 % der Beamtenkinder, 22 % der Kinder von Angestellten und von Selbständigen, aber nur 11 % der Kinder von Arbeitern im Alter von 15-18 Jahren die gymnasiale Oberstufe (vgl. Rauschenbach 2005: 6).
Neben dem beruflichen Status der Eltern erweist sich auch der Bildungsgrad der Eltern als bedeutsam für die Chancen von Kindern, an höheren Bildungsgängen zu partizipieren. Eine weitere Determinante sozialer Bildungsdisparitäten ist das Einkommen der Eltern. Zudem bestehen – im Vergleich zu den 1960er-Jahren allerdings geringer gewordene – Disparitäten zwischen verschiedenen Regionen, insbesondere ein Stadt-Land-Gefälle der Bildungschancen (vgl. Hradil 2001: 165-169). Besonders benachteiligt sind Kinder mit Migrationshintergrund, die überdurchschnittlich an Hauptschulen und Sonderschulen vertreten sind und in weit höherem Maße als deutsche Schüler lediglich mit einem Hauptschulabschluss oder ohne Schulabschluss von der Schule abgehen (vgl. Diefenbach 2004).
Niedrigere soziale Herkunft, gemessen am sozioökonomischen Status der Eltern, schlägt sich nicht nur darin nieder, dass ein deutlich geringerer Anteil dieser Kinder das Gymnasium besucht. Vielmehr zeigen sich auch Unterschiede im Schulerfolg sowie den Schulleistungen. Bei Betrachtung des Schulerfolges zeigt sich, dass niedrigerer Berufs- und Bildungsstatus der Eltern mit schlechteren Noten in den einzelnen Bildungsgängen einhergehen (vgl. Zinnecker/Stecher 2005: 301). Die PISA-Studie 2000 stellte für Deutschland einen im internationalen Vergleich sehr hohen Abstand zwischen den mittleren Lesekompetenzen von Schülern mit höherem und niedrigerem Sozialstatus fest (vgl. Baumert/Cortina/Leschinsky 2003: 130f.). Dieses Bild ändert sich auch bei Kontrolle der kognitiven Grundfähigkeiten nicht wesentlich, so dass die Leistungsunterschiede eindeutig von sozialen Faktoren bestimmt werden und nicht lediglich von Begabung- und Leistungsfähigkeitsunterschieden abhängen (vgl. Merten 2005: 120). Ähnlich wies bereits die TIMS-Studie[2] 1995 nach, dass „Schüler mit höherem [sozioökonomischen, C.T.] familiären Hintergrund einen statistisch signifikanten Leistungsvorsprung“ (Schütz/Wößmann 2005: 18) aufweisen und dieser Leistungsvorsprung in Deutschland besonders stark ausgeprägt ist.
3.2 Erklärungsansätze
Zur Erklärung der sozialen Ungleichheit der Bildungsbeteiligung werden in der Forschung eine Reihe von Faktoren angeführt. Konsens ist, dass „soziale Ungleichheiten von Bildungschancen von der Elterngeneration auf die Generation der Kinder weitergetragen werden“ (Becker/Lauterbach 2004a: 11). Eine in sich geschlossene Theorie ungleicher Bildungsbeteiligung, die alle Ursachen berücksichtigt, gibt es jedoch bislang nicht (vgl. Geißler 1994: 133f.). Besonders bedeutsame theoretische Grundlagen wurden von Bourdieu und Boudon entwickelt. Bourdieu macht auf die Reproduktion sozialer Unterschiede über kulturelle Mechanismen aufmerksam, während Boudon und die in seiner Tradition stehenden Bildungssoziologen die Bedeutung familialer Sozialisation und Wahlentscheidungen hervorhebt (vgl. Vester 2005: 13). Beide Richtungen sollen hier vorgestellt werden.
3.2.1 Boudon
Raymond Boudons bildungssoziologische Arbeiten setzen an den Entscheidungen der Eltern zur Bildung ihrer Kinder an. Bildung wird als Investition verstanden, die primär das Ziel verfolgt, den bisherigen sozialen Status in der Kindergeneration wenigstens zu erhalten. Eltern werden solange in die Bildung ihrer Kinder investieren, wie der daraus entstehende Bildungsnutzen die Bildungskosten übersteigen. Zum Bildungsnutzen zählen der Statuserhalt sowie die aus der zusätzlichen Bildung zu erwartenden Einkommen. Allerdings berücksichtigen die Eltern zusätzlich noch das Risiko, dass ihr Kind keinen Bildungserfolg haben wird. Grundlage der elterlichen Entscheidungen ist also eine rationale Abwägung von (erwarteten) Kosten und Nutzen unter den Restriktionen, die durch soziale Position und Ressourcen der Familie bestimmt werden (vgl. Becker 2004: 167-169).
Zu diesen Einschränkungen gehören „primäre Herkunftseffekte“, mit denen die schichtspezifischen Unterschiede in der familialen Sozialisation erfasst werden. Eltern höherer Sozialschichten sind eher in der Lage, ihren Kindern mittels Erziehung, Förderung und Ausstattung die für Schulerfolg nötigen Voraussetzungen mitzugeben. Kinder aus höheren sozialen Schichten weisen daher tendenziell bessere Schulleistungen auf, während Kinder aus der Unterschicht geringere kognitive und sprachliche Fähigkeiten haben (vgl. Becker/Lauterbach 2004: 12f.).
Daneben wirken als „sekundäre Herkunftseffekte“ die Bildungsentscheidungen der Eltern. Boudon zufolge variieren diese deutlich nach sozialer Herkunft (vgl. Becker 2004: 167-171). Dies liegt in den geringeren ökonomischen Ressourcen von Eltern niedriger Schichten begründet. Eine Rolle spielt auch, dass Eltern höherer Schichten Bildung als wesentlich für den Statuserhalt erachten, während Eltern niedrigerer Schichten wenig für den Statuserhalt investieren müssen, Bildungsinvestitionen in der Hoffnung auf sozialen Aufstieg für sie aber recht riskant erscheinen.
3.2.2 Bourdieu
Pierre Bourdieu, der seit den 1960er-Jahren intensiv die soziale Ungleichheit der französischen Gesellschaft erforschte, erklärt den Fortbestand sozialer Ungleichheit aus klassenspezifischen Kulturformen. Bourdieu hält am Klassenbegriff fest, differenziert aber den Begriff des Kapitals, indem er das ökonomische Kapital (Einkommen und Vermögen), das kulturelle Kapital (Bildung und Kulturgüter) und das soziale Kapital (Beziehungen) unterscheidet (vgl. Burzan 2005: 138f.). Der Kapitalumfang, die spezifische Zusammensetzung aus den drei verschiedenen Kapitaltypen sowie Auf- und Abstiegsprozesse konstituieren die verschiedenen Klassen und Klassenfraktionen (vgl. Hradil 2001: 90f.). Das Aufwachsen unter den klassenspezifischen Lebensbedingungen prägt den jeweiligen Habitus, womit kollektive Denk-, Wahrnehmungs- und Handlungsmuster gemeint sind, die größtenteils unbewusst verankert sind (vgl. Burzan 2005: 144). Bourdieu sieht soziale Ungleichheit durch die „feinen Unterschiede“ kultureller Orientierungen und Verhaltensweisen reproduziert: Die Bourgeoisie entwickle autonom kulturelle Stile und setze diese als gesellschaftliche Norm durch, das Kleinbürgertum sei auf sozialen Aufstieg ausgerichtet und bemühe sich ehrgeizig, die vorgegebenen kulturellen Normen zu erfüllen, und die Arbeiterklasse entwickle eine pragmatische, am Vorhandenen ausgerichtete „Kultur des Mangels“ (vgl. Hradil 2001: 91).
Für die Frage nach den Ursachen sozialer Bildungsdisparitäten kann mit Bourdieu auf die Bedeutung kulturellen Kapitals verwiesen werden. Kinder mit Zugang zu kulturellen Ressourcen kommen leichter mit dem Schulstoff zurecht, „da dieser eher auf den Erfahrungsschatz aus Elternhäusern mit kulturellem Kapital zugeschnitten ist“ (Hinz/Groß 2005: 202). Zudem bietet Bourdieus Habitustheorie eine Erklärung für das Phänomen, dass Schüler aus niedrigeren Schichten in der Grundschule höhere Leistungen als Kinder aus höheren Schichten erbringen müssen, um von den Lehrern eine Gymnasialempfehlung zu erhalten: In die Bewertungen der Lehrer fließen neben der Leistung wesentlich auch Aspekte wie das Sozialverhalten, das Auftreten und die Umgangsformen ein (vgl. Ditton 2004: 264), was so gedeutet werden kann, dass hier Unterschiede bzw. Gemeinsamkeiten im Habitus zwischen Schülern und Lehrern wirksam werden.
3.3 Zentrale Ursachenkomplexe
Der Blick auf die Theorien von Boudon und Bourdieu hat bereits gezeigt, dass mehrere Faktoren dabei zusammenwirken, soziale Bildungsungleichheit zu erzeugen. Der Schlüssel zur Antwort auf die Frage, ob Ganztagsschulen einen Beitrag dazu leisten können, soziale Ungleichheit zu reduzieren, liegt darin, wodurch die bestehenden Disparitäten überhaupt verursacht werden. Deshalb werde ich ausgewählte Ursachenkomplexe näher betrachten, wobei nur ein grober Überblick möglich ist. In der Literatur wird immer wieder darauf verwiesen, dass die genaue Funktionsweise einzelner Mechanismen (beispielsweise der Elternentscheidung) ebenso wie die Gewichtung der verschiedenen Ursachen nicht hinreichend bestimmt sind. Problematisch ist auch die Datenlage – die offiziellen Statistiken sind für diese Fragestellungen wenig ergiebig. Besonders fehlen Längsschnittsstudien, die das Zusammenwirken verschiedener Faktoren im Laufe von individuellen Bildungskarrieren klären könnten (vgl. Lauterbach/Becker 2004b: 440f.).
3.3.1 Familienspezifische Sozialisation
Lernen findet nicht allein in der Schule statt. Besonders wichtig sind vielmehr auch die Familie sowie Freundschaften und Peergruppen, da Kinder dort wichtige Fähigkeiten und Kenntnisse erwerben, die sie für das alltägliche Leben benötigen (vgl. Grundmann u.a. 2004: 43). Im Rahmen der familialen Sozialisation ist besonders wichtig, wie stark Kinder auf kulturelles Kapital zugreifen können. Damit sind etwa Besitz und Nutzung kultureller Güter sowie der Besuch kultureller Veranstaltung angesprochen. Kulturelle Anregungen fördern die sprachlichen und kognitiven Fähigkeiten von Kindern (vgl. Geißler 1994: 137f.). Auch das Bildungsniveau der Eltern kann als kulturelles Kapital angesehen werden, das unter anderem auch darüber entscheidet, ob und wie sehr Eltern ihren Kindern Hilfestellung, etwa bei Hausaufgaben, geben können. Empirisch zeigt sich ein deutlicher Einfluss von kulturellem Kapital und Bildungsniveau der Eltern auf die Leistung von Kindern. Dabei erweist sich die Bildung der Mütter als bedeutsamer als die Bildung von Vätern, was dafür spricht, dass für die intergenerationale Vererbung sozialer Ungleichheit die Rolle von Müttern als primären Bezugspersonen in schulischen Belangen besonders wichtig ist (vgl. Hinz/Groß 2005: 210 u. 216). Weiter beeinflussen auch die finanziellen Ressourcen von Familien die Bildungschancen, indem sie die Ausstattung mit kulturellen Gütern, den Zugang zu vielfältigen, anregenden Freizeitaktivitäten oder die Inanspruchnahme von Nachhilfe ermöglichen.
Bedeutsam sind ferner die Interaktions- und Kommunikationsprozesse in der Familie, die zum Beispiel soziale Umgangsformen, Konfliktaustragungsformen und Diskussionsfähigkeit prägen. Schichtspezifische Unterschiede der familialen Sozialisationsprozesse sind dabei bereits für Kinder im Vorschulalter nachgewiesen. So erleben Kinder höherer Schichten viel stärker, dass ihr Handeln in Interaktionsbeziehungen wirkmächtig wird und sie Situationen kontrollieren können. Ebenso weisen das Selbstbild sowie die Freundschaftskonzepte von Kindern unterschiedlicher Schichtzugehörigkeit Unterschiede auf (vgl. Grundmann u.a. 2004: 48-50).
Durch die familiale Sozialisation vererben sich auch schichtspezifische Denkmuster, Einstellungen und Wertorientierungen, die unterschiedlichen lebensweltlichen Anforderungen entsprechen. In niedrigeren Schichten gehören dazu die besondere Bedeutung von sozialen Kapital, die Notwendigkeit, flexibel auf sich wandelnde Einkommenssituationen zu reagieren und prekäre Finanzlagen, Verluste und Unsicherheiten hinnehmen und verarbeiten zu können, sowie ein eher kurzfristiger Planungshorizont. Wie Matthias Grundmann u.a. ausführen, entstehen aus solchen unterschiedlichen familialen Bildungsprozessen unterschiedliche Einstellungen und Strategien hinsichtlich der institutionalisierten Bildung. Diese werden durch milieuspezifische Freundschaftsgruppen weiter verstärkt. Kinder aus bildungsfernen Schichten stehen in der Schule vor der Alternative, sich „entweder auf den Versuch des Bildungsaufstieges einzulassen“, wodurch sie die Bindung an ihr Herkunftsmilieu in der Hoffnung auf Bildungserfolg aufgeben, oder „sich den schulischen Anforderungen zu verweigern und ihnen den in den Peers und im eigenen Herkunftsmilieu ausgebildeten Bildungsstrategien und Anerkennungsmodi entgegen zu halten, die das eigene Selbst zu schützen und anzuerkennen vermögen“ (vgl. Grundmann u.a. 2004: 53).
3.3.2 Institutionelle Ursachen
Familiale Sozialisation ist besonders für im Vorschulalter bestehende Unterschiede von Kindern verschiedener sozialer Schichten verantwortlich. Dadurch besteht bereits bei Schuleintritt keine Chancengleichheit. Vielmehr sind die Startbedingungen von Kindern aus höheren sozialen Schichten deutlich besser. Dem Bildungssystem kommt nach der Maxime fairer Chancengleichheit (vgl. Merten 2005: 116) die Aufgabe zu, diese sozial ungleichen Ausgangsbedingungen zu kompensieren. Tatsächlich aber ist das Bildungswesen, insbesondere die Institution Schule, nicht sozial neutral, sondern verschärft die sozialen Disparitäten der Bildungschancen noch. Erkennen lässt sich dies unter anderem etwa daran, dass die sozial bedingten Leistungsunterschiede in der Lesekompetenz bei Grundschulkindern – wie die IGLU-Studie zeigt – deutlich geringer sind als bei älteren Schülern (vgl. Schütz/Wößmann 2005: 22). Empirisch gesichert ist weiter die Tatsache, dass die Übergangsempfehlung am Ende der Grundschule von der sozialen Herkunft abhängig ist. Der Übertritt von der Grundschule in eine weiterführende Schule ist im deutschen Bildungswesen die bedeutsamste Weichenstellung überhaupt, da im weiteren Verlauf der Bildungskarriere nur geringe Mobilität zwischen den unterschiedlichen Bildungsgängen gegeben ist (vgl. Ditton 2004: 254). Die abgebenden Primarschulen empfehlen den Eltern dabei einen der drei Bildungsgänge. Nachgewiesen ist, dass Kinder niedriger Schichten eine deutlich geringere Chance haben, eine Empfehlung für das Gymnasium zu erhalten, als Kinder höherer Schichten. Dies gilt sogar bei gleicher Leistung – Arbeiterkinder müssen also für eine Gymnasialempfehlung eine deutlich höhere Leistung erbringen als Kinder höherer Schichtzugehörigkeit.
Diese sozialen Unterschiede bei der Übergangsempfehlung, aber auch bei der Notengebung (vgl. Ditton 2004: 264-267) sowie bei der Schulleistung selbst sind weniger Ausdruck einer bewussten sozialen Diskriminierung seitens der Lehrer, sondern beruhen eher auf unbewusst ablaufenden psychosozialen Mechanismen: Die Lehrer gehören selbst in der Regel der Mittelschicht an. Ihr Unterricht und auch ihre Erwartungen an die Schüler richten sich nach dem in der Mittelschicht Üblichen. Schülern aus der Unterschicht fällt es schwer, die vielen unausgesprochenen Regeln und Erwartungen zu erfüllen, da sie diese nicht kennen: Sie weisen eine geringere kulturelle „Passung“ auf (vgl. Hillmert 2004: 89f.) Hervorgehoben wird in der Forschung auch, dass der Lehrstoff und die im Unterricht verwendeten Sprachcodes dem Erfahrungshorizont der Mittelschicht entsprechen und daher die Kinder aus niedrigeren sozialen Schichten benachteiligen. Gerade die Sprachfertigkeiten sind dabei Gegenstand einer Debatte geworden: Anhänger der Defizithypothese behaupten, die Sprachcodes und Fertigkeiten der Mittelschicht seien Voraussetzung höherer Bildung und die Kinder aus niedrigeren Schichten hätten defizitäre Fähigkeiten. Vertreter der Differenzhypothese argumentieren dagegen, dass die Verwendung der mittelschichtspezifischen Sprachcodes willkürlich erfolge und den Wunsch der Mittelschicht widerspiegele, den Zugang zu Bildung nach unten sozial abzuschließen (vgl. Geißler 1994: 136-140).
Zumindest in einem Punkt ist sich die Forschung weitgehend einig: das zentrale Problem der Institution Schule besteht darin, dass sie grundlegende Fähigkeiten und Kenntnisse, die sie eigentlich vermitteln soll, implizit bereits bei den Kindern erwartet (vgl. Ditton 2004: 268f.; Merten 2005: 121f.) und „auf eine Vor- und Zuarbeit im Sinne von Vorbereitung auf die Schule und kontinuierlicher Unterstützung“ (Toppe 2005: 136) seitens der Eltern setzt. Damit werden die Kinder benachteiligt, denen diese familiären Ressourcen und daher wichtige von der Schule erwartete Unterstützungsleistungen fehlen.
Zur Erklärung der Unterschiede bei der Übergangsempfehlung wird darauf verwiesen, dass Eltern höherer Schichten den Lehrern gegenüber ein deutliches höheres Interesse an den Schulleistungen ihrer Kinder zeigen (vgl. Geißler 1994: 143) und den Lehrern frühzeitig ihre Erwartung einer hohen Empfehlung signalisieren. Gerade an der Übergangsempfehlung zeigt sich, wie institutionelle Ursachen, sozialisationsbedingte Faktoren und die individuellen Bildungsentscheidungen der Eltern sich wechselseitig beeinflussen (vgl. Ditton 2004: 258-262). So reagieren Eltern schichtspezifisch verschieden auf die Schulempfehlung, die im übrigen nur eine relativ geringe Prognosekraft für die Schulkarriere aufweist (vgl. Ditton 2004: 263): Eltern höherer Schichten entscheiden sich eher für einen höheren Bildungsgang als den empfohlenen, Eltern niedrigerer Schichten bleiben dagegen noch unter den Empfehlungen der Schule zurück. Ähnlich wechseln Kinder der Unterschicht viel häufiger und bei vergleichsweise geringen Schwierigkeiten auf eine niedrigere Schulform (vgl. Geißler 1994: 132). Hier spielt eine Rolle, welches Bild Eltern von Schule haben. Eltern aus niedrigeren Schichten schätzen nicht nur die Erfolgschancen ihrer Kinder auf höheren Schulformen skeptischer ein, sondern sehen die von den Mittelschichten dominierte höhere Bildung nicht selten implizit als „nicht passend“ für ihr Kind an.
Für das deutsche Bildungswesen kann noch eine institutionelle Besonderheit angeführt werden, die soziale Bildungsungleichheit mit erklären kann: Dies ist die im internationalen Vergleich sehr früh – um den Preis hoher Prognoseunsicherheiten – und sehr konsequent durchgeführte Aufgliederung der Schüler im dreigliedrigen Schulsystem (vgl. Becker/Lauterbach 2004a: 26f.). Die PISA-Studie lässt deutliche Zweifel an der bildungspolitischen Begründung dieser Selektion aufkommen: Die Ergebnisse anderer Länder zeigen, dass das gemeinsame Unterrichten in leistungsmäßig heterogeneren Gruppen keineswegs mit einer Abnahme des Leistungsniveaus einhergehen muss, sondern vielmehr geeignet ist, soziale Ungleichheiten abzubauen (vgl. Schütz/Wößmann 2005: 21-24). Die frühe Selektion verschärft besonders die „Krise der Hauptschule“, denn die gesellschaftliche Stigmatisierung der Hauptschule als Restschule und die hohe soziale Homogenität an dieser Schulform ist für ihre Schüler stark demotivierend und belastend (vgl. Solga/Wagner 2004). Auch hinsichtlich der frühen Selektion und der Dreigliedrigkeit des Schulsystems gibt es seit Jahrzehnten stark ideologisch geprägte bildungspolitische Debatten, in denen zumindest teilweise durchaus Anzeichen für schichtspezifische Schließungsbemühungen erblickt werden können (vgl. Vester 2005: 46f.).
[...]
[1] Im Vergleich zu den anderen Schichten haben Kinder ungelernter deutscher Arbeiter kaum profitiert, so dass sich die Bildungschancen dieser Schicht weiter verschlechterten (vgl. Geißler 1994: 119).
[2] Die „Third International Mathematics and Science Study“ war Wößmann zufolge „die erste internationale Studie seit langer Zeit, an der auch Deutschland teilnahm” (Wößmann 2003: 33).
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Erstausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2006
- ISBN (Paperback)
- 9783958200500
- ISBN (PDF)
- 9783958205505
- Dateigröße
- 6.1 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Philipps-Universität Marburg
- Erscheinungsdatum
- 2015 (Februar)
- Note
- 1
- Schlagworte
- Bildungssoziologie Schulwesen soziale Ungleichheit Bildungsungleichheit Bildungschance
- Produktsicherheit
- BACHELOR + MASTER Publishing