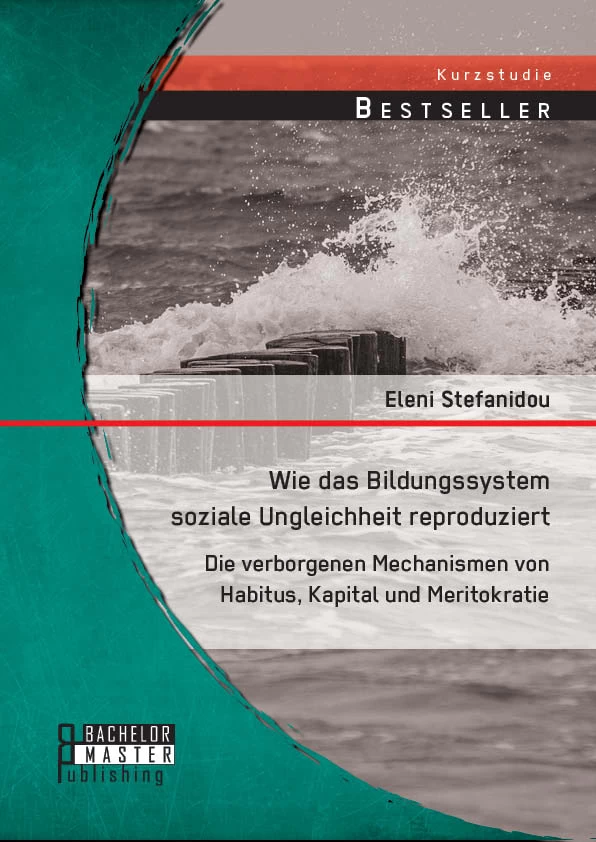Wie das Bildungssystem soziale Ungleichheit reproduziert: Die verborgenen Mechanismen von Habitus, Kapital und Meritokratie
Zusammenfassung
Die Habitus- und Kapitaltheorien des französischen Soziologen Pierre Bourdieu erklären die Reproduktion sozialer Ungleichheit im Bildungssystem durch unbewusst wirkende Mechanismen, die in Zusammenhang mit der Ideologie des Leistungsprinzips soziale Ungleichheit als gerechtes Resultat unterschiedlicher Begabungen und Anstrengungen erscheinen lassen. Durch die Orientierung am Habitus der oberen Schichten reproduziert und legitimiert das Bildungssystem abseits der öffentlichen Wahrnehmung die herrschende Gesellschaftsstruktur und die damit gegebene Chancenungleichheit. Trotz Bildungsexpansion bleibt daher sozialer Aufstieg ohne grundlegende Änderung der Strukturen und Aufklärung über ihre Wirkungsweisen weiterhin eine Ausnahme.
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1.3 Bildungsbenachteiligung trotz Bildungsexpansion
An dieser Stelle soll kurz skizziert werden, wie sich die Bildungsbeteiligung infolge der Bildungsexpansion in Deutschland entwickelt hat und welche Ungleichheiten heute noch vorherrschen. Als Bildungsexpansion wird die Ausdehnung des Bildungssystems, vor allem der Ausbau von Realschulen, Gymnasien und Hochschulen, bezeichnet, infolge derer immer mehr junge Menschen länger im Bildungssystem verweilen und mittlere bzw. höhere Bildungsabschlüsse erwerben. Ein Vergleich der Verteilung auf die verschiedenen Schularten in den Jahren 1952 und 2002/03 macht diese Entwicklung deutlich. So stieg der Besuch der Realschule von 6% auf 25% und des Gymnasiums von 13% auf 33%. Die Volksschule als damalige ‚Hauptschule‛ wurde von 79% der SchülerInnen besucht, während 2002/03 lediglich 23% die Hauptschule besuchten und sich weitere 19% auf integrierte Schulen verteilten. Mit dieser Entwicklung ging ein Anstieg der Abiturientenquote einher von 6% im Jahr 1960 auf 25% in 2002. Enorm weist sich auch der Anstieg der Studierenden aus. Während 1960 nur 6% ein Universitäts- und nur 2% ein Fachhochschulstudium begannen, wuchsen diese Zahlen bis 2002 auf 25% bzw. 13% an. Der Anteil der Jugendlichen ohne Schulabschluss konnte hingegen lediglich von 17% (1960) auf ca. 10% gesenkt werden, eine Zahl, die seit den 1980er Jahren stagniert (vgl. Geißler 2004).
Die Bildungsexpansion in der Bundesrepublik Deutschland setzt bereits in den 1950er Jahren ein und erfährt weitere Schubkraft durch die bildungspolitischen Debatten in den 1960er Jahren (vgl. ebd.). Darin wird die Relevanz von Bildung zur Bewahrung der wirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands, aber auch der Einfluss von Bildung auf die sozialen Chancen jedes Einzelnen thematisiert. Die Reformbemühungen gelten daher neben der Sicherung der ökonomischen Leistungsfähigkeit der Gesellschaft vor allem der Erhöhung von Bildungschancen sozial benachteiligter Gruppen. Konfession, Geschlecht, soziale Herkunft und Region sind die sozialen Determinanten der damaligen Bildungsbenachteiligung (vgl. Loeber/Scholz 2003: 247f.). In den 1970er Jahren verebbt die Diskussion um gerechtere Bildungschancen; hingegen wird seitdem oft vor einer Inflation und Abwertung höherer Bildungsabschlüsse gewarnt (vgl. Geißler 2004). Seit den 1990er Jahren gewinnt die Diskussion über die Bildungsbenachteiligung sozialer Gruppen langsam erneut an Resonanz, da angesichts eines zusammenwachsenden Europas und der Globalisierung die ökonomische Konkurrenzfähigkeit Deutschlands nun in weltwirtschaftlichem Maßstab zur Debatte steht (vgl. Loeber/Scholz 2003: 249). Erst die PISA-Ergebnisse haben jedoch die vorherrschenden Disparitäten im deutschen Bildungssystem mit Nachdruck in den Fokus des wissenschaftlichen und politischen Bewusstseins gerückt. Demnach hat die Bildungsexpansion zum paradoxen Resultat geführt, dass sich die Bildungschancen aller Schichten verbessert haben, während gravierende schichttypische Ungleichheiten nicht beseitigt werden konnten (vgl. Geißler 2006: 36ff.). Zwar konnte die Benachteiligung durch Konfession, Region und Geschlecht abgeschwächt bzw. ganz abgeschafft werden, die soziale Herkunft prägt allerdings weiterhin die Bildungschancen in hohem Maße (vgl. Büchner 2003: 16).
Geißler (2006: 36ff.) verdeutlicht anhand verschiedener Datenbestände die Verschiebungen auf den verschiedenen Bildungsniveaus für die Jahre 1950 bis 1989. Auf der mittleren Ebene wuchsen die Chancen zugunsten von Kindern der Arbeiter, Landwirte und ausführenden Dienstleistern, welche vor allem vom Ausbau der Realschulen zwischen 1970 und 1989 profitierten. Nutznießer der gymnasialen Expansion sind hingegen „die Kinder – insbesondere die Töchter – des nichtlandwirtschaftlichen Mittelstands sowie der höheren Dienstleistungsschicht, die bereits 1950 die besten Bildungschancen hatten“ (ebd.: 38). Geringere, dennoch recht gute Chancen auf einen Gymnasialbesuch haben Kinder der mittleren Angestellten und Beamten, während die Kinder der einfachen Dienstleister, der Arbeiterelite und der einfachen Arbeiter weiter stark benachteiligt bleiben. „Beim Wettlauf um die höheren Bildungsabschlüsse haben sich also die Chancenabstände zwischen privilegierten und benachteiligten Gruppen vergrößert“ (ebd.). Dazu trugen ferner seit den 1990er Jahren die Stagnation der Chancen von Kindern Un- und Angelernter auf einen Besuch der Realschule oder des Gymnasiums ebenso wie die nur geringen Chancenzuwächse für Facharbeiterkinder bei. Im Hochschulbereich werden sogar größere Abstände sichtbar, da vor allem diejenigen Gruppen von der Bildungsexpansion profitierten, deren Studienchancen bereits 1969 gut waren. So wuchs der Anteil der Kinder von Selbständigen an den Studienanfängern von 1969 bis 2000 um 30%, von Beamten um 26% und von Angestellten um 11%. Der Anteil der Arbeiterkinder betrug 2000 jedoch lediglich 7% (4% Zuwachs). Besonders drastisch werden die niedrigen Chancen der unteren Schicht, ein Hochschulstudium aufzunehmen, angesichts von Zahlen deutlich, die belegen, dass Kinder von Un- und Angelernten häufiger Sonderschulen (7% der Kinder) als Fachhochschulen oder Universitäten (jeweils 2%) besuchen. Die Bildungsexpansion hat also zu einem Abbau der Chancenunterschiede lediglich bei den mittleren Abschlüssen geführt, während die ungleiche Chancenverteilung bei höheren Bildungswegen weiterhin vorhanden ist.
Als Ursachen identifiziert Geißler (2006: 40ff.) diverse Faktoren. Dazu gehören schichttypische Kompetenz- und Leistungsunterschiede bei Kindern und Jugendlichen, welche aus der Sozialisation in schichttypischen Familienmilieus erwachsen. In den mittleren und höheren Schichten wird die Entwicklung von Fähigkeiten und Motivationen, die eine erfolgreiche Bildungslaufbahn begünstigen, eher gefördert. Des Weiteren werden Leistungen in ungleichem Maße in Bildungskapital umgesetzt, so dass die Chancen von Kindern und Jugendlichen aus höheren Schichten auf einen Gymnasialbesuch um ein Vielfaches höher sind als für SchülerInnen aus unteren Schichten. Dies liegt zum einen an einer schichttypischen Auslese in den Familien, die dazu führt, dass die Bildungsentscheidungen der Eltern nur bedingt an die Leistungen der Kinder gekoppelt sind. So entscheiden sich bildungsnahe Familien eher für einen Gymnasialbesuch ihrer Kinder, auch entgegen der Lehrerempfehlungen, während es sich bei bildungsfernen Familien genau umgekehrt verhält. Diese Effekte werden durch die Schule noch verstärkt, da die dortige Auslese ebenfalls von leistungsfremden sozialen Kriterien beeinflusst wird. Demnach werden Kinder der unteren Schichten in Bezug auf ihre tatsächlichen Leistungen zu schlecht, Kinder der mittleren und vor allem der oberen Schichten hingegen zu gut benotet. Entsprechend fallen auch die Grundschulempfehlungen für die weiterführenden Schulen aus. Die starke soziale Selektivität setzt sich in der Sekundarstufe fort, da die verschiedenen Schulformen unterschiedliche Entwicklungsmilieus darstellen. So sind bei gleicher Ausgangslage die Lernfortschritte in Gymnasien größer als in Realschulen und in Realschulen größer als in Hauptschulen, was ein Indikator für die mangelnde Durchlässigkeit des Bildungssystems ‚nach oben‛ ist. Die frühe Selektion nach vier gemeinsamen Grundschuljahren, durch die die Weichen für die gesamte spätere Bildungslaufbahn gestellt werden, stellt daher eine besondere Problematik dar.
2 Erklärungsmodelle
Die folgenden Erklärungsmodelle erhellen den Ursachenkomplex, welcher den dargestellten Ungleichheiten im deutschen Bildungssystem zu Grunde liegt. So wird anhand der meritokratischen Leitfigur sozialer Ungleichheit deutlich, warum trotz der vorliegenden Ungerechtigkeiten der öffentliche Eindruck von Chancengleichheit herrscht und weiterhin vehement am gegliederten Schulsystem festgehalten wird. Dass die meritokratische Ideologie von den eigentlichen Mechanismen, die zur sozialen Ungleichheit führen, ablenkt, erweist sich dabei für die ‚Bildungsverlierer‛ als besonders fatal.
Zudem bietet es sich an, auf die Theorien Bourdieus zurückzugreifen, welcher die meritokratische Begabungsideologie in ein umfassendes Geflecht soziostruktureller Ursachen für die Reproduktion sozialer Ungleichheit einbaut. Dazu erstellt er ein mehrdimensionales Modell der Sozialstruktur, welches neben ökonomischen Ressourcen auch Bildung als eigenständige, mit Ersteren auf komplexe Weise verknüpfte Ressource begreift, was sich für die Forschung als vorteilhaft erweist.
Der größte Teil der Forschungsarbeiten zum Thema Bildung und soziale Ungleichheiten ist hingegen implizit an einem vertikal ausgerichteten Modell von Sozialstruktur orientiert, wodurch die Dimension des Bildungserwerbs lediglich auf die Möglichkeit des sozialen Aufstiegs oder Abstiegs reduziert wird. Die sozialstrukturellen Verschiebungen, die durch die veränderte Nutzung von Bildungsinstitutionen hervorgerufen werden, können mit diesem Modell allerdings nicht vollständig erklärt werden. Darunter fällt z.B. die Erhöhung des Bildungsniveaus der gesamten Gesellschaft im Zuge der Bildungsexpansion bei gleich bleibenden Berufsperspektiven der Absolventen. Indem jedoch Bourdieu Bildung als kulturelles Kapital definiert und dieses als zweite eigenständige Dimension dem Modell der Sozialstruktur hinzufügt, können die durch die Bildungsexpansion hervorgerufenen sozialstrukturellen Verschiebungen und Wandlungsprozesse des Habitus genauer erfasst werden (vgl. Engler/Krais 2004: 7ff.).
2.1 Meritokratische Leitfigur sozialer Ungleichheit
Chancengleichheit im Bildungswesen und ein emanzipatives Bildungsideal sind unbedingte Voraussetzungen einer demokratischen Gesellschaft (vgl. Bauer/Bittlingmayer 2005: 14). Die gleichberechtigte Integration aller Gesellschaftsmitglieder beinhaltet, dass Ungleichheiten nicht mehr durch Herkunft oder andere angeborene Faktoren gerechtfertigt werden. Stattdessen wird die individuelle Bildungsleistung – inklusive erworbener Zertifikate – zur Legitimation ungleicher Lebenschancen herangezogen, was insofern auch dem demokratischen Verständnis entspricht, als die formale Chancengleichheit gesetzlich gesichert ist. Entsprechend dieser normativen Vorgabe wird Bildung als universell zugänglich wahrgenommen, obwohl trotz Bildungsexpansion die Bildungschancen weiterhin sozial ungerecht verteilt sind. Die Diskrepanz zwischen Wahrnehmung und Realität hängt mit der sogenannten meritokratischen Leitfigur zusammen, welche soziale Ungleichheit auf ‚natürliche‛ Erklärungen individueller Leistungsunterschiede zurückführt und somit ungerechte Bildungschancen legitimiert. Dabei wird verschleiert, dass die Bildungsleistung in Institutionen erbracht wird, die so organisiert sind, dass ungleiche Herkunftsressourcen sozial relevant werden. Die Zertifizierung der Leistungen ist daher notwendigerweise mit Herkunftsunterschieden verbunden, wobei das Ausmaß des Zusammenhangs zwischen Bildung und sozialer Herkunft durch die Organisation der Institutionen bestimmt wird (vgl. Solga 2005: 19ff.).
Die meritokratische Ideologie weist Bildung in modernen Gesellschaften als funktional notwendig aus, da die steigende Nachfrage der Industrie nach qualifizierten Arbeitskräften gedeckt werden muss. Die Ungleichheiten, die dabei durch unterschiedlich honorierte Bildungsleistungen entstehen, sollen als Anreiz für immerwährende Lernprozesse der Individuen zu einer bestmöglichen Ausschöpfung der Begabungsreserven führen. Auf dieser Grundlage soll Bildung für alle verfügbar sein, aber nur innerhalb der Grenzen von Begabung und Intelligenz genutzt werden können. Auf diese Weise bestimmt die meritokratische Selektion den Zugang zu höheren sozialen Positionen in vermeintlicher Unabhängigkeit des Bildungserfolgs von der sozialen Herkunft (vgl. ebd.: 22f.).
Funktionieren kann die Legitimation sozialer Ungleichheit durch die meritokratische Leitfigur aufgrund ihrer fünf Charakterzüge, welche bestehende Institutionalisierungsmuster stabilisieren. Der erste davon ist die ‚natürliche‛ Fundierung sozialer Ungleichheit, womit die Definition von Bildungsunterschieden als Begabungsunterschieden gemeint ist. „Der soziale Status erscheint als kausales Resultat von biologischen Intelligenz- und Begabungsunterschieden“ (ebd.: 24), was zur Umdeutung sozialer Unterschiede in natürliche Unterschiede führt. Bei der Frage, worauf individuelle Leistungsdifferenzen zurückzuführen sind, wird hierbei von einer additiven statt einer interdependenten Verbindung zwischen biologischen und sozialen Faktoren ausgegangen. Zudem wird ausgeblendet, dass Begabung und Intelligenz ebenso wie die Leistungsdefinition nach diesen Kriterien und auch Bildungskategorien soziale Konstrukte sind. Stattdessen wird unterstellt, dass Letztere, wie auch Bildungszertifikate, die natürlichen, unveränderlichen Begabungen widerspiegeln. Dass Bildung darüber hinaus außerdem als erworbenes Merkmal gilt, kennzeichnet Bildungserfolge als Resultat aus Intelligenz und Anstrengung. Diese Annahme ist gleichermaßen problematisch, da sie suggeriert, dass alle die gleichen Chancen haben, sie aber unterschiedlich nutzen. Größere Anstrengungen, die aufgrund von institutionellen Barrieren für Bildungserfolge notwendig sind, werden in Bildungszertifikaten negiert, so dass gleichzeitig die institutionellen Organisationen stabilisiert werden (vgl. ebd.: 23ff.).
Das zweite Merkmal der meritokratischen Leitfigur besteht in der Definition der Ungleichheit als gesellschaftliches Funktionserfordernis. Gesellschaftliche Arbeitsteilung und persönliche Identität machen demnach Ergebnisungleichheiten und Belohnungsdifferenzen erforderlich, wodurch die Hierarchisierung von Berufspositionen und Bildungsleistungen als Zugangsmöglichkeit zu Ersteren als notwendiger Anreiz gefestigt wird. Indem Differenz als notwendige Voraussetzung sozialer Ordnung definiert wird, reduziert sich die Aufgabe der Gesellschaft auf die Herstellung von Chancengleichheit bei gleichzeitiger Beibehaltung von Ergebnisungleichheiten (vgl. ebd.: 26).
Der dritte Charakterzug der meritokratischen Leitfigur betrifft organisierte Bildungsprozesse, welche für die Zuordnung von Personen zu Positionen auf dem Arbeitsmarkt als notwendig erachtet werden. Nur durch die Beteiligung an organisierten und zertifizierten Bildungsprozessen kann nachgewiesen und kontrolliert werden, was gelernt wurde. Dabei geht es allerdings nicht um die Kompetenzen an sich, zumal Bildungszertifikate außerhalb von Bildungseinrichtungen erworbene Kompetenzen kaum berücksichtigen. Wichtig sind hingegen lediglich die Kompetenznachweise, welche nur als Zertifikate institutionalisierter Bildungsleistungen selbige messbar und vergleichbar machen. Die unterstellte Herkunftsneutralität in der Teilnahme an den organisierten Bildungsprozessen und ihrer Bewertung verschleiert dabei diese Funktion der Zertifikate (vgl. ebd.: 27f.).
Die individuelle statt kategoriale Ungleichheitsdefinition, das vierte Merkmal der meritokratischen Leitfigur, fußt auf der Annahme, dass bestehende Bildungsungleichheiten auf universalistischen Leistungskriterien beruhen. Daher kann die kategorial definierte Ungleichheit nach Schicht oder Status negiert und durch eine individuell definierte Ungleichheit nach Leistung ersetzt werden. Durch die gesellschaftliche Struktur bedingte Chancen und soziale Risiken werden somit der individuellen Verantwortung zugeschrieben und Herkunftsfaktoren als ‚erworbene‛ Leistung umgedeutet (vgl. ebd.: 28f.).
Die Betonung individueller Leistung, die von Gleichgestellten bestätigt wird, prägt ferner den fünften Charakterzug, die Entpersonifizierung der Definition von Leistung, womit die Ausblendung der Definitionsmacht statushöherer Gruppen gemeint ist. Aus dem Blick gerät damit auch die Tatsache, dass die Definition und die Erfüllung von Leistungskriterien in der Verantwortung der Bildungsinstitutionen liegen. Der Erfolg der SchülerInnen hängt demnach wesentlich von den Möglichkeiten ab, welche ihnen die Organisation Schule eröffnet. Diese liegen nicht zuletzt in der Wahrnehmung und Förderung von Kompetenzen und Begabungen, welche aber im gegliederten Schulsystem von der Bewertung vorangegangener Leistungen und somit von sozial strukturierten Wahrnehmungsprozessen der LehrerInnen und Eltern abhängen, also nicht herkunftsunabhängig sind (vgl. ebd.: 29f.).
Aufgrund dieser Charakterzüge der meritokratischen Leitfigur präsentiert sich Bildung als Chance, deren Nutzung von individueller Anstrengung und Initiative abhängig zu sein scheint. Dies wird auch von den ‚Verlierern‛ im Bildungswettbewerb, also den gering Qualifizierten, als gerechtes Prinzip empfunden, „weil Leistung bzw. Bildungszertifikate in scheinbar so konsequenter Weise die Statuszuweisung bestimmen“ (ebd.: 31; Hervorhebung im Original), so dass bildungsbasierte Ungleichheiten für alle Gesellschaftsmitglieder handlungsrelevant werden. Nicht zuletzt stärkt der Fokus auf Leistungsergebnisse in Form von Zertifikaten den Glauben an die meritokratische Ideologie. Indem Bildungsprozesse ausgeblendet werden, werden die institutionellen Bedingungen, unter denen sie stattfinden, ebenfalls ignoriert (vgl. ebd.: 31ff.).
2.2 Kapital
Der Kapitalbegriff nimmt eine zentrale Rolle in Bourdieus Werk ein und bezeichnet nicht nur alle sozial erforderlichen Handlungsressourcen, sondern bedeutet, wie auch in der Wirtschaft, akkumulierte Arbeit (vgl. Rehbein 2006: 111). Die Akkumulation benötigt Zeit; das Kapital kann sich jedoch selbst reproduzieren, wachsen oder Profite produzieren (vgl. Bourdieu 1983: 183). Wie Bourdieu (ebd.) weiter ausführt, ist das Kapital eine der Objektivität der Dinge innewohnende Kraft, die dafür sorgt, daß nicht alles gleich möglich oder gleich unmöglich ist. Die zu einem bestimmten Zeitpunkt gegebene Verteilungsstruktur verschiedener Arten und Unterarten von Kapital entspricht der immanenten Struktur der gesellschaftlichen Welt, d. h. der Gesamtheit der ihr innewohnenden Zwänge, durch die das dauerhafte Funktionieren der gesellschaftlichen Wirklichkeit bestimmt und über die Erfolgschancen der Praxis entschieden wird.
Zudem weitet Bourdieu (ebd.: 184) den wirtschaftswissenschaftlichen Kapitalbegriff aus, denn dieser reduziert die Gesamtheit der gesellschaftlichen Austauschverhältnisse auf den bloßen Warenaustausch, der objektiv und subjektiv auf Profitmaximierung ausgerichtet und vom (ökonomischen) Eigennutz geleitet ist. Damit erklärt die Wirtschaftstheorie implizit alle anderen Formen sozialen Austausches zu nicht-ökonomischen, uneigennützigen Beziehungen. (Hervorhebungen im Original)
Diese Reduzierung des Kapitalbegriffs auf die ökonomische Dimension ist indessen nicht zulässig, da auch unverkäufliche, von der Sphäre der Wirtschaft ausgenommene Dinge einen ökonomischen Wert besitzen, selbst wenn dieser nicht erkennbar ist. Um der Struktur und dem Funktionieren der Gesellschaft gerecht werden zu können, müssen daher alle Erscheinungsformen des Kapitals sowie die Gesetze ihrer Konvertierbarkeit berücksichtigt werden (vgl. ebd.). Bourdieu unterscheidet drei grundlegende Arten des Kapitals, das ökonomische, das kulturelle und das soziale Kapital, und fügt diesen das symbolische Kapital als Hyperonym hinzu.
2.2.1 Ökonomisches Kapital
Unter ökonomischem Kapital versteht Bourdieu neben Geld alle materiellen Güter, die sich unmittelbar in Geld konvertieren lassen. Daher eignet es sich besonders zur Institutionalisierung in Form des Eigentumsrechts. Ökonomisches Kapital liegt allen anderen Kapitalarten zu Grunde, da diese durch jenes erworben werden können (vgl. ebd.: 185). Deshalb ist es in modernen, kapitalistischen Gesellschaften von besonders großer Bedeutung (vgl. Bohn/Hahn 1999: 264).
2.2.2 Kulturelles Kapital
Bourdieu führt den Begriff des kulturellen Kapitals ein, um die Ungleichheit schulischer Leistungen von Kindern aus verschiedenen sozialen Klassen erklären zu können, wobei er den Schulerfolg und die Verteilung des kulturellen Kapitals aufeinander bezieht. Damit wendet er sich gegen die allgemeine Vorstellung, dass schulische Erfolge und Misserfolge auf natürliche Fähigkeiten zurückzuführen sind. Diese Annahme liegt auch der Humankapitaltheorie zu Grunde, welche die relative Bedeutung von ökonomischen und kulturellen Investitionen für die verschiedenen Klassen verkennt und nur in Geld messbare oder konvertierbare Investitionen berücksichtigt. Ebenso wird kein Zusammenhang zwischen schulischen Investitions-, Erziehungs- und Reproduktionsstrategien hergestellt (vgl. Bourdieu 1983: 185f.), was dazu führt, dass „die am besten verborgene und sozial wirksamste Erziehungsinvestition [...], nämlich die Transmission kulturellen Kapitals in der Familie “ (ebd.: 186; Hervorhebung im Original) unbeachtet bleibt. Das Bildungssystem heißt diese gut und trägt dadurch zur Reproduktion der Sozialstruktur bei. Schulerfolge hängen somit von der Investition von Zeit und kulturellem Kapital ab, welche die vermeintlich natürliche Begabung beeinflusst (vgl. ebd.). Hierbei unterscheidet Bourdieu drei Formen des kulturellen Kapitals: das inkorporierte, das objektivierte und das institutionalisierte kulturelle Kapital.
2.2.2.1 Inkorporiertes Kulturkapital
Das inkorporierte kulturelle Kapital, welches dem deutschen Begriff der Bildung entspricht, ist körpergebunden und setzt einen Verinnerlichungsprozess voraus, der vom Träger unter Einsatz von Zeit (Unterrichts- und Lernzeit) persönlich geleistet werden muss, was Entbehrungen mit sich bringen kann. Das Kapitalvolumen kann anhand der Dauer des Bildungserwerbs und der Primärerziehung in der Familie gemessen werden, wobei Letztere sich auch negativ auswirken kann, wenn sie nicht den Erfordernissen des schulischen Markts entspricht (vgl. ebd.: 186f.).
Inkorporiertes Kulturkapital wird zum Habitus, also zum festen Bestandteil des Akteurs und ist daher nicht kurzfristig transferierbar. Die Verinnerlichung kann durch soziale Vererbung auch unbewusst, also ohne geplante Erziehungsmaßnahmen vonstattengehen, weshalb das inkorporierte kulturelle Kapital leicht als bloß symbolisches Kapital aufgefasst wird, das vor allem dort zum Tragen kommt, wo das ökonomische Kapital nicht voll anerkannt ist. Die Tatsache, dass es nicht über die Aufnahmefähigkeit des Trägers hinaus akkumuliert werden kann, bestimmt den Wert des inkorporierten Kulturkapitals, ebenso wie ein möglicher Seltenheitswert, von dem besonders profitiert werden kann. Letzterer entsteht durch die ungleiche Verteilung von ökonomischem und kulturellem Kapital, aufgrund derer nicht alle dieselbe Bildung genießen können (vgl. ebd.: 187f.), so dass es zu den „spezifischen Wirkungen von Kapital [kommt], nämlich die Fähigkeit zur Aneignung von Profiten und zur Durchsetzung von Spielregeln, die für das Kapital und seine Reproduktion so günstig wie möglich sind“ (ebd.: 188). Die Akkumulation kulturellen Kapitals ist besonders wirksam, wenn die dafür verwendete Zeit mit der Zeit der Sozialisation gleichgesetzt werden kann, was allerdings nur auf Familien mit besonders starkem Kulturkapital zutrifft (vgl. ebd.).
Daraus folgt, daß die Übertragung von Kulturkapital zweifellos die am besten verschleierte Form erblicher Übertragung von Kapital ist. Deshalb gewinnt sie in dem System der Reproduktionsstrategien von Kapital um so mehr an Gewicht, je mehr die direkten und sichtbaren Formen der Übertragung sozial mißbilligt und kontrolliert werden. (ebd.)
Die zum Erwerb nötige Zeit verbindet das ökonomische mit dem kulturellen Kapital, da das Individuum die Akkumulation von Kulturkapital nur so lange weiterführen kann, wie es durch seine Familie von ökonomischen Zwängen befreit ist. Das unterschiedliche Kulturkapital in den Familien erzeugt des Weiteren Unterschiede im Zeitpunkt des Beginns der Aneignung sowie in den für den Aneignungsprozess erforderlichen Kompetenzen (vgl. ebd.).
[...]
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Erstausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2008
- ISBN (Paperback)
- 9783958200876
- ISBN (PDF)
- 9783958205871
- Dateigröße
- 4.5 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Bergische Universität Wuppertal
- Erscheinungsdatum
- 2015 (Februar)
- Note
- 1
- Schlagworte
- Pierre Bourdieu Chancengleichheit Bildungsexpansion dreigliedriges Schulsystem Chancenungleichheit
- Produktsicherheit
- BACHELOR + MASTER Publishing