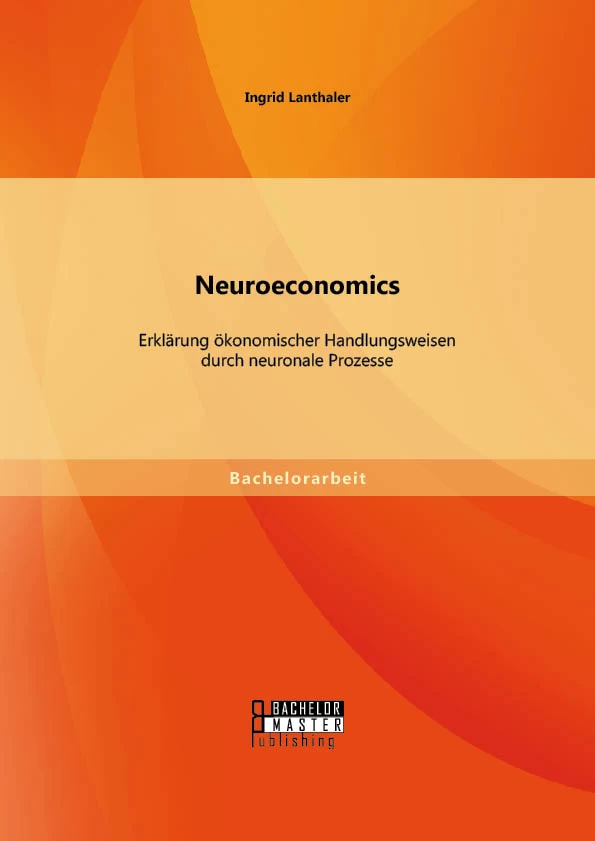Neuroeconomics: Erklärung ökonomischer Handlungsweisen durch neuronale Prozesse
Zusammenfassung
Mittels verschiedener Experimente wird versucht zu erläutern, wie Emotionen ökonomische Handlungsweisen beeinflussen und welche Gehirnregionen dafür zuständig sind. Diese neuronalen Prozesse werden dann dafür genutzt, eine Erklärung für die ökonomische Handlungslogik zu finden. Anschließend wird noch auf die Vor- und Nachteile eingegangen, die diese neue Wissenschaft mit sich bringt sowie mittels Kritiken und Aussagen von Autoren ein kurzer Ausblick erstellt.
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1. Von Neurowissenschaft zur Neuroökonomie
Kapitel Eins widmet sich nach kurzer Begriffserklärung einigen fundamentalen Darstellungen der Entstehung der Neuroökonomie, sowie der sog. Somatic Marker Hypothese von Damasiò, die Defizite im Entscheidungsverhalten infolge von Hirnschädigungen darstellt. Im Anschluss daran folgt eine kurze Einführung in die Methodik und die Anwendungsfelder der Neuroökonomie, die Aufschluss über die Hauptaufgaben und Instrumente dieser neuen Wissenschaft geben soll.
Was ist die Neurowissenschaft eigentlich? Die Neurowissenschaft ist eine komplexe und sehr junge Wirtschaftsdisziplin, die sich mit Untersuchungen über die Struktur und Funktion von Nervensystemen befasst und interpretiert. Sie erscheint als Verschmelzung zwischen der Molekularbiologie, der Zellular- und Evolutionsbiologie, der Elektrophysiologie, der Neurophysiologie, der Anatomie, sowie der Psychologie. Diese einzelnen Disziplinen werden im Rahmen der Neurowissenschaft mit dem Ziel zusammengefasst, neuronale Funktionen auf allen Komplexitätsebenen zu verstehen. Die Neurowissenschaft untersucht somit den Aufbau und die Funktionsweise des biologischen Nervensystems. Mit diesem vereinten Wissen aus den genannten Disziplinen und der Neurowissenschaft lässt sich beispielsweise das Entstehen von Gedanken und Gefühlen erklären und lokalisieren, was als Voraussetzung zum Verständnis der Beziehung zwischen Gedanke und Handlung dient. (vgl. Raab/Gernsheimer/Schindler 2009, S. 2-4)
Als Neuroökonomie wird somit die Verbindung der Neurowissenschaften (Neurobiologie, -physiologie, kognitive Neurowissenschaft) und den Erkenntnissen der Wirtschaftswissenschaften bezeichnet. (Neuro Economics, 2009). Emotionen und Affekte und deren Bedeutung werden seit mehreren Jahren in der ökonomischen Literatur erwähnt. Eine beweisende Evidenz in diesem Bereich, verlangt aber eine Grenzüberschreitung zu benachbarten Wissenschaftsgebieten wie der Individual- und Sozialpsychologie, der Soziologie – und neuerdings auch der Neurobiologie und -physiologie. Die Neuroökonomie öffnet die bisher verschlossene Black Box Gehirn und stellt den Versuch dar, Einsichten über das Funktionieren des menschlichen Gehirns gezielt für die ökonomische Theorie zu gebrauchen und anzuwenden.
Mitte der 90-er Jahre war der Begriff der Neuroökonomie noch nicht in Gebrauch und auch das Forschungsgebiet, das jetzt unter diesen Namen bekannt ist, existierte noch nicht. Des zu trotz waren bereits einige fundamentale Fakten vorhanden, Hauptideen lagen in der Luft und alle waren bereit sich auf eine neues Zielobjekt zu fokussieren. In den letzten Jahrzehnten hat sich durch den verstärkten Gebrauch experimenteller Studien in der modernen Ökonomik gezeigt, dass das anfängliche Bild des Homo Oeconomicus möglicherweise angepasst werden muss. Ergebnisse der Experimente haben nämlich deutlich gemacht, dass das, durch das Standardmodell prognostizierte Verhalten in einer Reihe von Fällen nicht der Realität entspricht. Es wurde kritisiert, dass die Annahmen über den wirtschaftlich handelnden Menschen nicht mehr stimmen und daher eine Adaption und Erweiterung des bisherigen Modells notwendig ist. Wissenschaftler forderten daher, dass Aspekte der Psychologie und der Sozialwissenschaft integriert werden sollen und diese somit zur besseren Erklärung der Handlungsarten der Menschen in wirtschaftlichen Situationen beitragen sollen. (Guttmann, 2008)
Um zur Neuroökonomie zu gelangen, waren zwei „Partner“ von Nöten: Das sogenannte Behavioral Economics, ein Teilbereich der Wirtschaftswissenschaften der gezielt darauf ausgerichtet ist sich mit menschlichen Verhalten in wirtschaftlichen Situationen zu befassen, einerseits und der Neurowissenschaft (Sammelbegriff für biologische, physikalische, medizinische und psychologische Wissenschaftsbereiche, die den Aufbau und die Funktionsweise von Nervensystemen untersuchen) andererseits.
Für die Entstehung des neuen Fachgebiets der Neuroökonomie waren eine Reihe von neurowissenschaftlichen Entwicklungen von großer Bedeutung und ich möchte beginnen jene zu unterstreichen, die im Zusammenhang mit der neuralen Basis der Entscheidungsfindung stehen:
Zwischen Mitte der 80-er und Mitte der 90-er-Jahre kamen folgende Fakten ans Licht, die kritische Aussagen offenlegten:
a) Im Vorfeld gesunde Individuen, die bilaterale Hirnschäden des ventralen und medialen Bereichs des Cortexes erlitten, zeigten nach Auftreten der Beschädigungen merkliche Fehler bei der Entscheidungsfindung. Diese Fehlerhaftigkeiten zeigten sich beträchtlich vor allem bei sozialen Verhaltensweisen.
b) In zwei Bereichen des Sozialverhaltens waren die Defekte so augenscheinlich, dass so gut wie kein bestimmtes Diagnosemittel mehr nötig war; diese Bereiche waren zum einen die interpersonalen Beziehungen und in besonderem Maße die Entscheidungsfindung hinsichtlich finanzieller Sachverhalte. Für den Bereich der interpersonellen Entscheidungsprozesse eines Individuums bedeutet das, dass Vorlieben und Nutzen, Entscheidungen bei Risiko und Unsicherheit, Lernen, Gedächtnis und Wissen im Mittelpunkt stehen.
c) Patienten mit ventromedial präfrontalen Verletzungen hatten einen bemerkenswert gut erhaltenen Verstand, gemessen von konventionellen neuropsychologischen Instrumenten, und einen ebenso auffälligen Defekt von emotionalen Verhalten. Der emotionale Defekt bestand aus einer generell verminderten emotionalen Resonanz, nebst speziellen und beträchtlichen Beeinträchtigungen in sozialen Emotionen – wie beispielsweise Mitgefühl und Verlegenheit.
Kurz gesagt, Patienten die ein normales Sozialverhalten bis zum Zeitpunkt ihrer Hirndysfunktion aufwiesen und jene die bis dahin keine Probleme mit Geräuschen hatten, schnitten nun schlecht ab und verhielten sich generell gegen ihre eigenen besten Interessen und den Interessen ihrer Gegenüber. Dies geschah trotz ihrer gut erhaltenen intellektuellen Instrumente. Die Patienten wiesen keine feststellbaren Schwächen im rationalen Denken auf, keine Defekte im Lernen und Abrufen des Wissens für Geräuschentscheidungen und keine Mängel in der Sprache und Wahrnehmung. Nun waren ihre Entscheidungen fehlerhaft. Beim Aufzeigen der Fehlerhaftigkeit begriffen sie jedoch, dass sie besser abschneiden gekonnt hätten. Des zu trotz würden sie sehr wahrscheinlich in zukünftigen ähnlichen Situationen wieder dieselben Fehlentscheidungen treffen.
Der Unterschied zwischen schadhaften Emotionen einerseits und verschonten Intellekt andererseits ließ vermuten dass irgendein gestörtes Emotionssignal für die Fehlentscheidungen verantwortlich sein könnte. Diese Idee formte die Basis für die so genannte Somatic Marker Hypothese. (vgl. Glimcher/Camerer/Fehr/Poldrack 2009, S. 209-210)
1.1. Somatic Marker Hypothese
Abbildung 1: Antonio Damàsio
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Damàsio’s Hypothese der Somatischen Marker (SMH) stellt eine einfache neurobiologische Erklärungsmöglichkeit für Patienten mit Verletzungen im ventromedial präfrontalen Cortex gefundene Defizite im Entscheidungsverhalten dar. Die Hauptidee besteht darin, dass der Entscheidungsprozess von Menschen durch sog. Markersignale, d.h. unbewusste emotionale Signale, die Emotionen und Gefühle auslösen, beeinflusst wird. Zunächst soll aber dargestellt werden, wie es zu somatischen (soma ist das griechische Wort für Körper) Zuständen kommt (Weber 2009): Sie können einerseits von primären Auslösern, den sog. Primary Inducers (PI), und anderseits von sekundären Auslösern, sog. Secondary Inducers (SI), hervorgerufen werden. PI sind angeborene und gelernte Stimuli, die angenehme Zustände auslösen. Sind sie einmal präsent lösen sie automatische, unfreiwillige und zwingende körperliche Reaktionen aus. Nachdem ein somatischer Zustand durch einen PI ausgelöst und zumindest einmal erlebt wurde, wird ein Muster für diesen somatischen Zustand angelegt; der folgende Auslöseimpuls, welcher Gedanken oder Erinnerungen an den PI auslöst, tritt somit als SI auf.
Die Amygdala (=Mandelkern) ist ein kritischer Träger im neuralen System für das Auslösen von physischen Zuständen infolge eines PI. Reaktionen in diesen Gehirnregionen werden unter Einbeziehung einer Nervenbindung und automatisch ausgeführt. Kommt es somit zu einer Schädigung der Amygdala, können die Primary Inducers keine somatischen Zustände hervorrufen, da der emotionale Teil gestört ist und somit können auch SI keine somatischen Zustände hervorrufen. SI sind nämlich Einheiten, die durch die Erinnerung an ein individuelles oder vermutliches emotionales Ereignis einen somatischen Zustand auslösen. Diese Einheiten sind entweder Gedanken bzw. auch Erinnerungen an den PI. Die Entwicklung eines SI hängt also von der Entwicklung eines PI ab. (vgl. Raab/Gernsheimer/Schindler 2009, S. 205)
Zusammenfassend kann man also sagen, dass somatische Zustände auf Emotionen basieren und Optionen und Handlungen bemerkenswert beeinflussen. Zudem wurde mit der Somatic Marker Hypothese aufgezeigt, dass diese somatischen Zustände diejenigen Aktivitäten in Regionen beeinflussen, die mit einer Verhaltensreaktion bzw. einer motorischen Reaktion in Verbindung stehen. (vgl. Raab/ Gernsheimer Schindler 2009, S. 209) Wenn wir entscheiden müssen stellen wir uns alle möglichen Handlungsalternativen vor, und urteilen was passieren wird, wenn wir das eine oder andere tun. Würden wir nur Logik anwenden um einen Konflikt zu lösen, würden wir den ganzen Tag brauchen und wären nicht in der Lage uns zu entscheiden in welchen Restaurant wir zu Mittag essen. Dass uns solche Entscheidungen aber leicht fallen, liegt daran, dass wir eine Hilfe über unsere körperlichen Signale vermittelt bekommen. Dieses Signal erlaubt es uns eine schnelle Kosten-Nutzen-Analyse zu machen und Entscheidungen zu treffen, die zwar auf logischen Überlegungen basieren aber auch Emotionen mit einbeziehen. Die somatischen Marker sind nicht dazu da uns zu sagen was wir tun oder nicht tun sollen, sondern uns zu erinnern dass in Anbetracht unserer Vorerfahrung eine bestimmte Handlung und Entscheidung gut und eine andere gefährlich sein wird. Unser Gehirn vergleicht eine neue Situation mit einer ähnlich früheren und diese Verknüpfung informiert uns über unser früheres Werturteil. Damasio meint, dass bei einer Entscheidung alte physiologische Muster in unserem Gehirn und unserem Körper aktiviert werden und Blutdruck, Muskelspannungen und Atmung dieselben Werte annehmen, wie wir sie in früheren Situationen verspürt haben und durch diese erneute Wahrnehmung werden wir in die eine oder andere Richtung gelenkt. War das einstige Erlebnis positiv so neigen wir dazu wieder zustimmend zu reagieren und vice versa. (Aretz, 2004)
Die Neuroökonomie ist eine noch relativ junge Wissenschaft und ihre Vertreter beschäftigen sich vor allem mit der Frage: „Wie ist der Mensch als Konsument zu erforschen und zu bewerten?“ Ihr Ziel ist es besser zu verstehen, warum Menschen sich in bestimmten Situationen nicht rational entscheiden, häufig anders reagieren als gelernt und sogar manchmal entgegen ihrer eigenen Absichten handeln. (Müller, 2004)
1.2. Methodik und Anwendungsfelder
Neurowissenschaftler nützen eine Vielzahl von Methoden, so zum Beispiel die funktionelle Bildgebung, die Lehre von psychischen Erkrankungen und das Verhalten von Patienten mit Gehirnschäden.
Die Hauptaufgabe der Neuroökonomie besteht darin Informationen über das Verhalten der Nervenzellen zu sammeln und somit zu untersuchen wie diese aufeinander einwirken um Entscheidungen zu produzieren. (vgl. Durlauf, 2008) Die Kombination von Neurowissenschaften und Wirtschaftswissenschaften ermöglicht es die zugrunde liegenden mentalen und neuralen Prozesse des Entscheidungsverhaltens aufzuzeigen. Anhand der funktionellen Magnetresonanztomographie (fMRT)[1] kann der Blutfluss verfolgt werden und somit die Aktivitäten der verschiedenen Hirnregionen gemessen werden, während eine Testperson eine rationale Entscheidung trifft. (Müller, 2009) Die unterschiedlichen Abbildungen der Tätigkeit des Hirns lassen somit Schlussfolgerungen auf die an der Problemlösung beteiligten Gehirnregionen zu. Andere vorrangigen Messmethoden der Neuroökonomie sind das Elektroenzephalogramm (EEG)[2], die Magnetenzephalogie (MEG)[3], die Positronenemissionstomografie (PET)[4] (Neuro Economics, 2009). Diese neuen Techniken funktionieren ohne Eingriffe. EEG und MEG setzen bei den elektrischen Potentialen des Gehirns an, PET und fMRT hingegen auf die Stoffwechseleigenschaften des Gehirns (vgl Lehnmann-Waffenschmidt/Hain/Kenning, 2007). Einige oder mehrere dieser Methoden werden dann von den Neurowissenschaftler koordiniert um herauszufinden wie das menschliche Gehirn arbeitet.
Das immer noch weit verbreitete Modell des Homo oeconomicus lässt sich somit anhand dieser Methoden und Verfahren empirisch prüfen. Forscher sind den Gesetzmäßigkeiten auf der Spur, die dem menschlichen Handeln zugrunde liegen.
„Den angeblich stets rational kalkulierenden und entscheidenden, eigeninteressierten und seinen Nutzen auch kurzfristig stets maximierenden Teilnehmer am Wirtschaftsleben gibt es in der Wirklichkeit nur selten.“ ( Horn, 2007)
Anwendungsfelder beziehen sich auf anwendungsorientierte Betriebswirtschaftslehre, Verhaltensökonomie und Umweltökonomie. Der neuroökonomische Ansatz hat neben diesen Grundlagenanwendungsgebieten bereits Verwendung auf den Gebieten „Neuromarketing“ und „Neurofinance“ gefunden (vgl. Lehnmann-Waffenschmidt/Hain/Kenning, 2007).
2. Emotionen: eine kurze Einführung
Während Emotionen in der psychologischen Forschung längere Zeit ein wenig untersuchtes Gebiet darstellten, hat sich das Interesse in den letzten 15 Jahren der Emotionsforschung verstärkt zugewendet und zudem machen moderne Untersuchungsmethoden es möglich, neuronale und physiologische Zusammenhänge seelischer Prozesse, auch von Emotionen zu lokalisieren. Dabei gehen zweckgerechte Verfahren, wie z. B. die funktionelle Kernspintomographie über die altbewährte Neuropsychologie, welche psychische Funktionen mit strukturellen Defekten im Gehirn koordinierte, hinaus.
Kapitel Zwei widmet sich den Emotionen: einerseits in der Psychologie und andererseits in der Ökonomie. Was ist die biologische Funktion von Emotionen? Was deren Bedeutung und Entwicklung? Und wie können diese unsere Entscheidungen sowie unser ökonomisches Verhalten beeinflussen? Dies sind die zentralen Fragen auf die ich in diesen Kapitel versuchen werde einzugehen.
2.1. Der Begriff „Emotion“ in der Psychologie und der Ökonomie
Frauen und Männer jeden Alters, jeder Kultur, jeder Ebene der Erziehung und auf jeden Weg des ökonomischen Lebens haben Emotionen, sind aufmerksam auf Emotionen anderer und steuern ihr Leben nach dem Streben einer besonderen Emotion, dem Glück, und nach dem Vermeiden unangenehmer Emotionen (vgl. Damasio 1999, S. 35). Emotionen haben sich im Laufe der Evolution herausgebildet und sind verzweigte, in weiten Teilen genetisch vorgebildete Verhaltensmuster um bestimmte Anpassungsprobleme zu lösen und den Einzelnen ein schnelles und der Situation angepasstes Handeln zu ermöglichen. Am Zustandekommen sowie am Ablauf von Emotionen sind somit kortikale und subkortikale Mechanismen der Verarbeitung externen und/oder interner Reize, neurophysiologische Muster, motorischer Ausdruck und Motivationsentwicklungen beteiligt. Der motivationale Faktor wird dabei meist als Folge der emotionalen Erregung denn als Teil der Emotion selbst betrachtet, der kognitive Teil eher als Auslöser der Emotionen, aber es bestehen wie bei den meisten innerpsychischen Abläufen sehr enge Interaktionen (Stangl, 2010)
Elster (vgl. Elster, 1998) unterteilt den Emotionsbegriff in sechs Hauptgruppen:
1. Soziale Emotionen: Ärger, Hass, Schuld, Schande, Stolz, Bewunderung, Zuneigung
2. Kontrafaktische Emotionen: Bedauern, Freunde, Enttäuschung, Euphorie
3. Emotionen – hervorgerufen durch den Gedanken, was passieren könnte: Angst, Hoffnung
4. Emotionen – hervorgerufen durch gute/schlechte Dinge, die passiert sind: Freude, Leid
5. Emotionen – hervorgerufen durch den Gedanken an die Besitztümer anderer: Empörung und Eifersucht
6. Spezialfälle, wie Verachtung, Abneigung, Liebe, Verliebtheit
Jede einzelne dieser Emotion besteht aus unzähligen Variationen und Nuancen, abhängig vom Zustand, der sie auslöst. Jede spielt eine bestimme Rolle und führt dadurch zur Entstehung von Lebensverhältnissen und äußeren Umständen; sie handeln somit über das Leben eines Organismus und ihre Aufgabe besteht darin den Organismus bei der Lebenserhaltung zu unterstützen. Ungeachtet der Realität, dass Lernen und Kultur die Expression von Emotionen verändern und Emotionen neue Bedeutungen geben, sind sie biologisch festgelegte Prozesse, abhängig von angeborenen Hirneinheiten und festgeschrieben von einer langen evolutionären Geschichte (vgl. Damasio 1999, S. 43)
Löwenstein (vgl. Löwenstein/Read/Baumeister, 2003) unterscheidet zwischen zwei Typen von Emotionen, die das Verhalten beeinflussen können: erwartete Emotionen und unmittelbare Emotionen. Erwartete Emotionen unterscheiden sich von den unmittelbaren Emotionen darin, dass sie erlebt werden, wenn Ergebnisse einer Entscheidung konkrete Formen annehmen und nicht im Moment der Entscheidung wie bei den unmittelbaren Emotionen. Löwenstein unterstreicht die Bedeutung unmittelbarer Emotionen für ökonomische Entscheidungen, da sie keine Abhängigkeit von langwierigen Kosten-Nutzen Abwägungen aufweisen.
Die Emotion läuft auf verschiedenen seelischen Funktionsebenen ab und ist somit ein komplexer Prozess. Emotionen unterliegen nicht unserer Kontrolle und können sie nur teilweise kontrollieren und unterdrücken, z.B. indem wir Traurigkeit nicht zeigen. Das subjektive Erleben der Emotionen bezeichnet man hingegen als Gefühl, wie z.B. Lust, Geborgenheit, Liebe, Trauer, Angst, Glücklich sein und Freude und ist von einer Emotion grundlegend zu entscheidend. Gefühle werden herkömmlicherweise als verschieden von Empfindungen, Wahrnehmungen und Denken, aber auch vom Wollen angesehen, können sich jedoch mit allen anderen Erfahrungsarten verbinden (vgl. Damasio, 2002)
Im Vergleich zu Stimmungen sind Emotionen relativ kurz und intensiv. In der Psychologie werden Stimmungen als Form des angenehmen oder unangenehmen Fühlens bezeichnet und spielen eine entscheidende Rolle in der Motivation. Erfahrungen erscheinen als durch Stimmungen „eingefärbt“, so als erlebe man die Realität durch eine Gefühlsbrille: Bei trüber Stimmung beispielsweise wirkt die Welt als „grau in grau“. Was also erlebt wird, ist in erster Linie nicht eine erfahrene Klassifizierung, sondern diese folgt üblicherweise erst nach dem Erlebnis des Gestimmtseins.
Zusammenfassend kann man also sagen dass der Begriff Emotion im Allgemeinen gebraucht wird um die affektiven Erfahrungen zu erfassen. In Emotionstheorien wird der Ausdruck gebraucht, um einzelne Reaktionen auf ein internes oder externes Ereignis aufzuzeigen, das eine Reihe von synchronisierten Eigenschaften, eingeschlossen subjektiver Erfahrungen, Äußerungen, körperlichen Verhalten und Handlungstendenzen auferlegen (vgl. Glimcher/Camerer/Fehr/Poldrack, 2009, S. 234-239)
2.2. Die biologische Funktion von Emotionen
Emotionen werden als sich über eine lange Geschichte evolutionärer Feinabstimmungen entwickelnde Eigenarten des Menschen und der Tiere verstanden. Diese stammesgeschichtliche Untersuchung der Evolution von Emotionen stellt also die Frage nach ihrem Zweck bzw. ihrer biologischen Funktion. Schon Darwin beobachtete für seine Evolutionstheorie die Parallelen im emotionalen Ausdruck bei Menschen und Tieren und schloss durch Betrachtung von Menschen aus verschiedenen Teilen der Welt, dass der emotionsspezifische Ausdruck universell verbreitet ist.
Die Stärke der Emotionen beeinflusst wie stark eine Person erregt ist und wie stark sich dieses Gefühl auf Denken und Handeln auswirkt. Die Emotionspsychologin Carol E. Izard (1981) gibt drei Verhaltensebenen an, die Emotionen beschreiben und definieren: das subjektive Erlebnis, die neurophysiologischen Vorgänge und das beobachtbare Ausdrucksverhalten (insbesondere im Gesicht). Emotionen bewirken somit organische Veränderungen, wie beispielsweise Muskelverspannungen, Erweiterung und/oder Verengung der Pupille, Schweißausbruch, Magentätigkeit, erhöhte Herzfrequenz, Verkrampfungen sowie schnelle Atmung (Stangl 2010).
Der biologische Kern der Emotionen:
- Emotionen sind ein komplexes Gebilde von neuralen sowie chemischen Reaktionen und ihre Hauptaufgabe besteht darin, den Organismus zu unterstützen am Leben zu bleiben.
- Emotionen hängen von angeborenen Hirnstrukturen ab und sind biologisch determinierte Prozesse. Daher können Lernen und kulturelle Einflüsse nur das Bild von Emotionen ändern.
- Mechanismen, von Emotionen ausgelöst, können automatisch in Gang gesetzt werden
- Das Gebiet subcortikaler Regionen, wo sich die Strukturen befinden die Emotionen erzeugen, ist verhältnismäßig eng und sehr begrenzt.
- Emotionen dienen unserem Überleben und sind somit Teil der bioregulativen Mechanismen.
- Emotionen bereiten den Organismus durch Regulierung des inneren Zustands auf spezifische Reaktionen vor. (vgl. Damasio, 2002)
Das biologische „Ziel“ der Emotionen ist somit klar ersichtlich und sie stellen ein unverzichtbares Luxusgut dar. Sie sind sonderbare Anpassungen und somit Teile des Mechanismus welcher organisches Überleben regelt. Man kann sich Emotionen vorstellen als eingepfercht zwischen der elementaren Überlebensausrüstung (z.B. einfache Reflexe, Motivationen, Angst und Freude, Regulierung des Metabolismus) und den Einheiten von hoher Bedeutung, die aber immer noch Teil der Hierarchie der lebensregulierenden Einheiten sind.
Emotionen sind Teil der selbststabilisierenden Regulierung und unabdingbare Größen für zahlreiche Ereignisse und Objekte unserer autobiografischen Erfahrung. Sie sind beispielsweise untrennbar von der Idee der Belohnung oder Bestrafung, der Freude und der Angst, der individuellen Vor- oder Nachteile – Emotionen sind zwangsläufig untrennbar vom Guten und Bösen(vgl. Damasio 1999, S. 53-55). Damasio beschreibt den Nutzen und die Funktion von Emotionen wie folgt:
- Gefühle sind ein integraler Bestandteil und ihr Fehlen gefährdet die menschliche Rationalität. Somit sind rationales Handeln und Entscheiden ohne Gefühle nicht möglich.
- Getreu der Hypothese der somatischen Marker werden beim Überlegen und Entscheiden die Konsequenzen der Handlungsalternativen nicht nur rational durchdacht, sondern auch emotional bewertet.
- Emotionen bzw. Gefühle dienen den menschlichen und tierischen Überlebenskampf (vgl. Damasio 1994).
2.3 Bedeutung und Entwicklung der Emotionen
Die Bedeutung von Emotionen liegt darin, dass sie den Organismus mit überlebensorientierten Verhaltensweisen versorgen. Sie wirken bei ihrem Erscheinen auf den Geist ein und Organismen, die erkennen dass sie Gefühle haben, erreichen eine Stufe der Regulation, die die innere Wirkung der Emotionen verstärkt.
Die Basisaufgabe der Emotionen besteht darin, dass sie Teil homöostatischer Regulationen sind und dazu da sind, Quellen aufzusuchen die Energie, Sexualität oder Schutz versprechen. Emotionen treten somit unter zwei Bedingungen auf:
- bei der Verarbeitung des Organismus bestimmter Objekte oder Situationen mit einem seiner Sinnesapparate, und
- wenn der Geist eines Organismus bestimmte Objekte oder Situationen aus der Erinnerung abruft und sie somit als Vorstellungen im Denkprozess darstellt.
Organismen haben im Laufe der Evolution die Gelegenheit erworben, mit den Emotionen auf bestimmte Reize zu reagieren, im Besonderen auf jene, die dem Überleben nützlich und gefährlich sind. Obwohl emotionale Mechanismen ein gewisses Maß an biologierscher Vorprogrammierung haben, hat Entwicklung und Kultur haben selbstverständlich einen entscheidenden Anteil an ihrer letztendlichen Ausprägung (vgl. Damasio 2002).
Bei der Erklärung der Entstehung und Entwicklung von Emotionen lassen sich im Wesentlichen zwei Ansätze unterscheiden:
- einerseits wird angenommen, dass sich die einzelnen Emotionen aus einen unspezifischen Erregungszustand des Säuglings allmählich entwickeln: Wenn Neugeborene lächeln oder schreien, haben sie höchstwahrscheinlich keine emotionalen Empfindungen, da bei der Geburt im Stirnhirn bezüglich Emotionalität des Neugeboren kaum etwas vorhanden ist. Die emotionalen Empfindungen entwickeln sich erst in den nächsten Jahren im Mandelkern aus. Und
- andererseits wird angenommen dass „grundlegende“ Emotionen als angeborene Mechanismen von Geburt an vorhanden sind: Nach der Auffassung, dass Emotionen durch angeborene neurale Mechanismen bestimmt sind wird angenommen dass das bewusste subjektive Erleben von Gefühlen erst dadurch zustande kommt, dass Veränderungen in der Gesichtsmuskulatur vom Gehirn zurückgemeldet werden.
Grundsätzlich lässt sich aber nicht eindeutig sagen, welche Emotionen angeboren und welche später erlernt werden, aber es gibt sicherlich grundlegende Gefühle, die in jeder Kultur und allezeit existieren, an bestimme neurale Prozesse gebunden sind, die zu einen bestimmen Zeitpunkt auftreten und die gleichen biologischen Rückmeldemuster verwenden. Der Psychologe Caroll E. Izard (1994) ist der Ansicht, dass zehn unterschiedliche Gefühle existieren, die auf der ganzen Welt und in jeder Kultur vorkommen: Interesse, Leid, Widerwillen, Freude, Zorn, Überraschung, Scham, Furcht, Verachtung und Schuldgefühl.
Bei fundamentalen Emotionen geht man davon aus, dass es zwischen einem bestimmten Gefühl und dem entsprechenden Gesichtsausdruck eine enge Beziehung gegen muss. So ist beispielsweise das Senken und Zusammenziehen der Augenbrauen und das Zusammenpressen des Mundes immer und überall mit Zorn verbunden (Stangl, 2010).
Zusammenfassend kann man sagen, dass die Entwicklung von Emotionen in den ersten Lebensjahren angelegt wird und sich im Laufe der Jahre eine Veränderung der Gefühle als auch der Reaktionen vollzieht. Die Entwicklung von Emotionen sowie die Art und Weise es zu äußern sowie der Zeitpunkt es zu zeigen, verläuft wahrscheinlich in jeder Gesellschaft unterschiedlich. Trotz der Annahme fundamentaler und angeborener Gefühlsregungen hat dennoch jede Kultur andere Ausdrucksformern oder Gründe für Gefühle entwickelt.
2.4 Wie Emotionen unsere Entscheidungsfindung beeinflussen
„So lange es Emotionen gibt, kann es keine perfekte Welt geben.“
(Eduard V. Eckardt)
Die meisten ökonomischen Theorien unterstreichen in ihren Modellen den Einfluss rationalen Denkens auf ökonomische Entscheidungen. Im Mittelpunkt menschlichen Handels soll die Gewinnmaximierung stehen. Wie aber treffen Menschen Entscheidungen? Was läuft ab in uns, sind wir uns dessen überhaupt bewusst ober trifft das Unbewusste selbständige Entscheidungen? Im folgenden Abschnitt werde ich kurz darauf eingehen, dass Gefühle bei einer Entscheidungsfindung eine weit stärkere Rolle spielen als angenommen.
Emotionen helfen grundsätzlich eine Entscheidung zu treffen und spielen somit eine entscheidende Rolle in der Entscheidungsfindung: Man trifft im Laufe des Tages eine Menge von Entscheidungen, ohne darüber nachzudenken. Dabei werden manche Entscheidungen „aus dem Bauch heraus“ – aus der Emotion – während andere, weitreichendere und wichtigere, Entscheidungen eher vom Kopf gesteuert werden.
Menschen treffen ihre Entscheidungen nicht rational, sondern lassen sich von Emotionen leiten und beeinflussen. Deshalb sind viele nicht entscheidungsfähig, weil ihr Gefühl in Konflikt mit den rationalen Emotionen gerät und sie schwanken somit ständig zwischen verschiedenen Möglichkeiten ohne eine endgültige Entscheidung zu treffen. (Kraus 2006)
In vielen Situationen bietet die Rational-Choice-Theorie[5] nämlich keine eindeutige und optimale Lösung und somit ermöglichen Emotionen, im Gegenzug dazu in vielen Fällen eine besserer Entscheidung, da dabei auch Überraschungen, Missverständnisse und unlösbare Konflikte mit einbezogen werden. Des Weiteren können Emotionen nicht nur eine Entscheidung sondern unter bestimmten Umständen die beste Entscheidung herbeiführen. In beiden Fällen ist somit eine Entscheidung, die durch Emotionen und Verstand beeinflusst wird, vorteilhafter als eine rein rationale Entscheidung. (vgl. Seefried 2008)
2.4.1. Rationale Entscheidungen
Äpfel oder Birnen? Ein Versprechen einhalten oder nicht? Wir werden ständig mit Entscheidungsproblemen konfrontiert und normalerweise unterscheiden wir zwischen vernünftigen und unvernünftigen Entscheidungen. Wodurch unterscheiden sich jedoch vernünftige bzw. rationale Entscheidungen von unvernünftigen?
Um eine Antwort auf diese Fragen zu finden, ist es wichtig, dass man die Umstände, in denen Entscheidungen getroffen werden, berücksichtigt. Es lassen sich somit drei unterschiedlich theoretische Ansätze unterscheiden:
- die sog. Entscheidungstheorie: Die Umstände sind so beschaffen, dass bei der Entscheidung der Person keine Interaktionen mit anderen vernunftbegabten Wesen berücksichtigt werden müssen.
- Spieltheorie: Hier spielen Interaktionen mit anderen für mich und meine Entscheidungen eine Rolle; das Ergebnis einer Entscheidung hängt somit von mehreren Entscheidungsträgern ab.
- Logik kollektiver Entscheidungen: Untersuchung des Zustandekommens rationaler Entscheidungen von Gruppen, in denen sich die Beteiligten der Interdependenzen bewusst sind.
Diese drei Ansätze liegen der Idee zugrunde, dass die Rationalität unserer Entscheidungen zum einen von unseren Wünschen und Überzeugungen und zum anderen von der Möglichkeit diese Wünsche zu realisieren, abhängt (vgl. Sellmaier 2007) Die Rationalität ist somit verantwortlich für die Übereinstimmung unserer Präferenzen, unserem Wissen um die Umstände der Entscheidung und unseren Handlungsalternativen – dies kann uns als Kriterium dienen, ob eine Entscheidung rational ist oder nicht.
Der Homo Oeconomicus, der Entscheidungen rein rational abwägt, erweist sich jedoch als Illusion der klassischen Wirtschaftstheorie. Gefühle galten seit Jahrhunderten als „nicht edel“ und wurden nahezu verachtet. Plato, beispielsweise, hielt Emotionen für eine Art Krankheit und er glaubte, dass nur mit dem Verstand ließe sich der „Dämon der Gefühle“ zähmen. Er urteilt, dass Emotionen irrational seien und das Denken beeinflussen. Der Franzose René Descartes (1956 bis 1650) ist einer der meistzitierten Philosophen in der Dekade des Gehirns. Sein Irrtum, bestand darin, dass er den Geist vom Körper grundlegend getrennt hat und annahm, dass das Denken sich losgelöst vom Körper vollziehe. Aber auch andere Philosophen jener Zeit verurteilen Emotionen als „Denkfehler“ (Aretz, 2004) Und bis heute halten wir immer noch die Vernunft als wichtiger.
Mr. Spock aus der Science-Fiction-Serie Raumschiff Enterprise gilt das heimliche Vorbild zu sein, wenn es darum geht eine wichtige Wahl zu treffen. Er kennt keine Emotionen und ist in der Lage sehr klare Analysen zu geben. Man muss sich allerdings bewusst sein, dass zu einer guten Entscheidung sowohl Gefühle als auch rationale Argumente von Nöten sind. (Kraus 2006)
„Emotionen sind keineswegs ein Luxus! Unglücklicherweise werden sie in der Wissenschaft und im Allgemeinen in unserer Kultur als eine Art Luxus angesehen oder als etwas Hinderliches – manchmal gut, wenn sie positiv sind, aber sehr lästig, wenn sie negativ sind. Und natürlich können Gefühle extrem hinderlich sein. Wenn man etwas durchdenken will und ist innerlich aufgewühlt oder sehr verstört, kann man in der Tat nicht gut denken. Das ist bekannt. Wir wissen, dass Emotionen eine heikle Sache sein können, aber es stimmt ebenfalls, dass wir ohne Emotionen in Bezug auf unsere Entscheidungen ziemlich dumm dastehen würden.“ (vgl. Damasio 1994)
Somit scheinen Emotionen für eine Entscheidung unabdingbar zu sein und sie beeinflussen unser Denken, Handeln, Urteilen und Verhalten stärker als uns bewusst ist.
Wissenschaftler der Harvard Universität haben Untersuchungen durchgeführt, wie schnell emotionale und rationale Denkprozesse auf einen Entscheidungsreiz erfolgen und was dabei passiert. Das Erstaunliche daran war, dass die emotionale Reaktion fast doppelt so schnell erfolgt wie die rationale. 220 bis 260 Millisekunden nach einem Reiz fühlen wir: „Das mach ich“ oder „Das will ich“. Und erst ab 480 bis 640 Millisekunden beginnt der Verstand zu kalkulieren und rationalisiert. Wir versuchen also eine Entscheidung, die wir emotional schon längst gefällt haben, rational zu begründen. (Mai, 2008)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 2: Entscheidungsgewalt
2.4.2 Intertemporale Entscheidungen
Wie bereits erwähnt spielen Emotionen eine entscheidende Rolle bei der Entscheidungsfindung. Bei intertemporalen Entscheidungen[6] haben Forschungen ergeben, dass Personen negative und positive Emotionen sowohl von aktuellen Ereignissen, als auch von erwarteten, zukünftigen Ergebnissen ableiten. (Seefried, 2008) Ökonomische Beispiele dieser Art sind beispielsweise, die Entscheidung zwischen geringen Konsum heute und erhöhtem Konsum morgen, alle Arten von Investitionsentscheidungen und jegliche Entscheidungen bezüglich des Humankapitals. Jedoch auch Entscheidungen unseres Alltags spielen eine bedeutende Rolle für unsere zukünftiges Leben und insbesondere jene die mit unserem gesundheitlichen Status verbunden sind. Die Entscheidung für eine Zigarette oder ein alkoholische Getränk ist beispielweise verbunden mit der Suchtgefahr einerseits ober aber mit der Entscheidung darauf zu verzichten und gesünder zu leben. Daneben gibt es noch Entscheidungen, die unsere Leben nicht direkt bedrohen ober ebenfalls wichtig sind. Ein Beispiel hierzu wäre die Entscheidung noch im Bett zu bleiben oder sich der Arbeit zu widmen. (vgl. Löwenstein/Read/Baumeister, 2003)
Mit solchen Entscheidungen, beschäftigt sich die Entscheidungstheorie der klassischen Nationalökonomie. Sie unterteilt dabei folgende drei Bereiche: Entscheidungen unter Sicherheit, Entscheidungen unter Risiko und Entscheidungen unter Unsicherheit (vgl. Fishburn 1987, S.779-782). Von Entscheidungen unter Sicherheit spricht man in der Entscheidungstheorie dann, wenn der Entscheidungsträger sämtliche Folgen aus einer Handlung vorhersagen kann und den eintretenden Umweltzustand sicher kennt. Entscheidungen unter Risiko sind hingegen jene, wenn dem Entscheidungsträger die Wahrscheinlichkeiten für das Eintreten der möglichen Umweltzustände bekannt sind. Von Entscheidungen unter Unsicherheit spricht man wenn der Eintritt von zukünftigen Umweltzuständen nicht mit Sicherheit vorausgesagt werden kann.
2.4.3. Regret- und Disappointment – Theorie
Wie bereits erwähnt haben Emotionen eine starke Auswirkung auf unser tägliches Leben: sie leiten unser Verhalten und ihr Einfluss ist so tiefgreifend, dass eine Entscheidungstheorie erst dann komplett ist, wenn ihre Rolle berücksichtigt wurde. Wir verspüren beispielsweise Gefühle der Freude und Begeisterung wenn wir eine Entscheidung getroffen haben, die für uns zu einen guten Ergebnis führen. Andererseits tendieren wir zu negativen und unangenehmen Gefühlen, wenn wir uns wünschen eine bessere Entscheidung getroffen zu haben. Diese und andere Emotionen beeinflussen und leiten unseren Entscheidungen (vgl. Marcatto/Ferrante 2008, S. 87)
Regret (= Bedauern) und Disappointment (= Enttäuschung) sind die zwei Emotionen, auf die ich in diesem Kapitel genauer eingehen möchte. Obwohl diese Emotionen viel gemeinsam haben, gibt es klare Unterschiede, die für die Entscheidungsfindung relevant sind. Das Hauptelement vieler Entscheidungen liegt darin, dass sie mit einen bestimmten Grad an Ungewissheit verbunden sind (vgl. Zeelenberg/van Dijk/Manstead/van der Pligt, 2000 S. 521). Wir sind oft unsicher und ungewiss über zukünftige Ereignisse: Werden sie stattfinden und falls ja, wie werden wir uns entscheiden sobald sie eintreten? Obwohl unsere Erwartungen meistens bestätigt werden (vgl. Higgins/Kruglanski 1996, S. 211) sind Abweichungen keine Seltenheit und deshalb treten negative Emotionen auf wenn unsere aktuelle Lage schlechter ist als eigentlich erwartet. Im Zusammenhang der Entscheidungsfindung gibt es mindestens zwei Wege wie solche verletzten Erwartungen mit negativen Emotionen enden:
1. All jene Situationen, in denen die gewählte Option schlechter endet als die abgelehnten Optionen: Dies ist immer dann der Fall wenn wir eine bestimmte Wahl treffen, weil wir meinen dies sei die Beste, sich aber dann herausstellt dass doch eine andere besser gewesen wäre. Folgen wird solchen „schlechten Entscheidungen“ werden wir sehr wahrscheinlich ein Gefühl des Bedauerns empfinden.
2. All jene Situationen, in denen die gewählte Option mit einen schlechteren Ergebnis endet als erwartet: Solche „widerlegten Entscheidungen“ geben Anlass zu einem Gefühl der Enttäuschung. (vgl. Zeelenberg/van Dijk/Manstead/van der Pligt, 2000 , S. 522)
Die Idee dass „regret“ und „disappointment“ eine Rolle bei der Entscheidungsfindung spielen ist keinesfalls neu. Die Ökonomen Loomes und Sugden (vgl. Quiggin 1994, S. 153) erarbeiten unabhängig voneinander eine Regret Theorie und eine Disappointment Theorie. Diese Theorien nehmen an, dass Entscheidungsträger Emotionen als Folge von getroffenen Entscheidungen erfahren. Wichtiger ist jedoch, die Aussage dass angenommen wird, dass die Entscheidungsträger jene Emotionen vorwegnehmen und diese dann in Betracht ziehen sobald sie eine Entscheidung fällen. Folglich dieser Theorien basieren Entscheidungen auf einer Regret und Disappointment Aversion, d.h. auf der Tendenz Entscheidungen so zu fällen, dass diese zukünftigen negativen Emotionen minimiert werden (vgl. Glimcher/ Camerer/ Fehr/ Poldrack 2009, S. 129-130).
In diesen ökonomischen Theorien werden regret und disappointment begrifflich unterschiedlich erfasst. Obwohl beide aus dem Vergleich zwischen „Was ist?“ und „Was hätte sein sollen?“ stammen, wird angenommen dass regret aus dem Vergleich zwischen dem tatsächlichen Ergebnis und dem kontrafaktischen Ergebnis, das hätte sein sollen wenn man anders entschieden hätte, stammt. Bei disappointment wird hingegen angenommen, dass es aus dem Vergleich zwischen dem tatsächlichen Ergebnis und dem kontrafaktischen Ergebnis, das hätte unter anderen erwarteten weltlichen Umständen sein sollen. (vgl. Zeelenberg/van Dijk/Manstead/van der Pligt, 2000, S. 529)
Die zentrale Idee dieser Regret- und Disappointment Theorien besteht also darin, dass mögliche zukünftige Emotionen in Betracht gezogen werden wenn es darum geht den erwarteten Nutzen von verschiedenen Handlungsweisen zu bestimmen und diese vorausgesagten emotionalen Reaktionen somit Entscheidungsergebnisse beeinflussen (vgl. Zeelenberg/van Dijk/Manstead/van der Pligt, 2000, S. 531). Was aber bleibt ist die Frage wie diese erwarteten Emotionen unsere Entscheidungen beeinflussen? Entscheidungsträger können verschiedene Strategien wählen um zukünftiges Bedauern oder Enttäuschen vorherzusehen oder zu vermeiden:
- Erstens können Menschen Entscheidungen einfach vermeiden, das heißt sie werden Entscheidungsavers. Keine Entscheidung zu fällen verhindert sowohl Bedauern und Enttäuschung. Allerdings ist eine solche Strategie nicht besonders nützlich, weil die meisten Situationen eine Entscheidung erfordern. Darüber hinaus kann es durch diese Entscheidungsvermeidung zu langfristigen Nachteilen führen, weil wir unsere inaktive Entscheidungshaltung bedauern.
- Zweitens können Menschen ihren Entscheidungsprozess verzögern. Eine solche Verzögerung verschiebt außerdem den Erhalt eines Feedbacks über das Ergebnis der Entscheidung und verhindert dadurch das Erfahren von Bedauern oder Enttäuschung. Diese Strategie führt jedoch zu den gleichen Nachteilen wie gar keine Entscheidung zu fällen. Allerdings kann ein Hinausschieben einer Entscheidung vorteilhaft sein um Bedauern zu verhindern. Bedauern führt dazu, dass Menschen das Gefühl bekommen es besser gewusst zu haben. Eine Verzögerung könnte somit hilfreich sein beim Vermeiden dieses Gefühls, wenn die Verzögerung dafür genutzt wird um Informationen zu sammeln ,die relevant für die Entscheidung sind und somit zu einer besseren Entscheidung führen. Wenn alles in Betracht gezogen wurde ist die Wahrscheinlichkeit dass man denke, man sollte es besser wissen müssen, kleiner und somit ist auch ein Bedauern von geringeren Wahrscheinlichkeit. (vgl. Zeelenberg/ van Dijk/ Manstead/ van der Pligt, 2000 , S. 534)
Regret und disappointment sind also zwei verschiedene Emotionen, die aus verschiedenen Grundlagen stammen und mit unterschiedlichen Beurteilungen verbunden sind. Ein Bedauern tritt meistens in Situationen auf, in denen man verantwortlich ist oder sich verantwortlich fühlt für das Auftreten eines negativen Ereignisses. Die Enttäuschung ist in der Regel eine Reaktion auf erfahrene unerwartete Ereignisse, die entweder durch unkontrollierbare Umstände oder durch eine andere Person verursacht wurden.
Werden die Ergebnisse von Entscheidungs- und Emotionsforschung zusammengefasst kann es zu sehr vielen interessanten Fragestellungen kommen. Eine dieser Fragen betrifft die Dynamik dieser Emotions-Verhalten Interaktion. Welche Rolle spielen überhaupt Emotionen bei unserem Entscheidungsverhalten und wie beeinflussen sie es?
2.5. Emotionen und ökonomisches Verhalten
„Die Gegenwart gibt es praktisch überhaupt nicht, so sehr sind wir damit beschäftigt, mit Hilfe der Vergangenheit zu planen, was als nächstes kommt, jetzt gleich oder in einer fernen Zukunft. Um diesen alles vereinnahmenden, niemals zum Stillstand kommenden Schöpfungsprozess geht es beim Denken und Entscheiden.“
(Antonio Damasio)
Wirtschaft, so wird oft angenommen, hat absolut nichts mit Emotionen und Gefühlen zu tun. In der Ökonomie findet man nämlich als Leitbild den sog. homo oeconomicus wieder, ein nutzenmaximierender Mensch, der seine Entscheidungen rein rational abwägt. Diese unterstellte Rationalität bedeutet, dass er aus mehreren Alternativen immer die Günstigste hinsichtlich seiner Nutzenmaximierung wählt. Dieses Menschenbild sei außerdem mit unendlich viel Zeit, Wissen, vollständigen Informationen und unerschöpflichen Kapazitäten versehen und der Einfluss von Emotionen auf Entscheidungen wird weitgehend außer Acht gelassen und sogar verleugnet. (vgl. Raab/ Gernsheimer/ Schindler 2009, S.219). Doch der Glaube, dass man ökonomische Entscheidungen völlig frei von Gefühlen trifft, stellt sich als Irrtum heraus: Trauer und gute Laune haben beispielsweise sehr wohl einen deutlichen Effekt auf unser Kaufverhalten. So verfällt man bei blendender Laune, ist vielleicht noch zusätzlich ein paar Tage im Urlaub, sehr viel leichter in einen Kaufrausch und erwirbt plötzlich Güter, die man im heimatlichen Alltag nicht einmal erwägen würde. Ist die eigene Stimmung dagegen gedämpft, hält sich die Kauflust eher in Grenzen.
Doch woran liegt es, dass Emotionen bisher weitgehend ignoriert wurden? Dies liegt letztendlich nicht nur daran, dass Emotionen nie genau definiert und quantifiziert wurden. Emotionen zu messen ist nicht einfach und so ignorieren traditionelle ökonomische Theorien meistens deren Einfluss und lassen Emotionen bei Forschungen lieber außer Betracht (vgl. Yu/Zhou, 2007), S. 1155).
Ökonomische Modelle der Entscheidungsfindung nehmen an, dass Entscheidungsträger die Wahl zwischen alternativen Handlungen durch die Beurteilung der Zweckmäßigkeit und der Wahrscheinlichkeit ihrer Folgen abwägen. Ökonomen beziehen diese Zweckmäßigkeit auf den Nutzen eines Ergebnisses und die Entscheidungsfindung wird somit als Nutzenmaximierung betrachtet. Das bedeutet jedoch nicht, dass Entscheidungsträger frei von Emotionen sind und deren Einfluss ignorieren. Um dies genauer zu betrachten, ist es deshalb sinnvoll eine Unterscheidung zwischen „erwarteten“ und „sofortigen“ Emotionen vorzunehmen:
- Erwartete Emotionen sind diejenigen, die als Folge von Ergebnissen voraussichtlich auftreten werden. Wenn man beispielsweise zwischen der Entscheidung steht eine Aktie zu kaufen oder nicht, wird man ein Gefühl der Enttäuschung erwarten wenn der Preis der gekauften Aktie daraufhin fällt. Andererseits wird man ein Gefühl des Bedauerns bzw. eine Erleichterung verspüren wenn man nicht kauft bzw. der Preis steigt oder fällt. Das Hauptmerkmal erwarteter Emotionen liegt darin, dass sie erfahren werden, wenn die Ergebnisse einer Entscheidung zustande kommen und nicht schon im Moment der Wahl; zum Zeitpunkt der Wahl sind sie nur Wahrnehmungen über zukünftige Emotionen.
- Sofortige Emotionen werden hingegen im Augenblick der Entscheidung erfahren, und fallen in eine dieser zwei Kategorien: Emotionen ähnlich der erwarteten Emotionen, entstehen als Folge einer Entscheidung. Emotionen, die verschieden der erwarteten Emotionen sind, werden hingegen im Moment der Entscheidung erfahren.
Wie bereits anhand der Regret-Theorie gesehen wurde, beginnen Verhaltensökonomen immer häufiger die Wichtigkeit von Emotionen bei Entscheidungen zu betonen: Entscheidungsträger können ihr Bedauern voraussagen, das sie verspüren werden wenn sie bemerken, dass ihr Ergebnis ihrer getroffenen Entscheidung nachteilhaft ist im Gegensatz zu den alternativen Ergebnissen der nicht gewählten Entscheidungen. Die Regret-Theorie behauptet somit, dass Menschen jene Entscheidung wählen, die ihr zukünftiges Bedauern minimieren. (vgl. Loewenstein/Rick 2008, S. 138)
Natürlich sind Emotionen nicht immer vorteilhaft für Entscheidungen. Extreme Emotionen können zu irrationalen Verhaltensweisen führen wie beispielsweise ein Verbrechen aus Leidenschaft. Der Einfluss von Emotionen auf Entscheidungsprozesse kann sowohl positiv als auch negativ sein, abhängig von der Situation in der die Entscheidung getroffen wurde. Forschungen haben ergeben, dass Dysfunktionen des neuronalen Systems, die Emotionen fördern, zu günstigeren Entscheidungen führen. Diese Forscher verwendeten eine einfache Investitionsaufgabe um die Rolle von Verlusten versus Gewinnen bei Einzelpersonen mit Suchtverhalten zu untersuchen. Am Anfang der Aufgabe wurden alle Probanden mit 20$ Spielgeld ausgestattet. Die Versuchspersonen mussten sich dann zwischen zwei Optionen entscheiden: entweder 1,00 $ zu investieren, oder nicht. Falls man die Entscheidung traf nicht zu investieren, durfte die Person den Dollar behalten, und das Spiel ging in die nächste Runde. Entschied sich die Person hingegen fürs Investieren, musste sie den Experimentator einen Dollarschein übergeben. Das Subjekt verlor entweder den investierten Dollar oder gewann 2,50 $ je nach dem Ergebnis der geworfenen Münze des Versuchsleiters. Personen mit Suchtverhalten tendierten eher zu investieren als gesunde Probanden, auch wenn sie mit der Wahrscheinlichkeit eines Verlustes konfrontiert wurden. Während die gesunden Probanden sich eher von der riskanten Option zurücknahmen, vor allem nach einem Verlust, ließen sich die Süchtigen wenig von den Ergebnissen der Vorrunden beeinflussen. Zudem zeigte eine weitere Studie, dass Patienten mit Hirnläsionen im Bereich betreffend den Emotionen, vorteilhaftere Entscheidungen trafen und somit schlussendlich mehr Geld aus ihren Investitionen verdienten als normale Teilnehmer. Diese Studien unterstützen die Hypothese, dass Emotionen eine zentrale Rolle bei der Entscheidungsfindung unter Risiko und somit unserem ökonomischen Verhalten spielen. Sie zeigen, dass das Aufarbeiten von Emotionen bei Erwartungswert-Spielen Personen zu besseren Entscheidungen führen, das die meisten Menschen aber routinemäßig vermeiden. (vgl. Yu/Zhou 2008, S. 1156)
Eine besondere Bedeutung muss jedoch auch den viszeralen Faktoren (viszeral = die Eingeweide betreffend) zugesprochen werden. Diese Faktoren beziehen sich auf eine breite Palette von negativen Gefühlen (z.B. Wut und Angst), Antriebsgefühlen (z.B. Hunger, Durst, sexuelles Verlangen) und den Gefühlsstatus (z.B. Schmerzen), die die Aufmerksamkeit der Leute auf sich ziehen und sie zu bestimmten Verhaltensweisen anregen. Wie herkömmliche Präferenzen, bestimmen sie die trade-offs zwischen verschiedenen Dingen und Aktivitäten: Hunger, beispielsweise, erhöht die Vorliebe fürs Essen. Das besondere Kennzeichen von Präferenzen ist aber ihre Konsistenz und kurzfristige Stabilität. Viszerale Faktoren, im Gegensatz, können Wünsche rasch verändern weil sie selbst von wandelnden, internen, körperlichen Zuständen und äußeren Reizen beeinflusst werden.
Historisch betrachtet, werden viszerale Faktoren oder „Leidenschaften“ als eine Art zerstörerische Kraft menschlichen Verhaltens angesehen. Trotz ihrer Fähigkeit Schaden anzurichten, dienen die viszeralen Faktoren jedoch den wesentlichen Funktionen: das Fehlen irgendeiner solchen viszeralen Funktion senkt die individuelle Lebensqualität, die Überlebenschancen oder die Wahrscheinlichkeit der Fortpflanzung. Menschen, die beispielsweise keinen Hunger verspüren, essen nicht, diejenigen, die über keine Schmerzrezeptoren verfügen, verstümmeln sich versehentlich selbst und auch nur subtile emotionale Defizite können zu dramatischen Folgen führen. Demzufolge ist es nicht übertrieben, wenn behauptet wird, dass viszerale Faktoren fundamentaler für das tägliche Funktionieren sind als die höheren kognitiven Prozesse, die, wie oft angenommen, der Entscheidungsfindung zugrunde liegen.
Viszerale Faktoren werden traditionell oft auch als sprunghaft und unvorhersehbar bezüglich des Verhaltens angesehen, aber wieder hat ein Blick auf die Population diese Ansicht zerstört. Sicherlich fluktuieren Gefühle oft und rasch, ihre Veränderbarkeit darf aber nicht mit ihrer Unvorhersehbarkeit verwechselt werden. In der Tat, sind sowohl die Bestimmungsgrößen der viszeralen Faktoren sowie deren Einfluss auf das Verhalten sehr systematisch, während die kognitiven Überlegungen, die gemeinhin als die Quelle der Stabilität im Verhalten gesehen werden, eine wichtige Quelle der Unvorhersehbarkeit. Um dies zu erläutern möchte ich auf folgendes Beispiel verweisen: Kokain-Ratten, die freien Zugang zu Kokain erhalten, verabreichen sich wiederholt selbst die Droge, bis sie vor Erschöpfung kollabieren oder sterben. Das Verhalten von menschlichen Süchtigen ist weitaus komplexer, da sich menschliche Drogenabhängige kognitiv den langfristigen Folgen der Drogeneinnahme bewusst sind.
Zusammenfassend kann also gesagt werden, dass viszerale Faktoren vergänglich sind, aber das von ihnen produzierte Verhalten ist langlebig und hat wichtige Auswirkungen sowohl für Einzelpersonen als auch für die Gesellschaft. Einerseits, weil diese Faktoren dazu führen, dass Menschen zu extremen Maßnahmen greifen, und andererseits, weil wichtige Entscheidungen starke Emotionen bei Entscheidungsträgern verursachen; viele der wichtigsten Entscheidungen im Leben werden unter dem Einfluss von intensiven viszeralen Faktoren getroffen. Ökonomen wissen um die Problematik bezüglich der Darstellung und Modellierung der Emotionen. Löwenstein betont dass Personen einerseits durch viszerale Faktoren beeinflusst werden und somit oftmals nicht in ihrem Eigeninteresse handeln, und andererseits wird der Einfluss viszeraler Faktoren auf gegenwärtiges und zukünftiges Verhalten tendenziell unterschätzt. (vgl. Löwenstein 2000, S. 426-428)
Neue Impulse zur Rolle der Emotionen auf das ökonomische Verhalten kommen aber aus dem Bereich der Neuroökonomie.
[...]
[1] Bildgebendes Verfahren zur Darstellung von aktivierten Strukturen im Inneren des Körpers, hauptsächlich des Gehirns.
[2] Methode zur graphischen Darstellung der Spannungsschwankungen an der Kopfoberfläche.
[3] Verfahren zur Messung der magnetischen Aktivität des Gehirns.
[4] Bildgebendes Verfahren, das biochemische und physiologische Funktionen abbildet.
[5] Die handelnden Subjekte weisen ein rationales Verhalten auf, wobei diese Subjekte aufgrund gewisser Präferenzen ein nutzenmaximierendes (oder kostenminimierendes) Verhalten zeigen.
[6] Intertemporale Entscheidungen sind Entscheidungen, die Auswirkungen in mehreren Perioden haben.
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Erstausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2010
- ISBN (Paperback)
- 9783958201613
- ISBN (PDF)
- 9783958206618
- Dateigröße
- 1.3 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Libera Università di Bolzano
- Erscheinungsdatum
- 2015 (Februar)
- Schlagworte
- Somatic Marker Hypothese rationale Entscheidung intertemporale Entscheidung Regret Disappointment Regret und Disappointment-Theorie
- Produktsicherheit
- BACHELOR + MASTER Publishing