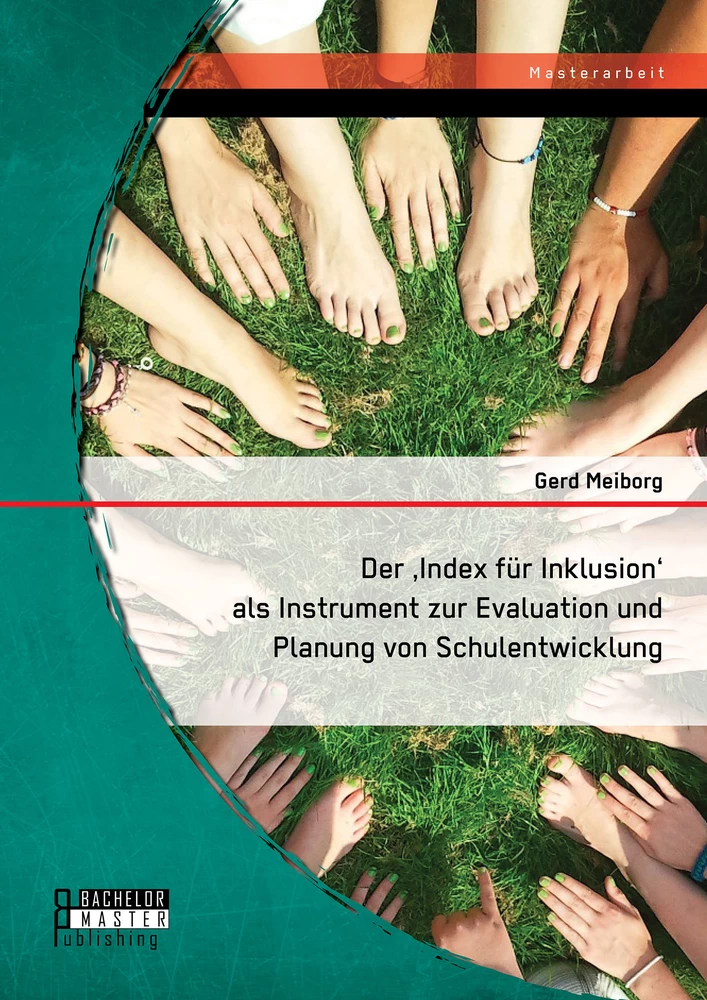Der ‚Index für Inklusion‘ als Instrument zur Evaluation und Planung von Schulentwicklung
Zusammenfassung
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
3 Inklusion
3.1 Begriffsklärung
Der Begriff Inklusion ist für die Bundesrepublik Deutschland noch relativ neu und es kann noch nicht von einem allgemeinen Verständnis, geschweige denn von einer allgemeingültigen Definition dessen, was unter diesem Begriff zu verstehen ist, ausgegangen werden (vgl. Land Niedersachsen 2012, S. 105; Schumann 2009, S. 73). Erstmalig findet sich der Begriff Inklusion in der Erklärung von Salamanca (UNESCO) und wird dort im Kontext von Bildung und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen benutzt.
In die Öffentlichkeit gelangte Inklusion durch den Artikel 24 der Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen aus dem Jahre 2006, der 2008 in Kraft trat und 2009 von der Bundesrepublik Deutschland unterzeichnet wurde. Hier wird der englische Begriff inclusive (wie bereits in der Salamanca-Erklärung) ebenfalls konsequent mit integrativ übersetzt (Beauftragter der Bundesregierung für die Belange behinderter Menschen 2010, S. 35)[1]. Alfred Sander ist der Auffassung, diese Form der Übersetzung „trug wesentlich dazu bei, dass der Inklusionsbegriff lange Zeit in der deutschen Sonderpädagogik nicht aufgegriffen - oder dann mit Integration gleichgesetzt wurde“ (Sander 2011, S. 13). Diese Auffassung bestätigt auch Hans Wocken, der von einer „babylonischen Sprachverwirrung“ spricht und dafür ebenfalls die seiner Meinung nach „inkorrekte Übersetzung englischsprachiger Dokumente ins Deutsche“ verantwortlich macht (Wocken 2011a, S. 59). Erst die sog. ‚Schattenübersetzung‘[2] des NETZWERK ARTIKEL 3 e.V. greift die Formulierung des Originals wieder auf: „gewährleisten die Vertragsstaaten ein inklusives Bildungssystem auf allen Ebenen“ (Beauftragter der Bundesregierung für die Belange behinderter Menschen 2010, S. 35).
Die Entwicklungsstationen des Begriffs Inklusion, bezogen auf das Bildungswesen, lassen sich in Deutschland anhand der Empfehlungen der Kultusministerkonferenz nachzeichnen. Aus deren Verlautbarungen seit Ende des Zweiten Weltkrieges wird deutlich, dass es in den 50er und 60er Jahren vornehmlich darum ging, die Eigenständigkeit des Sonderschulwesens zu gewährleisten und die Ausdifferenzierung auf nunmehr 13 unterschiedliche Sonderschulformen voranzutreiben (vgl. Wachtel 2013). Hintergrund dieser Bemühungen war die Überzeugung, dass die Sonderschule aufgrund ihres Fachpersonals und entsprechender technischer Einrichtungen in besonderer Weise geeignet sei, die positive Entwicklung Behinderter (so der offizielle Ausdruck) zu gewährleisten. Diese zeitliche Phase kann mit dem Begriff ‚Separation‘ überschrieben werden. Im Gegensatz zur bis in das 18. Jahrhundert vollzogenen ‚Exklusion‘ von Menschen mit Behinderungen stellt Separation jedoch durchaus eine qualitative Weiterentwicklung dar.
Eine leichte Wende lässt sich in den 70er Jahren feststellen. Parallel zum Aufkommen der Integrierten Gesamtschulen konstituierte sich der Deutsche Bildungsrat als Nachfolgeeinrichtung des Deutschen Ausschusses, zusammengesetzt aus der Bildungskommission und der Regierungskommission. Der von der Bildungskommission berufene Ausschuss „Sonderpädagogik“ bereitete die Empfehlung des Deutschen Bildungsrates aus dem Jahre 1973 mit dem Titel „Zur pädagogischen Förderung behinderter und von Behinderung bedrohter Kinder und Jugendlicher“ vor: „In ihr ist das erste offizielle Dokument zu sehen, das in der Bundesrepublik die Gemeinsamkeit von Behinderten und Nichtbehinderten im allgemeinen Schulwesen empfiehlt“ (Muth 2009, S. 41). Der Begriff der ‚Integration‘ wird in die Bildungslandschaft eingeführt. Die KMK-Empfehlung aus dem Jahre 1994 (Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland 2008) macht bereits im Titel diese Wende auch inhaltlich sichtbar, als sie nicht mehr von ‚Sonderschulbedürftigkeit‘, sondern von ‚sonderpädagogischem Förderbedarf‘ spricht und damit „eine eher personenbezogene, individualisierende und nicht mehr vorrangig institutionenbezogene Sichtweise sonderpädagogischer Förderung“ (Wachtel 2013) in den Vordergrund hebt. Dadurch ist sonderpädagogische Förderung nicht mehr an die Schulform Sonderschule gebunden, sondern kann auch in allgemeinbildenden Schulen erfolgen. Es dauert allerdings noch bis zum Jahre 2010, bis der Begriff Inklusion in einer Empfehlung der KMK auftaucht (Kultusministerkonferenz 2010) und noch ein weiteres Jahr, bis auch der Titel einer KMK-Empfehlung ihn enthält (Kultusministerkonferenz 2011).
Durch das im März 2012 vom Niedersächsischen Landtag beschlossene Gesetz zur Einführung der inklusiven Schule, das ebenfalls für Schulen in privater Trägerschaft gilt (Land Niedersachsen 2012, S. 105), kommt das Land Niedersachsen laut Aussage des niedersächsischen Kultusministeriums der Verpflichtung nach, den Artikel 24 der Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen umzusetzen (Niedersächsisches Kultusministerium 2012, S. 6). Dadurch wird Eltern von Kindern und Jugendlichen, die einen Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung haben, das Recht zugesprochen, zwischen einer Förder- und einer Regelschule für ihr Kind zu wählen.
Insgesamt kann die „qualitative Entwicklung“ (Wocken 2011b, S. 15) des Schulwesens bezogen auf Menschen mit Behinderungen folgendermaßen dargestellt werden:
- „Exklusion: Behinderte Kinder waren bzw. sind von jeglichem Schulbesuch ausgeschlossen. Beispiel: die Situation in deutschen Landen im 18. Jahrhundert.[3]
- Separation: Behinderte Kinder besuchen eigene Bildungseinrichtungen (Sonderschulen). So in Deutschland seit Ende des 19. Jahrhunderts.[4]
- Integration: Behinderte Kinder können mit sonderpädagogischer Unterstützung Allgemeine Schulen besuchen.
- Inklusion: Alle behinderten Kinder besuchen wie alle anderen Kinder mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen Allgemeine Schulen, welche die Heterogenität ihrer Schüler und Schülerinnen schätzen und im Unterricht fruchtbar machen“ (Sander 2011, S. 15).
Der Begriff Inklusion [lateinisch inclusio, Einschluss; auch Einbeziehung, Eingeschlossenheit, Dazugehörigkeit] und was darunter zu verstehen ist, ist in Deutschland allerdings weiterhin nur vage bekannt und wird auch von Fachleuten uneinheitlich gebraucht (vgl. Sander 2011, S. 15). Bezogen auf deren Umsetzung entzündet sich die Diskussion einerseits an der Rolle der Sonderschulen, die bereits in den 50er und 60er Jahren, vertreten durch den Verband der Sonderschulen (vds), mithilfe von Denkschriften die Empfehlungen der Kultusministerkonferenz massiv beeinflusst haben. Während Hans Eberwein den Sonderschulen deren Existenz aufgrund fehlender „wissenschaftstheoretischer, pädagogischer und politischer“ Begründungen abspricht und ergänzt, dass „soziale Integration […] nicht durch schulische Separation bewerkstelligt“ (Eberwein 2009, S. 27) werden kann, sind nach Otto Speck „zunächst bzw. nach wie vor für bestimmte Schülerinnen und Schüler mit Behinderungen spezielle Einrichtungen im Sinne von Ausnahmeregelungen bereitzuhalten“ sowie den Eltern „ein bedingtes Wahlrecht bezüglich der Schulart oder des Lernortes für ihr behindertes Kind zu[zugestehen]“ (Speck 2010, S. 132). Dieser Ansicht folgt auch das Land Niedersachsen, wenn es den Bestand der Förderschulen (Ausnahme: Förderschwerpunkt ‚Lernen‘) gewährleistet, den Eltern ein Wahlrecht zugesteht und dies mit dem „Wohl des Kindes“ begründet (Land Niedersachsen 2012, § 4).
Andererseits werden der bisherigen Integrationspraxis Fehler angelastet. Während Andreas Hinz insgesamt 14 Unterschiede zwischen Integrations- und Inklusionspraxis tabellarisch auflistet und gegenüberstellt (Hinz 2011, S. 25), fasst Wocken drei Vorhaltungen, die „von der Inklusion an die Adresse der Integration vorgebracht werden“ (Wocken 2011b, S. 61) zusammen:
1. Zwei-Gruppen-Theorie: Der Integrationsgedanke geht von der Vorstellung aus, dass es eine normative Gruppe (die der Kinder ohne Förderbedarf) gibt, in die eine andere Gruppe von Kindern (diejenigen mit Förderbedarf) integriert werden muss.
2. Assimilationstendenz: Auf der Grundlage der o.g. Zwei-Gruppen-Theorie strebt die Integration eine ‚Normalisierung‘ der zu integrierenden Kinder an. Dabei wird gegen den Gedanken der „egalitären Differenz“ (vgl. Prengel 1997) oder des „Miteinander der Verschiedenen“ (vgl. Müller-Friese 1996) verstoßen.
3. Defizitäre Integrationspraxis: Die Ressourcen der Kinder werden zu wenig oder gar nicht beachtet. Es wird eher davon ausgegangen, dass sie nicht so leistungsfähig sind wie andere Kinder und deshalb den größten Teil der Zeit nicht in gemeinsamen Lernsituationen, sondern separiert in Förderkursen verbringen.
Sander versucht eine Brücke zu schlagen, indem er drei Definitionen von Inklusion unter Einbeziehung des Begriffs Integration anbietet: „Inklusion I“ bezeichnet er als „undifferenzierte Gleichsetzung mit Integration“, „Inklusion II“ als die „von Fehlformen bereinigte Integration“ und schließlich „Inklusion III“ als „optimierte und umfassend erweiterte Integration“ (Sander 2011, S. 13/14). Auch Wocken geht es mit der Aussage „Der Widersacher von Inklusion ist nicht Integration, sondern Aussonderung“ (Wocken 2011b, S. 62) nicht darum, die Integration in eine „Schmuddelecke“ (Wocken 2011b, S. 61) abzuschieben und damit eine schwerwiegende und nachhaltige Abwertung der Integration (Preuss-Lausitz 2006) entstehen zu lassen, sondern deutlich zu machen, dass „Inklusion […] in mancher Hinsicht nicht eine Wieterentwicklung der Integration sondern eine wichtige Rückbesinnung auf ihre Ursprünge“ ist (Wocken 2011a, S. 63) und dass „Kinder mit Behinderungen systematisch exkludiert sind und in der Tat erst einmal in die allgemeinen Schulen integriert werden müssen“ und daher „im Kontext der Behindertenpädagogik […] der Integrationsbegriff […] völlig korrekt und sinnig [ist]“ (Wocken 2011a, S. 66). Allerdings macht er auf einen wesentlichen Unterschied im Zuge der Behindertenrechtskonvention aufmerksam: „Die menschenrechtstheoretische Orientierung der Behindertenrechtskonvention ist zweifelsohne auch dienlich zur Unterscheidung von Integration und Inklusion. Integration appellierte an den guten Willen, an Humanität und Freiwilligkeit; Inklusion stellt sich nicht zur Diskussion und beruft sich auf ein einklagbares Recht“ (Wocken 2011a, S. 74).
Während die Behindertenrechtskonvention dafür gesorgt hat, dass der Begriff Inklusion Eingang in unsere Gesellschaft gefunden und zu einer rechtlichen Anerkennung der Menschen mit Behinderungen geführt hat, wird dadurch gleichzeitig häufig einer begrifflichen Verengung Vorschub geleistet. Obwohl von Anfang an klar gestellt wurde und wird, dass Inklusion alle Kinder betrifft (vgl. Booth et al. 2003, S. 10), „wird er [der Begriff ‚Inklusion; Zusatz des Verfassers] – anders als der soeben diskutierte Begriff Integration – [beispielsweise] kaum innerhalb des Fachdiskurses der Migrationsforschung gebraucht“ (Leiprecht 2012, S. 49). Ähnliches gilt gleichermaßen für die Bereiche Gender, soziale Schichtzugehörigkeit oder Hochbegabung. Dieses „wenige Verständnis“ von Inklusion bezeichnet Tony Booth als Relikt aus der „special needs education“ (Booth 2010, S. 2). Insofern ist es lohnenswert, über eine verstärkte Hinwendung zur ‚Pädagogik der Vielfalt‘ nachzudenken, die Ende der 80er Jahre und im Laufe der 90er Jahre von Annedore Prengel entwickelt wurde (Prengel 1993). Eine Schlüsselrolle spielt der dabei von ihr entfaltete Begriff der „egalitären Differenz“ in Form einer doppelten Anerkennung, nämlich als „gleich“und „verschieden“. Gleichheit in Hinsicht auf Grundbedürfnisse und Rechte (Menschenrechte) sowie Verschiedenheit als nicht zu nivellierende Individualität und Einzigartigkeit eines jeden Menschen, der in seiner Vielschichtigkeit, Veränderlichkeit und Unbestimmtheit zu respektieren ist (vgl. Prengel 2013). In diesem Sinne kann in puncto Schule der abschließenden Definition von Gottfried Biewer zugestimmt werden:
„Inklusive Pädagogik bezeichnet Theorien zur Bildung, Erziehung und Entwicklung, die Etikettierungen und Klassifizierungen ablehnen, ihren Ausgang von den Rechten vulnerabler und marginalisierter Menschen nehmen, für deren Partizipation in allen Lebensbereichen plädieren und auf eine strukturelle Veränderung der regulären Institutionen zielen, um der Verschiedenheit der Voraussetzungen und Bedürfnisse aller Nutzer/innen gerecht zu werden“ (Biewer 2009, S. 193).
An dieser Stelle böte sich ein Exkurs über den Behinderungsbegriff an, da auch dieser oft ungenau und verengt benutzt wird. Allerdings würde dies den Rahmen dieser Arbeit sprengen.
3.2 Der ‚Index für Inklusion’
„The Index offers schools a supportive process of self-review and development, which draws on the views of staff, governors, students and parents/carers, as well as other members of the surroundding communities” heißt es im Vorwort des ‚Index for Inclusion’, der nach dreijähriger Entwicklungszeit im Jahre 2000 der Öffentlichkeit vorgestellt und 2002 publiziert wurde (Booth und Ainscow 2002, S. 1). Ein Jahr später stand dieses Instrument zur Evaluation und zur Entwicklung von Schulen mit dem Ziel einer ‚Schule der Vielfalt‘ durch die Übersetzung von Andreas Hinz und Ines Boban von der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg auch in deutscher Sprache zur Verfügung (Booth et al. 2003). Inklusion wird darin als Ideal beschrieben, „nach dem Schulen streben können, das aber nie vollständig erreicht wird“ (Booth et al. 2003, S. 10). Inklusion ist ein nicht endender „Prozess von gesteigertem Lernen und zunehmender Teilhabe aller Schülerinnen“ (Booth et al. 2003, S. 10), bei dem die Nutzung des Index „sichern soll, dass der Prozess der Bestandsaufnahme und Planung von Veränderungen und ihrer Umsetzung in der Praxis selbst inklusive Qualität hat“ (Booth et al. 2003, S. 9). Aus Gründen der Partizipation und Teilhabe aller ist der Index mehrperspektivisch angelegt und lässt darüber hinaus unterschiedliche Einstiegspunkte in den Entwicklungsprozess einer Schule zu. „It’s something you can dip in and out of, and doesn’t pretend to say: right you need to start here“ (Booth und Ainscow 2002, S. 2).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 2: Die vier Elemente des ‚Index für Inklusion‘
Grundsätzlich versteht sich der Index nicht als „zusätzliche Aktion zur Schulentwicklung”, sondern als ein Hilfsmittel im Rahmen von Schulentwicklung, „ein inklusives Leitbild zu entwickeln“ (Booth et al. 2003, S. 8). Der Index enthält vier Elemente (s. Abbildung 2).
Die Schlüsselkonzepte haben die Aufgabe, „einen Begriffsrahmen für die Diskussion um die Entwicklung von Inklusion in Bildung und Erziehung“ zu bieten (Booth et al. 2003, S. 9). So wird unter der Überschrift ‚Inklusion‘ beschrieben, was der Index unter diesem Begriff versteht. Schlüsselbegriffe dazu sind: Wahrnehmung, Akzeptanz, Wertschätzung und Teilhabe (vgl. Booth et al. 2003, S. 10). Das zweite Schlüsselkonzept ‚Barrieren für Lernen und Teilhabe‘ wendet sich gegen jegliche Etikettierung von Kindern, sei es von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf, Deutsch als Zweitsprache, Hochbegabung usw. und ersetzt daher auch den Begriff des ‚sonderpädagogischen Förderbedarfs‘ durch den Begriff ‚Hindernisse für Lernen und Teilhabe‘. Damit wird einerseits die Ursachenforschung für nicht gelingendes Lernen bzw. für Behinderungen beim Lernen von der Person auf die jeweilige Institution und andererseits die Aufmerksamkeit darauf gelenkt, „was für die Verbesserung von Erziehung und Bildung für alle [Hervorhebung v. Verf.] Kinder getan werden muss“ (Booth et al. 2003, S. 12). Im dritten Schlüsselkonzept ‚Ressourcen für die Unterstützung von Lernen und Teilhabe‘ wird auf die möglichen Synergieeffekte bei der Nutzung von bisher brachliegenden Ressourcen in Schule und Gemeinde hingewiesen (vgl. Booth et al. 2003, S. 13). Das vierte Schlüsselkonzept ‚Unterstützung der Vielfalt‘ zielt auf Planung und Durchführung von Unterricht, bei dem die Frage nach zusätzlichem Personal nur als eine Facette der möglichen Unterstützung angesehen wird. Als weitere ebenso wichtige Faktoren werden genannt:
- Berücksichtigung der unterschiedlichen Lernausgangslagen und Lernstile
- kooperative Lernformen
- Verantwortung aller Lehrkräfte für die Weiterentwicklung von Unterricht
- Abwendung vom defektologischen zum kontextualen Diagnosemodell
- Aufdecken von institutioneller Diskriminierung (vgl. Booth et al. 2003, S. 13/14).
Den Rahmen für die Analyse der jeweiligen Schulsituation (Ist-Zustand) bilden drei Dimensionen, die jeweils in zwei Bereiche gegliedert sind (s. Abbildung 3).
Die Dimension A ‚Inklusive Kulturen schaffen‘, in der es um eine Kultur der Anerkennung, Wertschätzung, des Respekts, des Vertrauens und der Achtung aller in Schule tätigen Menschen geht, ist bewusst als „Fundament des Dreiecks“ gewählt worden, um auf diese Weise die Bedeutung und das Veränderungspotential von Schulkulturen hervorzuheben und wird von Hinz und Boban „Herzstück von Schulentwicklung“ (Booth et al. 2003, S. 14) genannt. Die hohe Bedeutung der Schulkultur, die auch als ‚Ethos einer Schule‘ oder als ‚Geist der Schule‘ bezeichnet werden kann, für die Qualität von Schule wurde bereits in den 70er Jahren mit der Rutter-Studie (Rutter und et al. 1980) in Großbritannien nachgewiesen. Auch Allan Dyson (2012, S. 5) und Rolf Werning (2012, S. 51) nennen die ‚Schulkultur‘ als einen der vier Aspekte[5] guter inklusiver Schulen. Die Werte, die diese Kultur ausmachen, sind somit „leitend für alle Entscheidungen und Alltagspraktiken“ (Booth et al. 2003, S. 15) und führen in die Dimension B ‚Inklusive Strukturen etablieren‘, die den Focus auf die Entwicklung eines inklusiven Leitbildes setzt, das die Ziele und Visionen deutlich macht, wie „auf die Vielfalt der Schülerinnen und Schüler einzugehen“ (Booth et al. 2003, S. 15) ist. Die Dimension C ‚Inklusive Praktiken entwickeln‘ beschreibt schließlich die Aktivitäten der Schule, ihre inklusive Kultur und die entsprechenden Strukturen im Alltag der Schule – hier insbesondere im Unterricht – sichtbar werden zu lassen.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 3: Der Rahmen für die Analyse der Schulsituation nach dem Index für Inklusion
Die zwei Bereiche einer jeden Dimension dienen dazu, die „Komplexität der Aktivitäten“ deutlich zu machen, bzw. einen „Analyserahmen“ zu bieten, „innerhalb dessen der Planungsprozess für die Schulentwicklung strukturiert werden kann“ und die darüber hinaus als Überschriften fungieren können (Booth et al. 2003, S. 16).
Jedem Bereich sind fünf bis elf Indikatoren (diese repräsentieren jeweils einen Aspekt von Schule) zugeordnet, während wiederum die Bedeutung eines jeden Indikators durch mehrere Fragen erklärt wird (vgl. Booth et al. 2003, S. 16). Im Zusammenhang mit den Fragen wird im Index nochmals deutlich darauf hingewiesen, dass es sich um frei editierbare, modifizierbare Vorschläge handelt wie auch die Indikatoren nicht vollständig bzw. vollzählig abgearbeitet werden müssen, sondern je nach Bedürfnislage und Schwerpunktsetzung der jeweiligen Schule ausgewählt werden können. Es wird allerdings vor der Gefahr gewarnt, auf diese Weise unliebsame Bereiche der Schule auszuklammern oder ihnen auszuweichen (vgl. Booth et al. 2003, S. 18).
Der Index-Prozess als viertes Element des Index‘ beschreibt den Prozessablauf (s. Abbildung 4) und verdeutlicht durch seine Parallelen zu anderen Modellen von Schulentwicklungsprozessen nochmals, dass der Index-Prozess selbst ein Schulentwicklungsprozess ist und kein Additum.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 4: Prozessablauf des Index für Inklusion
Während die Phasen zwei bis fünf anderen Schulentwicklungskreisläufen[6] gleichen, wird beim Index-Prozess noch die Phase 1 vorgeschaltet, die mit dem Material des Index‘ und dessen Verwendung vertraut machen und parallel dazu die Konstituierung einer Koordinationsgruppe, des Index-Teams, welches sich mit der Gestaltung des Index-Prozesses beschäftigt, ermöglichen soll (vgl. Booth et al. 2003, S. 18).
4 Die Arbeit mit dem Index für Inklusion
4.1 Phase 1: Mit dem Index beginnen
4.1.1 Hintergrund
Die Heinrich-Albertz-Schule hat seit ihrer Gründung kontinuierlich auf der Grundlage ihres Slogans und ihres Leitbildes ein Schulprogramm weiterentwickelt und dieses regelmäßig fortgeschrieben. Dazu trafen sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, einige Eltern sowie Vertreterinnen und Vertreter des Trägervereins alljährlich zu einer mehrtägigen Klausurtagung zu Beginn der Sommerferien, um mit Methoden der Organisationsentwicklung (vgl. u.a. Philipp 1994; Eikenbusch 1998) den Ist-Zustand der Schule zu analysieren und auf dieser Basis Schulentwicklungsziele zu formulieren, festzuschreiben und in Form konkreter Arbeitsschritte schulprogrammatisch festzuhalten. Insofern war bereits eine wichtige Voraussetzung für erfolgreiche Schulentwicklung gegeben, denn „Schulentwicklung ist nur nachhaltig, wenn eine Infrastruktur für Lernen der Schule als Organisation aufgebaut wird, wozu Steuergruppen, Teamstrukturen und eine Feedbackkultur gehören“ (Rolff 2007, S. 20).
Die datenbasierte Analyse, von der Hans-Günter Rolff behauptet, „dass die Schulentwicklungsbewegung zum Aufbau und zur Verbreitung eines Bewusstseins, dass Entscheidungen über Schulentwicklung auch datenbasiert sein müssen, beigetragen hat“ (vgl. z.B. Altrichter und Rolff 2006, S. 5), stellt für die Heinrich-Albertz-Schule eine Neuerung dar. Dies lässt sich mit Jan von der Gathen kommentieren, nämlich dass „eine auf 'empirische Daten' basierte Schulentwicklung […] insbesondere im deutschen Schulwesen eine neue Herausforderung für Lehrkräfte dar[stellt]“ (Gathen 2006, S. 13). Hinzu kommt, dass bisher Datenerhebungen mehrheitlich extern an die Schulen herangetragen werden (VERA, IGLU, TIMMS, PISA etc.) oder – insofern es sich um Instrumente der Selbstevaluation handelt wie beispielsweise SEIS[7] –, sich die Kollegien mit einer großen Fülle von Daten (large scale assessments) konfrontiert sehen, deren Auswertung, Interpretation und Umsetzung einen großen Zeitaufwand bedeuten und daher häufig den Schulentwicklungsprozess zum Stocken bringen (vgl. Boomgarden 2006).
Der ‚Index für Inklusion‘ begegnet dieser Gefahr dadurch, dass er von vornherein als ein Instrument zur Selbstevaluation angelegt ist und durch seine offene Struktur eine individuelle Bearbeitung durch das jeweilige Kollegium zulässt. Durch die gemeinsame Bearbeitung in der vorgelagerten Phase 1 (wie bereits beschrieben) wird gewährleistet, dass die Kolleginnen und Kollegen ein gemeinsames Verständnis haben und auf dieser Grundlage gemeinsam eine Schwerpunktsetzung vornehmen können. Durch das breit gefächerte Spektrum der Bereiche innerhalb der drei Dimensionen wird ebenfalls von Beginn an deutlich, dass Schulentwicklung alle drei Bereiche von Schule – Organisationsentwicklung (OE), Personalentwicklung (PE) und Unterrichtsentwicklung (UE) – berührt und bestätigt damit die Auffassung Rolffs, „Keine UE ohne OE und PE, keine OE ohne PE und UE, keine PE ohne OE und UE. [...] Auf der Ebene konzeptioneller Überlegungen zeigt sich also, dass Entwicklung von Einzelschule keine Domäne eines einigen Ansatzes, sondern eine Synthese von OE, UE und PE ist“ (Rolff 2007, S. 15/16). Zusammenfassend lässt sich das Verständnis der Heinrich-Albertz-Schule von Schulentwicklung (OE, PE, UE) und Schulprogramm mit dessen sechs Bausteinen anhand folgender Graphik (s. Abbildung 5) darstellen:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 5: Schulentwicklung in Anlehnung an Schratz (2003) und Rolff (2007)
4.1.2 Umsetzung an der Heinrich-Albertz-Schule
Begonnen wurde mit Phase 1 des ‚Index für Inklusion‘ auf Anregung der Schulleitung am 8. Juli 2011 im Rahmen einer mehrtägigen Klausurtagung im Haus Hessenkopf, einer Fortbildungsstätte der Braunschweigischen Landeskirche in der Nähe von Goslar. Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Tagung waren neben den Lehrkräften der Schule auch Sozialpädagogen und Eltern sowie Vertreterinnen und Vertreter des Trägervereins der Schule. Damit werden bereits zwei Bedingungen gelingender Schulentwicklung bekräftigt bzw. berücksichtigt. Zum einen wird die Bedeutung einer starken Schulleitung unterstrichen (vgl. Holtappels 2004, S. 194; Rolff 2007, S. 17; Schratz et al. 2010; Dyson 2012, S. 5), zum anderen die wichtige Rolle der Elternpartizipation für einen erfolgreichen Schulentwicklungsprozess beachtet. So verweist Werning in diesem Zusammenhang auf die Bedeutung der Einbeziehung von Eltern in Großbritannien bei den sog. ‚extended schools‘[8] (Werning 2012, S. 57).
Im Rahmen dieser Informationsphase wurden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aufgefordert, mithilfe der ‚Placemat-Methode' Antworten auf die Frage zu finden, was sie mit dem Begriff Inklusion verbinden. Dazu sollte der Satz „Inklusion in Erziehung und Bildung bedeutet…" vervollständigt werden. Die Ergebnisse dieser Arbeitsphase wurden dann mit der Definition „Inklusion in Erziehung und Bildung bedeutet…“, die von Boban und Hinz (Booth et al. 2003) auf Seite 10 in Abb. 1 vorgeschlagen werden, verglichen.
Der dort abgedruckte Katalog (s. Abbildung 6) wurde um folgende Aussagen ergänzt:
- individuelle Leistungsmessung ausgehend von der jeweils individuellen Lernausgangslage,
- individuelle Lernziele,
- Vergleich anhand von Standards,
- das Wissen um die Wechselwirkung von Beziehungen aller an Schule beteiligter Gruppen,
- Hilfe zur Selbsthilfe,
- Ressourcenorientierung,
- Stärkung des „Wir"-Gefühls der gesamten Schulgemeinschaft.
Gestrichen wurden aus der Aufzählung folgende Aussagen:
- die Anerkennung, dass alle Schülerinnen und Schüler ein Recht auf wohnortnahe Bildung und Erziehung haben (Da die Heinrich-Albertz-Schule eine Angebotsschule ist und Kinder aus dem gesamten Stadtgebiet beschult, trifft dieser Teil der Definition auf sie nicht zu.),
- die Verbesserung von Schulen nicht nur für Schülerinnen und Schüler, sondern auch für alle anderen Beteiligten (Auf diesen Teil der Definition wurde verzichtet, da er für die Anwesenden zu ungenau war. Stattdessen wurde die oben genannte Formulierung „Das Wissen um die Wechselwirkung von Beziehungen aller an Schule beteiligter Gruppen" gewählt.),
- den Anspruch, dass Inklusion in Erziehung und Bildung ein Aspekt von Inklusion in der Gesellschaft ist (Den Anwesenden war klar, dass Inklusion ein Anspruch an die Gesamtgesellschaft ist und Schule nur einen Aspekt der Gesellschaft darstellt. Für die Weiterentwicklung der Heinrich-Albertz-Schule erschien der Arbeitsgruppe dieser Punkt jedoch sekundär.).
Dieser Arbeitsschritt diente dazu, ein gemeinsames gedankliches Fundament zum Begriff und zur Vorstellung von Inklusion als Grundlage für die Weiterarbeit zu schaffen.
Im Anschluss daran füllten die Anwesenden (in Einzelarbeit) den Fragebogen 1: Indikatoren (Booth et al. 2003, S. 99–100) aus, auf dem alle Indikatoren aller drei Dimensionen gelistet sind. Mit diesem Schritt rückte – ausgehend von der gefundenen allgemeinen Beschreibung von Inklusion – die eigene Schule in den Focus. Zur Auswertung wurden alle ausgefüllten Fragebögen nebeneinander gelegt und ermittelt, welchen Indikatoren die Anwesenden ‚voll zustimmen‘, denn nur bei voller Zustimmung aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollte der entsprechende Indikator für die Heinrich-Albertz-Schule als umgesetzt gelten.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 6: Inklusion in Bildung und Erziehung (Quelle: Booth et al. 2003, S. 10)
4.1.3 Ergebnisse
4.1.3.1 Bereits erfolgreich an der Schule umgesetzte Indikatoren des Index
Auf Grundlage der oben beschriebenen Untersuchung wurden von dem Team folgende Indikatoren der drei Dimensionen als erfolgreich umgesetzt gekennzeichnet:
Dimension A: Inklusive Kulturen schaffen
- die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten zusammen
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Schülerinnen und Schüler beachten einander als Person und als Rollenträgerinnen und Rollenträger
- die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter versuchen, Hindernisse für das Lernen und die Teilhabe in allen Bereichen der Schule zu beseitigen
- die Schule bemüht sich, alle Formen von Diskriminierung auf ein Minimum zu reduzieren
Dimension B: Inklusive Strukturen etablieren
- der Umgang mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Schule ist gerecht
- neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wird geholfen, sich in der Schule einzugewöhnen
- allen neuen Schülerinnen und Schülern wird geholfen, sich in der Schule einzugewöhnen
- die Schule organisiert Lerngruppen so, dass alle Schülerinnen und Schüler wertgeschätzt werden
Dimension C: Inklusive Praktiken entwickeln
- der Unterricht wird auf die Vielfalt der Schülerinnen und Schüler hin geplant
- der Unterricht stärkt die Teilhabe aller Schülerinnen und Schüler
- der Unterricht entwickelt ein positives Verständnis von Unterschieden
- die Schülerinnen und Schüler sind Subjekte ihres eigenen Lernens
- die Schülerinnen und Schüler lernen miteinander
- Bewertung erfolgt für alle Schülerinnen und Schüler in leistungsförderlicher Form
- die Unterschiedlichkeit der Schülerinnen und Schüler wird als Chance für das Lehren und Lernen genutzt
4.1.3.2 Für die Schule irrelevante Indikatoren des Index
Der Indikator "Die Hausaufgaben tragen zum Lernen aller Schülerinnen und Schüler bei." wurde gestrichen, da es an der Heinrich-Albertz-Schule keine Hausaufgaben in der üblichen Form gibt.
4.1.3.3 Indikatoren des Index mit Entwicklungsbedarf an der Schule
Für Bereiche, in denen an der Heinrich-Albertz-Schule noch Entwicklungsbedarf besteht, stehen folgende Indikatoren:
- Inklusion als Ziel aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als Vorstufe zu Indikator A 2.2 „Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Schülerinnen und Schüler, Eltern und schulische Gremien haben eine gemeinsame Philosophie der Inklusion";
- Integration von Erzieherinnen und Erziehern sowie Sonderpädagoginnen und Sonderpädagogen in das Inklusionskonzept;
- die Indikatoren C 2.2 bis C 2.5 wurden zusammengefasst unter Ressourcenentdeckung und -nutzung;
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und schulische Gremien arbeiten gut zusammen (Hier wurde insbesondere auf den Klärungsbedarf hinsichtlich der Kompetenzbereiche von Schule und Träger abgehoben.);
- Fortbildungsangebote helfen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, auf die Vielfalt der Schülerinnen und Schüler einzugehen.
Bei der anschließenden Kommentierung und Diskussion durch die Kolleginnen, Kollegen, Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter und Eltern wurde festgestellt,
- dass der Schwerpunkt der als umgesetzt geltenden Indikatoren in der Dimension C (Inklusive Praktiken) liegt,
- dass über diese Dimension auch die sichersten Aussagen durch die Mitglieder der Arbeitsgruppe gemacht werden können, da sie täglich mit dieser Dimension ‚hautnah‘ in Kontakt kommen,
- dass Unklarheit darüber besteht, inwieweit Eltern und Kinder eine inklusive Kultur (Dimension A) in der Heinrich-Albertz-Schule erkennen können.
Gegenüber der herkömmlichen Vorgehensweise, nämlich zuerst eine inklusive Kultur (A) zu schaffen und auf deren Grundlage inklusive Strukturen (B) zu etablieren, um diese dann in inklusive Praktiken (C) umzusetzen, bestand an der evangelischen Grundschule anscheinend eine Sondersituation: Inklusive Praktiken (C) waren deutlich auszumachen und inklusive Strukturen (B) erkennbar, jedoch mangelte es an Erkenntnissen über das Vorhandensein bzw. den Grad einer inklusiven Kultur (A).
4.1.4 Konsequenzen und weitere Schritte
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Klausurtagung (auf ein eigenständiges Index-Team musste aufgrund der geringen personellen Ressourcen verzichtet werden) hielten fest, als nächstes
(a) die Elternschaft der Schule über den Index für Inklusion zu informieren und
(b) eine empirische Bestandsaufnahme bei Eltern und Schülerinnen/Schülern durchzuführen, die schwerpunktmäßig Aufschluss über die Verankerung der Dimension A, sprich einer inklusiven Kultur in der Heinrich-Albertz-Schule, geben sollte.
Der Untersuchung sollte folgende Fragestellung zugrunde liegen:
Besteht an der Heinrich-Albertz-Schule innerhalb der Eltern- und Schülerschaft eine inklusive Kultur, die durch gegenseitige Wertschätzung, Anerkennung und Kooperation gekennzeichnet ist?
Von Interesse waren dabei insbesondere folgende sechs Aspekte:
(1) Information über die Heinrich-Albertz-Schule,
(2) Willkommen fühlen,
(3) Wertschätzung durch die Schule,
(4) Wertschätzung untereinander
(5) Kooperation und Hilfe (soziale Kompetenz) und
(6) Heterogenität.
Eine (a) erste Information der Elternschaft über den Begriff ‚Inklusion‘, den ‚Index für Inklusion‘ und die einzelnen Phasen des ‚Index-Prozesses‘ fand am 17. November 2011 statt, (b) die empirische Untersuchung startete am 8. November 2011 für die Kinder und am 17. November 2011 für die Eltern.
4.2 Phase 2: Die Schulsituation beleuchten
4.2.1 Empirische Bestandsaufnahme
Der ‚Index für Inklusion‘ geht davon aus, dass auf dem Weg zu einer inklusiven Schule als erster Schritt an der Entwicklung einer inklusiven Kultur gearbeitet werden sollte, da sich aus einer entsprechenden Haltung heraus inklusive Strukturen und Praktiken entwickeln lassen. Dies findet seine Parallele in der Auffassung, dass „Inklusion im Kopf beginnt“[9]. Die Schulkultur der Heinrich-Albertz-Schule ist bisher allein im Konzept der Schule beschrieben worden und diente der Entwicklung des Schulprofils der neu zu gründenden Schule sowie als Grundlage zur Gestaltung von Strukturen und Unterrichtspraktiken.
Ausgehend von der Hypothese, dass sich die drei Dimensionen des Index gegenseitig bedingen, sollte nun mittels einer empirischen Untersuchung geprüft werden, ob angesichts der aus Sicht der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bereits zu einem großen Teil umgesetzten Dimensionen (Strukturen (B) und Praktiken (C)) bei Eltern und Kindern eine inklusive Kultur (A) bestätigt wird.
4.2.1.1 Methoden
Ziel der empirischen Untersuchung war die Erfassung des „Ist-Zustandes“ in Hinsicht auf Vorhandensein und Ausgeprägtheit der inklusiven Kultur an der Schule. Die Untersuchung sollte mehrperspektivisch sein – die Meinung von Kindern und Eltern der Schule erfassen –, aber auch in dem Sinne „valide“ sein, dass sie nicht lediglich eine spontane Momentaufnahme einer Auswahl von Personen zu einem bestimmten Zeitpunkt, sondern einen über die Zeit stabilen „Ist-Zustand“ abbilden sollte. Zudem sollte die Untersuchung repräsentativ und anonym sein. Die Untersuchung wurde daher als erkundende mehrwellige (Follow-up) schriftliche Befragung mit einem standardisierten Fragebogen in Form einer Vollerhebung konzipiert.
Eine Vollerhebung im Vergleich zu einer Stichprobenerhebung per systematischer Zufallsauswahl bot sich an, da die Aussagen repräsentativ sein sollten und die Schule noch nicht so groß ist, dass eine Vollerhebung organisatorisch und kostenmäßig zu aufwändig gewesen wäre – Gründe, die normalerweise gegen eine Vollerhebung sprechen (Bortz und Döring 2006, S. 394–396); die Grundgesamtheiten waren jeweils „endlich“, „bekannt“, greifbar (insbesondere die Kinder in ihren Lerngruppen) und andererseits zu klein und heterogen, so dass hier im Gegenteil eine Stichprobenuntersuchung zu aufwändig gewesen wäre (vgl. Bortz und Döring 2006, S. 395).
Eine Längsschnittstudie (Follow-up) kann als Panel- oder Trenduntersuchung gestaltet werden (vgl. z.B. Schnell et al. 2011). Bei einer Panelbefragung werden dieselben Personen mit demselben Instrumentarium zu mehreren Zeitpunkten untersucht und es interessieren u.a. intraindividuelle Veränderungen (vgl. Schnell et al. 2011, S. 230f; Schnell 2012, S. 74f.). Beim Trenddesign (auch „replikativer Survey“, vgl. Schnell et al. 2011, S. 238f; Schnell 2012, S. 73f) werden ebenfalls zu mehreren Zeitpunkten mit demselben Instrumentarium Untersuchungen durchgeführt, jedoch an anderen Personen. Insofern können intraindividuelle Veränderungen nicht geprüft werden; von Interesse sind allgemeine Veränderungen über die Zeit (vgl. Schnell et al. 2011, S. 239; Schnell 2012, S. 73f).
Angesichts der Tatsache, dass sich die Schule noch im Aufbau befindet und sich jedes Schuljahr die Grundgesamtheit ändert – neue Schülerinnen/Schüler sowie Eltern/Erziehungsberechtigte kommen hinzu, mit dem Ende der Grundschulzeit nach dem vierten Lernjahr verlassen Schüler/Schülerinnen sowie Eltern/Erziehungsberechtigte die Schule –, zudem nicht intraindividuelle Veränderungen, sondern die Stabilität eines Gesamtbildes über die Zeit im Vordergrund stand, wurde die Untersuchung als „Trendanalyse“ durchgeführt. Da nicht alle Personen zu den einzelnen Zeitpunkten andere sind, hätte eine Kombination von Panel- und Trenddesign (Schnell 2012, S. 77f, 2012) den Königsweg dargestellt. Allerdings wäre es angesichts der kleinen Grundgesamtheiten schwierig gewesen, Anonymität glaubhaft zu garantieren.
Population. Tabelle 1 gibt einen Überblick über die Schülerzahlen an der Heinrich-Albertz-Schule in den beiden für die Erhebung relevanten Schuljahren 2011/12 (Welle 1) und 2012/13 (Wellen 2 und 3). Die Schule befindet sich noch im Aufbau, noch sind nicht alle der geplanten fünf Lerngruppen eingerichtet. Daher nehmen mit jedem Schuljahr auch die Schülerzahlen zu. Im Schuljahr 2011/12 befanden sich 63 Kinder an der Schule, 22 Mädchen (35%) und 41 Jungen (65%), im Schuljahr 2012/13 stieg die Schülerzahl auf 74 an mit 28 Mädchen (38%) und 46 Jungen (62%).
Tabelle 1: Schülerinnen und Schüler an der Heinrich-Albertz-Schule in den Schuljahren 2011/12 und 2012/13
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Die Verteilung der Schüler und Schülerinnen über die Lernjahre differiert entsprechend der Tatsache, dass die Schule sich noch im Aufbau befindet, ebenfalls in den beiden Jahren (s. Tabelle 1). In beiden Jahren befinden sich knapp ein Drittel der Schüler in Lernjahr 1, in Schuljahr 2011/12 ist Lernjahr 2 mit 38% am stärksten besetzt, während in Schuljahr 2012/13 ebenfalls ein knappes Drittel in Lernjahr 3 zu finden ist. Die wenigsten Schüler befinden sich mit jeweils 14% in Schuljahr 2011/12 in Lernjahr 3 und in Schuljahr 2012/13 in Lernjahr 4.
Die Zahlen zu den Eltern/Erziehungsberechtigten der Kinder erfasst die Schule nicht in dieser Art; hierzu können lediglich Schätzungen über die Anzahl der Kinder vorgenommen werden. Wir veranschlagen vor diesem Hintergrund für das Schuljahr 2011/12 eine Zahl von N=110 Eltern/Erziehungsberechtigten (63 Kinder minus 8 Geschwisterkinder = 55 Kinder mal 2 Elternteile = 110; 55 Frauen/55Männer) und für das Schuljahr 2012/13 eine Zahl von N=124 Eltern/Erziehungsberechtigten (74 Kinder minus 12 Geschwisterkinder = 62 Kinder mal 2 Elternteile = 124; 62 Frauen/62 Männer). Zur Population der „Eltern/Erziehungsberechtigten“ ist hier anzumerken, dass mit den Begriffen Eltern/Erziehungsberechtigte nicht der „rechtliche“ Status gemeint ist. Es gibt „intakte“ Familien an der Schule, aber auch alleinerziehende Mütter und Väter. Die Alleinerziehenden haben oftmals neue Partner, die sich ebenfalls in die Schule einbringen, so dass ein Kind sogar drei oder vier „Eltern/Erziehungsberechtigte“ haben kann – an der inklusiven Kultur der Schule beteiligt sind auch diese Personen – andere Kinder aber auch nur eine Person. Dies wird sich u.E. übers ganze ausgleichen; als das realistischste Vorgehen erschien es daher, bei der Schätzung der „Eltern“[10] pro Kind von zwei Elternteilen auszugehen.
Befragung. Die Befragung der Kinder erfolgte im Lerngruppenverband in Anwesenheit des Verfassers dieser Arbeit. Nach einer kurzen Erläuterung des Ziels der Untersuchung wurden der Fragebogen vorgestellt und das Vorgehen bei der Beantwortung der Fragen erklärt. Jede Frage wurde dann vom Untersucher einzeln vorgelesen und sollte direkt im Anschluss beantwortet werden. So konnten auch Kinder, die noch nicht so gut bzw. noch nicht lesen konnten, an der Untersuchung beteiligt werden. Bei Verständnisschwierigkeiten konnten die Kinder nachfragen. Wenn die Kinder keine Antwort wussten, sollten sie bei der entsprechenden Frage kein Kreuz machen.
Die Befragung der Eltern erfolgte bei Welle 1 und Welle 2 jeweils im Anschluss an einen Informations-Elternabend (Beginn: 19.00 Uhr) für alle Eltern der Schule. Am Ende der Veranstaltung (jeweils ca. 20.00 Uhr) wurde das Ziel der Untersuchung vorgestellt und der Fraugebogen erläutert. Alle Anwesenden erhielten anschließend einen Fragebogen, füllten ihn in der Schule aus und legten ihn in einen dafür aufgestellten Karton. Bei Welle 3 wurde der Fragebogen zu zwei Zeitpunkten verteilt: (1) im Zusammenhang mit der Zeugnisausgabe an einem Mittwochnachmittag (13.00 Uhr), (2) im Zusammenhang mit dem ‚Musischen Treffpunkt‘ (Freitag, 17.00 Uhr), bei dem fast alle Kinder der Schule mindestens einen Auftritt hatten und so vermutet werden konnte, dass von allen Kindern Eltern/Erziehungsberechtigte anwesend waren. Auch hier erhielten alle Anwesenden vor/nach der Zeugnisausgabe bzw. vor/nach der Veranstaltung den Fragebogen, füllten ihn aus und legten ihn in einen dafür aufgestellten Karton. Um Doppelabgaben zu vermeiden wurde bei beiden Veranstaltungen auf einem Bogen zusätzlich namentlich erfasst, wer einen Fragebogen ausgefüllt und abgegeben hatte.
[...]
[1] Im Originaltext heißt es bspw. „states parties shall ensure an inclusive education system at all levels”, die gemeinsame amtliche Übersetzung Deutschlands, der Schweiz, Österreichs und Liechtensteins lautet: „gewährleisten die Vertragsstaaten ein integratives Bildungssystem auf allen Ebenen“.
[2] Der Begriff ‚Schattenübersetzung‘ wurde gewählt, weil die sog. ‚Schattenberichte‘ (shadow reports) im Berichtswesen zu bestehenden UN-Konventionen eine gute Tradition haben: Die Vertragsstaaten von UN-Konventionen sind verpflichtet, regelmäßig Berichte zur Umsetzung der jeweiligen Konvention zu erstellen und diese dem überwachenden Komitee zuzuleiten. Parallel dazu werden von den Nichtregierungsorganisationen Schattenberichte erstellt, die ebenfalls in die Bewertung des überwachenden Komitees einfließen (Beauftragter der Bundesregierung für die Belange behinderter Menschen 2010, S. 4).
[3] Behinderte Kinder galten als nicht bildungsfähig.
[4] „Zu nennen ist hier der Taubstummenlehrer Heinrich Ernst Stötzner (1832-1910) […]. Er verfasste eine Schrift mit dem Titel ‚Schulen für schwachbefähigte Kinder‘. Sie gilt heute noch als der programmatische Entwurf für die Entstehung der Hilfsschule, oder Schule für Lernbehinderte, wie sie in den 1970er Jahren in Deutschland genannt wurde, bzw. der Allgemeinen Sonderschule (ASO) in Österreich“ (Biewer 2009, S. 18).
[5] Die weiteren drei Aspekte sind: „Leitung und Mitbestimmung, Strukturen und Praktiken, Unterstützung durch Bildungspolitik und -verwaltung“ (Werning 2012, S. 51) vgl. a. Dyson 2010.
[6] Stärke-Schwäche-Analyse – Zielformulierung – Umsetzungsplanung – Evaluation (vgl. Bartnitzky et al., S. 60/61)
[7] SEIS = Selbstevaluation in Schule; SEIS Deutschland Geschäftsstelle beim Niedersächsisches Landesinstitut für schulische Qualitätsentwicklung (NLQ), Keßlerstraße 52, D-31134 Hildesheim.
[8] Als Herzstück von "Every Child Matters" stellte die Regierung 2005 das Konzept der "Extended Schools" vor. Diese Schulen sollen die Ziele der Regierungsinitiative verwirklichen helfen, indem sie verschiedene Angebote der Kommune unter einem Dach bündeln. Extended Schools arbeiten mit den lokalen Behörden, mit lokalen Organisationen und anderen Schulen zusammen, um gemeinsame Angebote für die Schülerinnen und Schüler zu organisieren. Im Vordergrund stehen Förderangebote, sportliche und musikalische Angebote sowie Unterstützungsangebote für Eltern und Familien. Die Erwachsenen sollen in den Extended Schools schnellen und unbürokratischen Zugang zu auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Serviceleistungen und Beratungen erhalten, wozu auch das gemeinsame Lernen von Kindern und Erwachsenen gehört. Zurzeit arbeiten in Großbritannien 7.000 Schulen - mehr als ein Viertel - als "Extended Schools" (Augsburg 2007).
[9] Diese Formulierung geht zurück auf ein Zitat von Georg Feuser aus dem Jahre 1982 und lautet ursprünglich „Integration beginnt im Kopf“. Als geflügeltes Wort wurde es im Zuge der Diskussion um Inklusion umgewandelt in „Inklusion beginnt im Kopf“ (Schache 2012).
[10] Mit dem Begriff „Eltern“ sind hier immer auch die „Erziehungsberechtigten“ gemeint.
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Erstausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2013
- ISBN (Paperback)
- 9783958202108
- ISBN (PDF)
- 9783958207103
- Dateigröße
- 4.5 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Universität Hildesheim (Stiftung)
- Erscheinungsdatum
- 2015 (Februar)
- Note
- 1
- Schlagworte
- Organisationsentwicklung Schulprogramm Leitbild Ethos Empirische Studie
- Produktsicherheit
- BACHELOR + MASTER Publishing