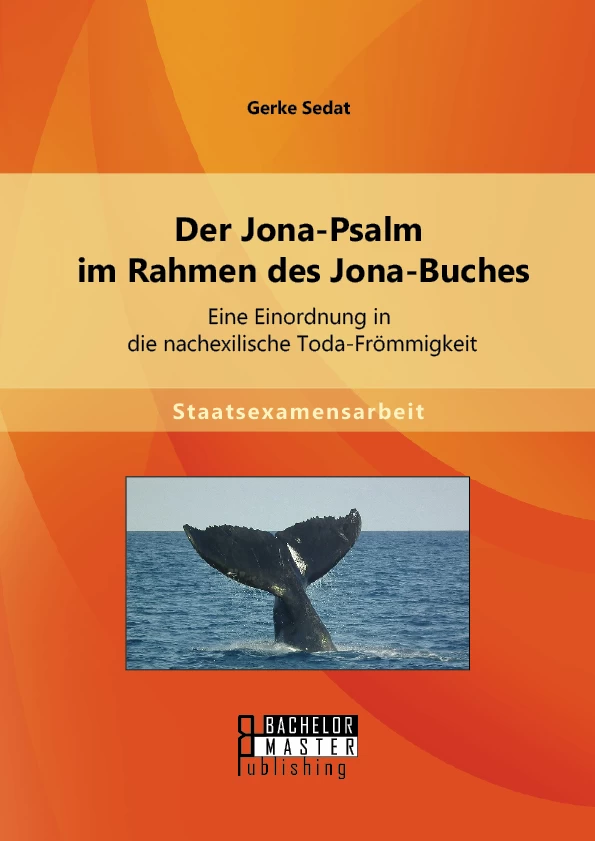Der Jona-Psalm im Rahmen des Jona-Buches: Eine Einordnung in die nachexilische Toda-Frömmigkeit
©2005
Examensarbeit
64 Seiten
Zusammenfassung
In der großen Mehrheit der gängigen Bibellexika, der Enzyklopädien und der einführenden Literatur, aber auch in Kommentaren und Dissertationen wird der Prophet Jona als ein engstirniger und eitler Hebräer dargestellt, der, Gott gegenüber ungehorsam, vor seinem Auftrag flieht, und als er wieder eingefangen, seinen Dienst mit innerlichen Vorbehalten und unzulänglich versieht. Weiter wird in den näher untersuchten Werken herausgestellt, dass das Jonabuch einen solchen Typus eines Hebräers, der nicht bereit ist Gottes Gnade auch für die Heiden zu akzeptieren und wie es ihn in nachexilischer Zeit gegeben haben soll, karikiert und ihn in seinem Gebet, dem Jonapsalm, ironisiert. Die Verhaltensweisen Jonas seien das didaktische Mittel des Autors, seinen zeitgenössischen Lesern einen Spiegel vorzuhalten. Außerdem wird die Einheitlichkeit des Jonabuches mehrheitlich bestritten und insbesondere der Jonapsalm wird als sekundär, als zum ursprünglichen Bestand nicht zugehörig angesehen. Die Auswahl der angeführten Problemfelder ist nicht vollständig, aber dennoch sinnvoll, da sie zur Auslegung des Psalms und des Buches im zweiten Teil dieser Arbeit hinführen und nicht voneinander isolierte Einzelprobleme darstellen sollen. Im ersten Teil der vorliegenden Arbeit sollen nun diese und noch einige andere exegetische Urteile über das Jonabuch dargestellt und auf ihre Tragfähigkeit hin untersucht werden. Anschließend soll im zweiten Teil mit Hilfe einer kritischen Auseinandersetzung mit den mehrheitlich vertretenen Positionen eine Auslegung entstehen, die den Jonapsalm vor dem Hintergrund des gesamten Textes aufschlüsselt und das nachexilische Sühneverständnis und die Todafrömmigkeit berücksichtigen.
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1
I. Kapitel
Die gegenwärtigen Nachschlagewerke
In der großen Mehrheit der gängigen Bibellexika, der Enzyklopädien und
der einführenden Literatur, aber auch in Kommentaren und Dissertationen
wird der Prophet Jona als ein engstirniger und eitler Hebräer dargestellt,
der, Gott gegenüber ungehorsam, vor seinem Auftrag flieht, und als er wie-
der eingefangen, seinen Dienst mit innerlichen Vorbehalten und unzuläng-
lich versieht. Weiter wird in den näher untersuchten Werken herausgestellt,
dass das Jonabuch einen solchen Typus eines Hebräers, der nicht bereit ist
Gottes Gnade auch für die Heiden zu akzeptieren und wie es ihn in nachexi-
lischer Zeit gegeben haben soll, karikiert und ihn in seinem Gebet, dem Jo-
napsalm, ironisiert. Die Verhaltensweisen Jonas seien das didaktische Mittel
des Autors, seinen zeitgenössischen Lesern einen Spiegel vorzuhalten. Au-
ßerdem wird die Einheitlichkeit des Jonabuches mehrheitlich bestritten und
insbesondere der Jonapsalm wird als sekundär, als zum ursprünglichen Be-
stand nicht zugehörig angesehen.
Die Auswahl der angeführten Problemfelder ist nicht vollständig, aber
dennoch sinnvoll, da sie zur Auslegung des Psalms und des Buches im zwei-
ten Teil dieser Arbeit hinführen und nicht voneinander isolierte Einzelprob-
leme darstellen sollen. Die Gründe für die Auswahl der Literatur, die zur
Darstellung der Probleme herangezogen wurde, liegen zum einen in ihrer
leichten Zugänglichkeit und zum anderen in ihrem häufigen Gebrauch. So
gut wie jede größere Bibliothek besitzt mindestens eines der ausgewählten
Werke und die meisten Religionslehrer und Theologiestudenten werden des-
halb für die Ausarbeitung eines biblischen Themas mutmaßlich auf diese
zurückgreifen.
Im folgenden ersten Teil der vorliegenden Arbeit sollen nun diese und noch
einige andere exegetische Urteile über das Jonabuch dargestellt und auf ihre
Tragfähigkeit hin untersucht werden. Anschließend soll im zweiten Teil mit
Hilfe einer kritischen Auseinandersetzung mit den mehrheitlich vertretenen
2
Positionen eine Auslegung entstehen, die den Jonapsalm vor dem Hinter-
grund des gesamten Textes aufschlüsselt und das nachexilische Sühnever-
ständnis und die Todafrömmigkeit berücksichtigen.
Die im Text angegebenen und zitierten Bibelstellen sind ausnahmslos der
revidierten Lutherübersetzung 1984 in neuer Rechtschreibung entnommen.
§ 1 Vergleich der Artikel Jona in: Das Grosse Bibellexikon, Calwer Bibel-
lexikon, Neues Bibellexikon, Religion in Geschichte und Gegenwart und
Theologische Realenzyklopädie
1.1. Ironie im Jonabuch
Das Thema der Ironie im Jonabuch wird von allen Autoren der angegebe-
nen Artikel angesprochen, aber mit unterschiedlicher Gewichtung in ihrer
Argumentation berücksichtigt. Wolfgang Grimm
1
gliedert das Jonabuch in
seinen beiden Artikeln grob in drei Teile, die er ,,Verweigerung", ,,Gehorsam"
und ,,Nachhilfe" nennt. Grimm folgt im Großen Bibellexikon der Auffassung,
dass Jona, exemplarisch für weite Teile der damaligen Hebräer, sich trotzig
weigert, die ,,Gedanken Gottes zu denken" und der unbekannte Erzähler sei-
ne Leser mit ,,liebevoller Ironie für Gottes umfassende Güte"
2
gewinnen will.
Begründet wird diese Auslegung hauptsächlich mit drei Reaktionen Jonas.
Nachdem JHWH Jona zurückgeholt hat und seinen Auftrag für ihn wieder-
holt, fügt sich Jona, aber ,,ohne inneres Einverständnis"
3
. Auch das im Bi-
beltext ausgesprochene israelitische Glaubensbekenntnis (Jon 4,2)
4
spricht
Jona, ohne es innerlich zu akzeptieren. Als Drittes interpretiert Grimm die
Reaktionen Jonas auf die Zerstörung der Staude (Jon 4,8f) als wütend und
selbstmitleidig, die in Vers 10 die didaktische Antwort JHWHs provozieren.
1
Grimm, Wolfgang: Jona, in: Grosses Bibellexikon II, Wuppertal 2.Aufl.1995, S. 713f und Jona, in Calwer
Bibellexikon I, Stuttgart 2003, S. 682f.
2
Grimm in: Großes Bibellexikon, S. 714.
3
Grimm in: Großes Bibellexikon, S. 713.
4
Vergl. auch mit Ex 34,6.
3
Der Artikel im Calwer Bibellexikon folgt im Wesentlichen dem gleichen
Aufbau. Zusätzlich schließt Grimm den Jonapsalm für seine Begründung
der ironischen Züge des Buches mit ein, wenn er fragt, ob der Psalm nicht
,,einen auch in seinen frommen Gebetsworten egozentrischen und selbstge-
rechten Propheten"
5
darstellt. Auch hier spricht Grimm vom literarischen
Stilmittel der ,,entlarvenden Satire", mit der der Autor die ,,Hartherzigen sei-
ner Landsleute"
6
wachrütteln möchte. Das Thema der Einheitlichkeit des
Buches wird in beiden Artikeln ausgespart, lediglich im Calwer Bibellexikon
wird darauf hingewiesen, dass dies in der Forschung kontrovers diskutiert
wird.
1.2. Ironie und Einheitlichkeit des Jonabuches
H.W. Jüngling diskutiert in seinem ausführlichen Artikel im Neuen Bibel-
lexikon
7
die Themen Ironie und Einheitlichkeit mit zwei gegensätzlichen Po-
sitionen der gegenwärtigen Forschung. Die erste Variante setzt voraus, dass
es von Jona absurd wäre, im Bauch eines großen Fisches einen Todapsalm
zu beten und dass deswegen der Psalm ein vom Autor absichtlich eingefüg-
tes, ironisches Mittel sei. Überhaupt erkennt Jüngling ,,Züge des Ironischen
und Komischen"
8
im gesamten Jonabuch, besonders deutlich in den Be-
kenntnissätzen der Verse 1,9 und 4,2b. Als ein ,,larmoyantes Lamento"
9
cha-
rakterisiert er die Aussagen Jonas in 1,12 und 4,3.
Die zweite Position geht von der Annahme aus, dass der Jonapsalm von
einem frommen Beter gesungen werde
10
, dies sei bezogen auf die Gesamt-
konzeption des Buches und vor allem auf den renitenten Charakter Jonas
,,nicht angemessen"
11
. Jona könne diesen Psalm nicht ernsthaft beten bzw.
nicht ernsthaft beten wollen und daher bliebe nur der Schluss, dass der Jo-
5
Grimm, in: Calwer S. 682.
6
Grimm, in: Calwer S. 683.
7
Jüngling, H.W: Jona (Buch), in: Neues Bibellexikon II, Düsseldorf 1995, Sp. 373-377.
8
Jüngling, Sp. 376.
9
Jüngling, Sp. 377.
10
Im zweiten Teil dieser Arbeit wird auf diesen wichtigen Umstand noch genauer eingegangen.
11
Jüngling, S. 375.
4
napsalm eine sekundäre Einfügung sei. Außerdem, so Jüngling, unterbräche
der Psalm ,,[...] die chiastische Folge der Subjekte in den VV 2,1-2a und
2,11: Jahwe/J. J./Jahwe"
12
. Schon aufgrund dieses literarkritischen Be-
fundes ist Jüngling der Auffassung, dass der Psalm nicht ursprünglich sein
könne. Eine literarische Klassifizierung des Buches hält der Artikel für sehr
problematisch, aber aufgrund des häufig und an entscheidenden Stellen
vorkommenden Verbums ,,erkennen" (1,7.10.12; 3,9; 4,2.11) ist die Bezeich-
nung ,,weisheitlich orientierte Lehrerzählung nicht ganz verfehlt."
13
1.3. Ironie, Einheitlichkeit und Gattung des Jonabuches
Friedemann W. Golka
14
bezieht in seinem Text eine klare Position für die
Einheitlichkeit des Jonabuches. Er begründet seine Auffassung mit dem iro-
nischen Charakter des Jonapsalms, der zeige, dass dieser völlig im Einklang
mit Jonas übrigen Verhaltensweisen in der Geschichte steht. Dem verweiger-
ten Botengang folgt ein Lippenbekenntnis (1,9), im Bauch des Fisches ein
übertrieben frommes Gebet und anschließend eine kurze und darum lieder-
liche Auftragsausführung (3,4). Da der Psalm nur ironisch verstanden in-
nerhalb der Gesamtkonzeption einen Sinn ergebe, so Golka, werde der Blick
auch nicht länger auf die inhaltlichen Bezüge des Psalms zum Buch ver-
sperrt
15
. Besonders betont Golka den fortlaufende Abstieg Jonas von seinem
Ausgangspunkt
16
an bis zum Bauch des Schiffes und dann ,,hinunter zu der
Berge Gründen" (2,7a), dem tiefsten Punkt auf Jonas Weg. Vers 2,7a zeige
also, dass der Psalm von Anfang an in die Konzeption des Buches gehörte.
Die literarische Gattung bezeichnet Golka als eine didaktische Lehrerzäh-
lung, die Ironie und Satire nutze, um ihr Anliegen deutlich zu machen. Bei
aller Vielschichtigkeit und Komplexität theologischer Themen habe das Buch
12
Jüngling, S. 375f.
13
Jüngling, S. 376.
14
Golka, F.W.: Jona, in: Religion in Geschichte und Gegenwart Band IV, Tübingen 2001, S. 567-569.
15
Golka, Sp. 567.
16
Golka, Sp. 567 und auch Abschnitt 3.1.1. dieser Arbeit.
5
,,Gottes Vorrecht der Reue"
17
als zentrales Thema. Ein äußerst wichtiger,
aber nicht näher ausgeführter Einzelaspekt in diesem Artikel ist die Be-
zeichnung des großen Fisches als ein ,,gehorsames Transportmittel"
18
. In Ab-
schnitt 5.1.2. dieser Arbeit wird auf dieses Problem noch ausführlicher ein-
gegangen.
Der Artikel von Hans-Jürgen Zobel in der Theologischen Realenzyklopä-
die
19
geht deutlich auf Distanz zu den Aussagen anderer Exegeten, dass im
Jonabuch Satire und Ironie als den Inhalt prägende Stilmittel eingesetzt
würden oder diese sogar zum Hauptthema hätten. Die starke Gewichtung
der literarischen Eigenarten des Buches, z.B. dass die ,,Charaktere fein ge-
zeichnet werden" und dass ,,die Erzählung in mehrere Szenen mit je eigenen
nuancierten Aussagen gegliedert ist und sie dennoch auf den Schluss hin
ausgerichtet sind"
20
, führe zur Unterbewertung der didaktischen Absicht
und damit zur Einordnung des Buches als Satire oder Parodie. Vers 4,11
mache dagegen mit JHWHs offener Fragestellung deutlich, dass es sich nicht
um eine satirische Absicht handeln könne.
Bezüglich der Einheitlichkeit des Jonabuches wird in dem Artikel Zobels
die Möglichkeit diskutiert, die Einheit des gesamten Buches anzunehmen,
wenn auch einschränkend angemerkt wird, dass seine Entstehung auch das
Ergebnis eines Wachstumsprozesses sein könne
21
. Das Jonabuch ohne den
Psalm hält Zobel aufgrund der Stileigentümlichkeiten innerhalb des Erzähl-
teils für einheitlich. Der Inhalt und vor allem der Sprachstil des Jonapsalms,
der sich deutlich vom Rest des Buches abhebt, zeige aber, so Zobel, dass der
Psalm innerhalb eines literarischen Wachstumsprozesses eingefügt worden
sei
22
. Dennoch wird zu bedenken gegeben, dass der Psalm ein Kompilat sei
und auch vom Autor schon wie in der vorliegenden Fassung verwendet wor-
den sein könne. Eine isolierte Existenz des Psalms habe es demnach wahr-
scheinlich nicht gegeben.
17
Golka, Sp. 568.
18
Golka, Sp. 568.
19
Zobel, H.-J.: Jona, in: Theologische Realenzyklopädie XVII, Berlin/New York 1988, S. 229-234.
20
Zobel, S. 232.
21
Zobel, S. 231.
22
Zobel, S. 230.
6
Die Gattungsbestimmung bleibt nach ausführlicher Abwägung (Midrasch,
Novelle, Weisheit, Lehrerzählung) in diesem Artikel unentschieden, da die
Komplexität und Vielfalt der Themen eine eindeutige Bestimmung nicht zu-
ließen. Zobel erkennt zumindest ironische und humorvolle Elemente, hält
aber die lehrhafte Absicht für gewichtig und will aus diesem Grund die Ein-
ordnung des Buches als Midrasch gelten lassen, bezeichnet das Jonabuch
aber schließlich, wie der von ihm zitierte niederländische Alttestamentler van
der Woude, als ein literarisches Unikat
23
.
§ 2 Kritische Analyse der Artikel
2.1. Zur Ironie im Tempel
Alle Argumente der oben vorgestellten Autoren erscheinen wohl überlegt
und ausgewogen. Bei aller Unterschiedlichkeit im Detail und in den Einzel-
problemen stellt sich jedoch die Frage, ob die Argumentationen in sich
schlüssig sind. Die wiederholt formulierte These, der Jonapsalm sei sekun-
där, bedarf meines Erachtens der genaueren Überprüfung. Wird nicht die
Erklärung des Jonapsalms als sekundär, erst mit der negativen Beurteilung
Jonas ermöglicht?
24
Andernorts wird die Einheit des Jonabuches mit dem
ironischen Charakter des Psalms, dessen Beurteilung auch aus den negati-
ven Charaktereigenschaften Jonas abgeleitet wird, begründet
25
. Beide exege-
tischen Positionen gehen von der nicht ausreichend begründeten Annahme
aus, der sehr zweifelhafte Charakter Jonas sei eine selbstverständliche, eine
ausgemachte Sache. Dass dem nicht so sein muss, wird von Grimm am
Schluss seines Artikels erwähnt, ohne dass auf die Tragweite dieses Hinwei-
ses eingegangen wird. Grimm schreibt, dass das Jonabuch im Judentum
,,als Beispiel für "ideal repentance and its effect, and God's forgiving mercy"
23
Zobel, S. 232.
24
u.a. Jüngling, Sp. 375.
25
u.a. Golka, Sp. 567.
7
(Encyclopedia Judaica, vol.5, 1971, 1379)"
26
angesehen werde. Zwar ist mit
dieser Position zunächst noch nichts gewonnen außer einer weiteren For-
schungsmeinung, aber es lässt sich damit möglicherweise eine Argumentati-
on entwickeln, die stichhaltig ist, ohne Jonas Charakter zu diskreditieren.
Die Auslegung im Judentum zeigt, dass im Jonabuch die Themen Gnade
(=mercy) und Reue (=repentance
27
) behandelt werden. Während von der
Gnade Gottes in den vorgestellten Artikeln ebenfalls die Rede war, wurde
Reue als Thema des Buches nicht erwähnt. Wenn aber die Reue auch Jonas
Handeln bestimmt, ist für Ironie weder in der Jonaerzählung noch im Psalm
ein sinnvoller Ort auszumachen
28
. Stellt also der Jonapsalm den Propheten
als einen frommen Beter dar?
Weiter erwähnt Grimm, dass nach bMeg 31a ,,das Jonabuch beim Nach-
mittagsgebet des Versöhnungstages als Schlussabschnitt zu lesen"
29
sei.
Wieder erscheint es doch zumindest fraglich, ob für Ironie und den wenig
frommen Charakter, als der Jona dargestellt wird, die Synagoge der geeigne-
te Ort ist, noch dazu am Versöhnungstag, der im Judentum als bedeutends-
ter Feiertag und als der wichtigste der zehn Bußtage gilt
30
. So sind meines
Erachtens grundsätzliche Zweifel daran angebracht, ob in der Synagoge in
Gegenwart des Allerheiligsten das Vortragen parodistischer Geschichten und
ironischer Gebete ernsthaft angenommen werden kann.
2.2. Zur Einheitlichkeit des Jonabuches
Mit den Zweifeln, ob das Jonabuch ironisch gemeint sei, kommt folgerich-
tig auch eine neue Perspektive zur Frage nach der Einheitlichkeit des Jo-
nabuches auf. Legt man die oben skizzierte jüdische Perspektive zu Grunde,
ergibt das Jonabuch ohne den Psalm keinen Sinn mehr, denn dann fehlt ge-
rade Jonas Reue und seine Hinwendung zu JHWH in Zeiten, in denen die
26
Grimm, in: Calwer, S. 683.
27
Vergl. Langenscheidts Großwörterbuch Englisch, 5. Auflage, München 2004.
28
Vergl. dazu auch § 5.
29
Grimm, in: Calwer, S. 683.
30
Vergl. Nägele, S.: Versöhnungstag, in: Calwer Bibellexikon II, Stuttgart 2003, S. 1415.
8
Frage nach der umfassenden Gnade Gottes angesichts der assyrischen Be-
drohung
31
Israels besonders schwer zu fassen wäre.
Die Sprache des Jonapsalms, so argumentiert Zobel, ist eine andere als die
des Buches, deshalb sei es wahrscheinlich, dass der Psalm von einem späte-
ren Redaktor
32
stammt. Andererseits wäre es doch einen Versuch wert, den
veränderten Sprachstil in 2,3 2,10 auf den Psalm selbst zurückzuführen.
Abgesehen davon, dass ein Gebetslied schon von sich aus einen anderen Stil
haben sollte als eine Erzählung und unabhängig davon, ob es nun ur-
sprünglich oder sekundär in einem Text verhaftet ist, muss doch gerade der
Jonapsalm, der sich, wie noch zu zeigen ist, aus verschiedenen Zitaten und
Anspielungen aus dem Psalter zusammensetzt, erst recht einen eigentümli-
chen Stil aufweisen. Ließe sich diese Hypothese am Text erhärten, wäre
nicht nur ein Argument gegen die Einheitlichkeit des Buches entkräftet,
auch die diagnostizierte Ironie des Psalms geriete ins Wanken, denn die ist ja
Hauptargument Golkas (s. Abschnitt 1.3) für die Einheitlichkeit des Buches
und diese ließe sich dann aus dem Psalm selbst belegen.
2.3. Zur Gattung des Jonabuches
In der Diskussion von Zobel um die Gattungsbestimmung wird deutlich,
dass eine eindeutige Zuordnung alles andere als leicht ist. Während Golka
von einer didaktischen Lehrerzählung spricht, in der die Elemente Satire
und Ironie eingebaut seien, um das Anliegen des Autors zu verdeutlichen,
bevorzugt Zobel die Zuordnung des Jonabuches zum Midrasch. Begründet
wird dies mit der eindeutig didaktischen Absicht (s. Abschnitt 1.3) des Er-
zählers, die es aber nahezu unmöglich machen soll, das Buch als Parodie
einzustufen. Gerade diese Einordnung zum Midrasch, der erklärenden Aus-
legung eines Textes der Heiligen Schrift, macht es meines Erachtens schwer
vorstellbar, dass Elemente wie Ironie und Satire verwendet worden sein sol-
31
Vergl. dazu auch Abschnitt 3.1.4.
32
So auch Wolff, H.W.: Biblischer Kommentar AT XIV3, 3. Aufl. 2004, S. 56f.
9
len. Nicht nur, dass dann das Jonabuch während des Gottesdienstes dem
Gelächter preisgegeben würde, nun käme auch noch die auszulegende
Schriftstelle hinzu, die jetzt ebenfalls an Ernsthaftigkeit einbüßen würde.
Auch der noch näher zu untersuchende Jonapsalm, der sich, wie schon an-
gedeutet, aus mehreren Teilen des Psalters zusammensetzt, zöge mit seinem
ironischen Charakter den gesamten Psalter in den Bereich des Komischen.
Dass Ironie und Midrasch nicht zweifelsfrei zusammenpassen, hat auch
Zobel so gesehen, obwohl er einige ironische Elemente in der Geschichte er-
kennt. Dagegen ist nicht eindeutig erklärt, welche Schriftstelle mit dem Jo-
nabuch ausgelegt werden soll, aber genau das wäre für die Einordnung des
Jonabuches als Midrasch ein entscheidendes Argument. Jona ben Amittai
erscheint in der Heiligen Schrift nur an zwei Stellen und so käme für den
auszulegenden Teil nur 2Kön14, 25
33
in Frage. Der Informationsgehalt die-
ses Verses rechtfertigt es allerdings kaum, das ganze Jonabuch
34
als seine
erklärende Auslegung einzustufen.
Wenn auch die lehrhafte, didaktische Absicht des Buches nahe liegt, so
bleibt die Gattungsbestimmung weiterhin nicht eindeutig geklärt und bedarf
der weiteren Untersuchung.
2.4. Jonas Ungehorsam und sein Widerwillen
Mit Ausnahme Jünglings
35
gehen alle Exegeten davon aus, dass mit dem
Jona des Jonabuches der Prophet Jona des 8. Jahrhunderts v. Chr. unter
König Jerobeam II. gemeint ist, auch wenn das Jonabuch selbst viel jünger
ist. Um wie viel jünger, ist allerdings umstritten. Da die Auffassung Jüng-
lings, dass Jona ben Amittai aus 2Kön14, 25 nicht mit Jona ben Amittai aus
dem Jonabuch ,,zu identifizieren"
36
sei, nicht näher begründet wird und of-
33
In diesem Sinn: Opgen-Rhein, H.J.: Jonapsalm und Jonabuch, Stuttgart 1997, S. 141.
34
Eher wäre zu fragen, ob nicht dieser Vers zum Verständnis des Buches beiträgt, s. Abschnitt 3.1.2. und 3.1.3.
35
Wenige sind sogar der Auffassung, dass es sich um einen Tatsachenbericht handelt, vergl. mit G. Maier: Der
Prophet Jona, 1976 (in: Grimm, Das Große Bibellexikon, S. 714).
36
Jüngling, H.W.: Jona (I), in: Neues Bibellexikon I, Stuttgart 1995, Sp. 373.
10
fensichtlich eine Einzelmeinung innerhalb der Forschung darstellt, soll sie
hier außer Acht gelassen werden.
Geht man davon aus, dass die beiden Jonas der genannten Bibelstellen
identisch sind, und dass der Verfasser des Jonabuches den historischen Jo-
na als Hauptfigur absichtlich ausgesucht hat, dann sollten die Gründe dafür
untersucht werden. Der Prophet Jona hat sich nach dem Zeugnis des zwei-
ten Buches der Könige kein Verhalten zuschulden kommen lassen, dass
man mit Ungehorsam, Hochmut oder Widerwillen beschreiben könnte. Das
Gegenteil ist der Fall, hat er sich doch als wahrer Prophet erwiesen, als er
Jerobeam II. militärische Erfolge im Norden des Landes angekündigt hatte.
Von hier aus scheint sich keine schlüssige Begründung für die negative Be-
urteilung für Jonas Charakter zu finden.
Es ist aber unrealistisch anzunehmen, dass die Wahl der Titelfigur zufällig
gewesen ist. So bleibt noch die Zeit des Propheten Jona, die historischen
Umstände unter denen der Prophet im 8. Jahrhundert wirkt, als Möglichkeit
für eine Begründung seines Verhaltens im späteren Jonabuch. Der Prophet
Jona wirkte unter dem König des Nordreiches Jerobeam II., der von 787-747
v. Chr. (2Kön14,23-29) regierte und Israels letzte Blüte erlebte. Schon gegen
Ende seiner Amtszeit jedoch zeichnet sich die Bedrohung durch das neuas-
syrische Reich unter Tiglat-Pileser III. ab, die später in militärischer Nieder-
lage, Vasallentum und Deportation
37
endete. Der Autor des Jonabuches
lässt den Propheten in eben jene Hauptstadt gehen und Buße predigen, die,
historisch gesehen, wenig später die Heimat Jonas zerstören wird. Böte sich
Jona hier nicht gleichsam posthum die Chance, den Lauf der Geschichte
dadurch zu ändern, den Botengang nicht auszuführen und Assyrien
dadurch der vernichtenden Strafe JHWHs auszuliefern, bevor Tiglat-Pileser
III. seine Pläne
38
umsetzten kann?
Es ist meines Erachtens sicher, dass diese Lesart vom Autor be- absichtigt
war und dem zeitgenössischen Leser des nachexilischen Israel diese Zeitreise
bewusst geworden ist. Vor dem Hintergrund dieser nationalen Katastrophe
37
Vergl.: Lambert ,W. G.: Assyrien und Israel, in: TRE I, S. 265-276.
38
Vergl. dazu auch Abschnitt 3.1.4.
11
erscheint Jonas Verhalten menschlich, nicht hochmütig, sondern engagiert
und nicht widerwillig, sondern vor allem fest im Glauben an die allumfas-
sende Gnade Gottes, die auch für die feindlichen Assyrer gilt. Der Bereich
der Theodizee muss in die Aus- legung des Jonabuches aufgenommen wer-
den.
2.5. Die Entstehungszeit des Jonabuches
Die Datierung des Jonabuches ist schwierig, umstritten und reicht vom 8.
Jahrhundert v. Chr., wenn man die Erzählung als Bericht des Propheten
Jona oder eines Zeitgenossen versteht, bis in die früh-hellinistische
39
Zeit
hinein. Einen terminus ad quem ist für das Jona-buch noch am einfachsten
zu bestimmen, da Sir 49,12 das Zwölf-prophetenbuch als abgeschlossen vo-
raussetzt und es damit nicht nach dem Ende des 3. Jahrhunderts
40
verfasst
worden sein kann.
Schwieriger wird es mit der Bestimmung des terminus post quem, weil der
Text selbst keinen direkten Hinweis auf seine Entstehungszeit gibt und in
der Mehrheit der Exegeten vorausgesetzt wird, dass es sich aus unterschied-
lichen Gründen nicht um einen Text der vorexilischen Zeit handeln kann.
Eine Möglichkeit bietet die Erwähnung der Hafenstadt Jafo (1,3), die belegen
könnte, dass das Buch erst entstanden sein kann, als der Hafen für antike
Überseereisen genutzt wurde. Hans Walter Wolf schreibt dazu, dass die Tar-
sis-Schifffahrt sicher nicht vor Hesekiel, also in die Zeit nach Nebukadnezars
II. am Ende des 6. Jahrhunderts, zu datieren
41
ist. Aufgrund der Bezüge des
Jonabuches zu Joel (2,13) erkennt Wolf, dass die Erzählung nicht vor der
Mitte des 4. Jahrhunderts
42
entstanden sein kann. Wahrscheinlicher sei die
39
Vergl.: Wolff, S. 56.
40
Vergl.: Wolff, S. 54.
41
Vergl.: Wolff, S. 75 und S. 79.
42
Vergl.: Wolff, S. 55.
12
früh-hellinistische Zeit, da sonst die Aufnahme griechischer Sagenstoffe
43
nicht zu erklären wäre.
Hartmut Gese
44
datiert das Jonabuch in die persische Zeit, genauer in die
erste Hälfte des 4. Jahrhunderts. Für ihn sind zwei Gründe entscheidend.
Gese erkennt, dass im hebräischen Text nur vom Reichsaramäischen her
erklärliche Aramäismen im Jonabuch vorhanden seien. Außerdem geht er
von der gut begründeten Annahme aus, dass das deuteronomistische Ge-
schichtswerk, also die Darstellung der Geschichte Israels von der Landnah-
me bis zum Ende der Königszeit im Südreich, ,,als in seinen Urteilen aner-
kannt vorauszusetzen"
45
sei. In Deuteronomium 18,14-22 wird deutlich ge-
sagt, was von falscher und wahrer Prophetie zu halten ist und wie sie er-
kannt wird. Jona fällt auch unter diese Beurteilung von wahrer Prophetie.
Dass Jona aus Gat-Hefer (2Kön 14,25) stammt, aber nach Jafo flieht, um ein
Schiff zu erreichen, könnte ebenfalls ein Hinweis auf die Entstehungszeit des
Buches sein. Geht man davon aus, dass Jona seinen Auftrag in seinem
Heimatort erhält und ihn nicht ausführen will, wäre von Gat-Hefer aus, das
liegt in der Nähe des heutigen Nazareth, der nächste Hafen Dor
46
und nicht
Jafo. Jonas Flucht nach Jafo ergibt nur einen Sinn, wenn er sich in Jerusa-
lem aufhält. Es muss dann aber die Frage geklärt werden, aus welchem
Grund der Autor des Jonabuches den Nordreichpropheten Jona nach Juda,
nach Jerusalem versetzt. Eine mögliche Erklärung für diesen Umstand wäre,
dass der Autor selbst sich in Jerusalem aufhält und seine Hauptfigur sich
ebenfalls dort aufhalten lässt, weil er keinen Zugang zum Nordreich hat. Das
Nordreich wurde von den Assyrern und anschließend von den Babyloniern
erobert. Erst in persischer Zeit war es für Juden wieder möglich, aus dem
Exil in Mesopotamien zurückzukehren und in der persischen und später
selbstständigen Provinz Juda
47
zu leben. Für den Autor wäre es demnach
völlig normal, den Aufenthaltsort seiner Hauptfigur nach Jerusalem zu le-
43
Vergl.: Wolff, S. 56.
44
Vergl.: Gese, H.: Jona ben Amittai, in: Alttestamentliche Studien, München 1991, S. 123f.
45
Gese: Jona ben Amittai, S. 124.
46
Vergl.: Calwer Bibelatlas, erarb. von Zwickel, W., Stuttgart 2000, S. 19.
47
Vergl.: Calwer Bibelatlas, S. 30f.
13
gen. Dies weise auf die Entstehung des Jonabuches in der persischen Zeit
hin.
Am Anfang dieses Abschnitts wurde bereits erwähnt, dass die Datierung des
Jonabuches sehr schwierig und im Detail umstritten ist. Für die Zielsetzung
dieser Auslegung ist eine genauere Datierung des Jonabuches weniger bedeu-
tungsvoll, solange die zeitliche Verortung als nachexilisch akzeptiert
48
wird.
2.6. Die Gliederung des Jonabuches
Obwohl eine ausreichend begründete Entscheidung über den Aufbau und
die Gliederung des Jonabuches erst am Ende einer Untersuchung gefällt
werden kann, empfiehlt es sich aus praktischen Gründen, die wesentlichen
Überlegungen zur Gliederung schon an dieser Stelle aufzuführen, um in spä-
teren Abschnitten dieser Arbeit die eigentlichen Gedankengänge zur Ausle-
gung des Textes nicht unnötigerweise zu unterbrechen.
Eine inhaltliche Gliederung in fünf symmetrische Szenen erkennt Opgen-
Rhein
49
im Jonabuch.
1. Gott sendet Jona als Gerichtspropheten nach Ninive 1,1-3
2. Jonas Flucht und Wurf ins Meer mit Bekehrung 1,4-16
3. Gott bringt Jona durch den Fisch an Land 2,1-11
2'. Jona gehorcht und bewirkt Umkehr Ninives, ärgert sich
aber über die ausbleibende Strafe 3,1-4,4
1'. Gott will bei Jona mit Rizinus, Sonne und Wurm Ver-
ständnis erzeugen 4,5-11
Auf zunächst ähnliche Weise, mit Ausnahme der Gliederung des zweiten
Teils, gliedert H. W. Wolff
50
und charakterisiert daher auch folgerichtig das
48
Dieses wäre bei allen in dieser Arbeit zitierten und untersuchten Artikel, Kommentaren und Gesamtdarstellun-
gen der Fall.
49
Vergl. Opgen-Rhein, S. 18-22 und S. 88-90.
50
Vergl. Wolff, S. 60f.
14
Jonabuch als Novelle, wenn er inhaltlich fünf Szenen erkennt, die alle auf
das Finale der Ereignisse ausgerichtet seien.
1. Das Verhältnis Jonas zu Ninive 1,1-3
2. Mit Jonas Scheitern werden die Heiden zum Glauben geführt 1,4-16
3. Jona wird auf den Weg nach Ninive gebracht 2,1-3,3a
4. Untergangsdrohung führt zur Umkehr der Niniviten und
Widerruf des Gerichtswortes 3,3b-10
5. JHWHs Antwort auf Jonas Unverständnis mit JHWHs Werk
an den Niniviten 4,1-11
Im Gegensatz zu den vorangestellten Autoren teilt Hartmut Gese
51
das Jo-
nabuch in sechs komplementäre Teile ein.
1. Auftrag an Jona und Flucht vor JHWH 1,1-3
2. Bekehrung der heidnischen Schiffsbesatzung 1,4-16
3. Jonas Errettung durch den großen Fisch 2,1-11
1'. Wiederholung des Auftrags und seine Erfüllung 3,1-3a
2'. Die Umkehr der Niniviten 3,3b-10
3'. Jonas Erkenntnis 4,1-11
Werden diese drei Gliederungen miteinander verglichen, so erkennt man
im Wesentlichen Unterschiede in der Einordnung und Bewertung des dritten
Teils (2,1-11). Während die erste Gliederung hier an eine Rückführung Jo-
nas an seinen Ausgangspunkt denkt, ähnlich wie Golka, wenn er den Fisch
als ,,gehorsames Transportmittel" bezeichnet (s. Abschnitt 1.3.), versteht
Hans Walter Wolff die Verse 2,1-3,3b als dritten Handlungsabschnitt einer
Novelle. Dies ist besonders dann sinnvoll, wenn hauptsächlich die Handlung
und die Orte der Handlung die Gliederungsmerkmale sein sollen. Beispiels-
weise würde ein modernes Bühnenspiel über Jona den Szenenwechsel eben-
falls bei 3,3a ansetzen, weil ein Handlungsabschnitt abgeschlossen ist und
die Bühne auf den Handlungsort Ninive umgebaut werden müsste.
51
Vergl. Gese, H.: Jona ben Amittai, S. 134f.
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Erstausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2005
- ISBN (Paperback)
- 9783958203501
- ISBN (eBook)
- 9783958208506
- Dateigröße
- 1 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Technische Universität Dortmund
- Erscheinungsdatum
- 2015 (Oktober)
- Note
- 1,3
- Schlagworte
- jona-psalm rahmen jona-buches eine einordnung toda-frömmigkeit
- Produktsicherheit
- BACHELOR + MASTER Publishing