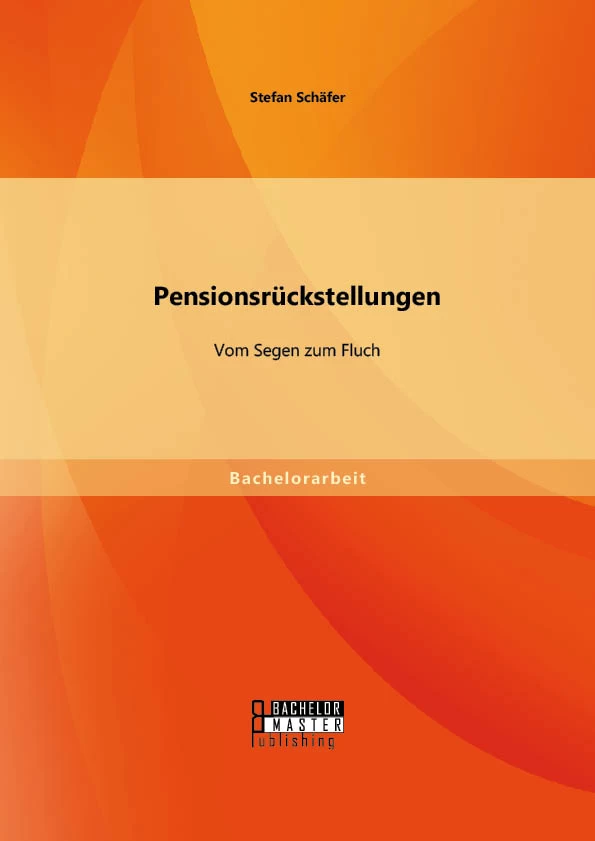Pensionsrückstellungen: Vom Segen zum Fluch
©2010
Bachelorarbeit
67 Seiten
Zusammenfassung
Das Fortbestehen der Kapitalgesellschaft kann durch die Erhöhung der Pensionsrückstellung in Gefahr sein. Unter dem Gesichtspunkt, dass Pensionszusagen an den Gesellschafter-Geschäftsführer einer kleinen Kapitalgesellschaft nicht nur zur Altersvorsorge, sondern bisher auch zur Steuerentlastung genutzt wurde, ist dies doppelt schlimm. Denn die Erhöhung der Pensionsrückstellung erfolgt lediglich in der Handelsbilanz. Steuerrechtliche Vorschriften für die Pensionsrückstellung wurden durch das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz nicht geändert. Insofern ist hier keine Steuerentlastung zu erwarten. Jahrelange, unter dem damalig geltenden Recht, sinnvolle steuerliche Beratung wird somit durch das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz plötzlich zu einer Fehlberatung.
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- 4 -
n. F.
neue Fassung
NWB Neue
Wirtschafts-Briefe
o. V.
ohne Verfasser
Stbg Die
Steuerberatung
StuB Unternehmensteuer
und
Bilanzen
R Richtlinien
RT Richttafel
Rz. Randziffer
u. a.
und andere
Vgl. Vergleiche
WP Wirtschaftsprüfer
ZinsO Zeitschrift
für
das gesamte Insolvenzrecht
- 5 -
1 Problemstellung
Das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz ist die größte Bilanzrechtsreform der
letzten 25 Jahre. Seit dem Bilanzrichtliniengesetz aus dem Jahre 1985 gab
es keine vergleichbar große Bilanzrechtsreform.
1
Erstmals angekündigt wur-
de das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz 2004 im Bilanzrechtsreformge-
setz. Am 08.11.2007 wurde der Referentenentwurf veröffentlicht. Nach eini-
ger Kritik an diesem Referentenentwurf wurde das Bilanzrechtsmodernisie-
rungsgesetz nochmal überarbeitet. Gut ein halbes Jahr später wurde dann
der Regierungsentwurf präsentiert. Dieser wurde im Herbst 2008, im Zuge
der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise noch einmal überdacht und ge-
ändert.
2
Am 26.03.2009 wurde das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz
durch den Deutschen Bundestag beschlossen, die Zustimmung des Bundes-
rates erfolgte am 03.04.2009.
3
Spätestens für Geschäftsjahre, die nach dem
31.12.2009 beginnen, ist das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz vollständig
anzuwenden. Einzelne Vorschriften treten auch schon früher in Kraft.
4
In dieser Bachelorarbeit wird auf die geänderten Bewertungsvorschriften für
Pensionsrückstellungen und ihre Auswirkungen auf diese Rückstellungen
eingegangen. Insbesondere werden die Änderungen für kleine, bilanziell
überschuldete GmbHs erläutert. Für diese Kapitalgesellschaften kann die
Neubewertung der Pensionsrückstellung extrem negative Folgen haben. Da
die Pensionsrückstellungen grundsätzlich höher bewertet werden müssen als
dies bisher geschah, wird bei diesen Kapitalgesellschaften die ohnehin schon
bestehende bilanzielle Überschuldung nochmals erhöht. Somit könnte durch
die Erhöhung der Pensionsrückstellung und der damit verbundenen Erhö-
hung der Überschuldung eine Insolvenzantragspflicht gemäß § 19 InsO ent-
stehen. Bei der Überprüfung, ob eine Insolvenzantragspflicht vorliegt, ist eine
1
Vgl. Zwirner, Christian, Auswirkungen des BilMoG auf die Rechnungslegung: Überblick
über die größte deutsche Bilanzrechtsreform der letzten 25 Jahre, in: Stbg, Heftnummer
6,
2009,
Seite
273
2
Vgl. Theile, Carsten, Der neue Jahresabschluss nach dem BilMoG, in: DStR, Beihefter zur
Heftnummer
18,
2009,
Seite
21
3
Vgl. Kirsch, Hanno, Positionierung des HGB-Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechts-
modernisierungsgesetz im Verhältnis zur Steuerbilanz, in: Stbg, Heftnummer 7, 2009
4
Vgl. Theile, Carsten, Der neue Jahresabschluss nach dem BilMoG, in: DStR, Beihefter zur
Heftnummer
18,
2009,
Seite
21
- 6 -
weitere Gesetzesänderung zu berücksichtigen. Aufgrund der weltweiten Fi-
nanz- und Wirtschaftskrise wurde das Finanzmarktstabilisierungsgesetz ver-
abschiedet, welches den Insolvenzgrund Überschuldung gemäß § 19 InsO
reformiert.
5
Das Fortbestehen der Kapitalgesellschaft kann durch die Erhö-
hung der Pensionsrückstellung in Gefahr sein. Unter dem Gesichtspunkt,
dass Pensionszusagen an den Gesellschafter-Geschäftsführer einer kleinen
Kapitalgesellschaft nicht nur zur Altersvorsorge, sondern bisher auch zur
Steuerentlastung genutzt wurde, ist dies doppelt schlimm. Denn die Erhö-
hung der Pensionsrückstellung erfolgt lediglich in der Handelsbilanz. Steuer-
rechtliche Vorschriften für die Pensionsrückstellung wurden durch das Bilanz-
rechtsmodernisierungsgesetz nicht geändert. Insofern ist hier keine Steu-
erentlastung zu erwarten. Jahrelange, unter dem damalig geltenden Recht,
sinnvolle steuerliche Beratung wird somit durch das Bilanzrechtsmodernisie-
rungsgesetz plötzlich zu einer Fehlberatung.
Um der Insolvenzantragspflicht zu entgehen und damit das Fortbestehen der
Kapitalgesellschaft zu sichern, können durch das Bilanzrechtsmodernisie-
rungsgesetz geschaffene Bilanzierungswahlrechte beziehungsweise refor-
mierte Ansatz- und Bewertungsvorschriften genutzt werden. Ob diese sinn-
voll sind, insbesondere für kleine bilanziell überschuldete GmbHs, wird in
dieser Bachelorarbeit erläutert. Außerdem werden weitere Lösungsansätze
vorgestellt. Zuvor wird jedoch noch darauf eingegangen, warum durch die
neuen Bewertungsvorschriften Probleme entstehen, welche Auswirkungen
das hat und welche Änderungen im Einzelnen auf die Kapitalgesellschaften
zukommen.
5
Vgl. Hirte, Heribert; Knof, Bela; Mock, Sebastian, Überschuldung und Finanzmarktstabili-
sierungsgesetz, in: ZinsO, Heftnummer 22, 2008, Seite 1217
- 7 -
2 Definitionen
2.1 Kleine Kapitalgesellschaft
Das Handelsgesetzbuch umschreibt die Größe einer Kapitalgesellschaft be-
ziehungsweise einer Kapitalgesellschaft(en) & Co im § 267 HGB. Das Han-
delsgesetzbuch spricht im § 267 HGB nur von Kapitalgesellschaften, der Ge-
setzeswortlaut gilt gemäß § 264a (1) HGB aber auch für Kapitalgesell-
schaft(en) & Co. Folgende drei Kriterien sind bei der Bestimmung der Größe
einer Kapitalgesellschaft zu untersuchen: Bilanzsumme in Euro, Umsatzerlö-
se in Euro und die durchschnittliche Anzahl der Arbeitnehmer. Eine Höchst-
grenze für eine kleine Kapitalgesellschaft sind 4.840.000 Euro Bilanzsumme
abzüglich eines gemäß § 268 (3) HGB auf der Aktivseite ausgewiesenen
Fehlbetrags. Durch den Abzug des negativen Kapitals wird vermieden, dass
eine Kapitalgesellschaft aufgrund von hohen Verlusten in die nächsthöhere
Größenklasse rutscht. Bei den Umsatzerlösen ist die Höchstgrenze bei
9.680.000 Euro erreicht. Als dritte Höchstgrenze ist eine durchschnittliche
Anzahl von 50 Arbeitnehmern vorgesehen. Zu beachten ist hierbei, dass von
einer kleinen Kapitalgesellschaft gesprochen wird, wenn gemäß § 267 (1)
HGB mindestens zwei der drei Grenzen nicht überschritten werden. Dem-
nach liegt eine kleine Kapitalgesellschaft auch dann vor, wenn die durch-
schnittliche Anzahl von Arbeitnehmern mehr als 50 beträgt, die Höchstgren-
zen bei der Bilanzsumme und den Umsatzerlösen aber nicht überschritten
werden. Die einzelnen Schwellenwerte einer Schwelle sind somit ranggleich.
Dies bedeutet, dass allein die Tatsache des Überschreitens eines Schwel-
lenwertes maßgebend ist und somit zum Beispiel eine nur geringfügige
Überschreitung von zwei Schwellenwerten durch ein erhebliches Unter-
schreiten des dritten Schwellenwertes nicht ausgeglichen werden darf.
6
Die
Schwellenwerte wurden durch das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz auf
die eben erläuterten Werte erhöht und gelten rückwirkend ab dem
01.01.2008.
7
Eine weitere zu prüfende Voraussetzung ist, dass die Kapital-
6
Vgl. Winkeljohann, Norbert; Lawall, Lars, in: Ellrott, Helmut u. a. (Hrsg.), Beck'scher Bilanz-
kommentar, 7. Auflage, München 2010, § 267 Rz. 5
7
Vgl. Theile, Carsten, Der neue Jahresabschluss nach dem BilMoG, in: DStR, Beihefter zur
Heftnummer
18,
2009,
Seite
25
- 8 -
gesellschaft nicht kapitalmarktorientiert gemäß § 264d HGB ist, denn dann
gilt sie laut § 267 (3) Satz 2 HGB stets als große Kapitalgesellschaft. Weiter-
hin setzt eine Klassifizierung in eine kleine, mittlere oder große Kapitalgesell-
schaft gemäß § 267 (4) HGB voraus, dass die Schwellenwerte an zwei auf-
einanderfolgenden Stichtagen über- beziehungsweise unterschritten wer-
den.
8
Kleine Kapitalgesellschaften genießen einige Erleichterungen in der Rech-
nungslegung, Offenlegung und Prüfung. Zum Beispiel kann gemäß § 288 (1)
HGB auf einige Angaben im Anhang verzichten werden. Weiterhin muss die
kleine Kapitalgesellschaft gemäß § 326 Satz 1 HGB nur die Bilanz und den
Anhang veröffentlichen. Außerdem muss der Jahresabschluss einer kleinen
Kapitalgesellschaft gemäß § 316 (1) Satz 1 HGB nicht durch einen Ab-
schlussprüfer geprüft werden.
2.2 Bilanzielle Überschuldung
Der Überschuldungsbegriff wird in der Insolvenzordnung definiert. Demnach
liegt gemäß § 19 (2) InsO eine Überschuldung vor, wenn das Vermögen der
Kapitalgesellschaft die Verbindlichkeiten nicht mehr deckt und eine Fortfüh-
rung des Unternehmens unwahrscheinlich ist. Jedoch ist der Insolvenzrecht-
liche Schuldbegriff nicht gleichbedeutend mit einer bilanziellen Überschul-
dung.
9
Eine bilanzielle Überschuldung liegt bereits vor, wenn eine Saldierung
der einzelnen Eigenkapitalposten ein negatives Ergebnis ergibt und das Ei-
genkapital somit gemäß § 268 (3) HGB auf der Aktivseite ausgewiesen wer-
den muss. Demnach wird von einer bilanziellen Überschuldung gesprochen,
wenn das Reinvermögen, also Aktiva abzüglich Verbindlichkeiten, die Eigen-
kapitalziffer nicht mehr erreicht.
10
Ist dies der Fall, so ist eine weitergehende
8
Vgl. Winkeljohann, Norbert; Lawall, Lars, in: Ellrott, Helmut u. a. (Hrsg.), Beck'scher Bilanz-
kommentar, 7. Auflage, München 2010, § 267 Rz. 14
9
Siehe: Memento-Redaktion Gesellschaftsrecht (Hrsg.), Gesellschaftsrecht für die Praxis
2009, 7. Auflage, Freiburg 2008, Rz. 92.840
10
Vgl. Amelung, Andreas, in: Kraemer, Joachim; Vallender, Heinz; Vogelsang, Norbert
(Hrsg.), Handbuch zur Insolvenz, Band 1, Bonn 1997, 42. Aktualisierung, Fach 2 Kapitel
2
Rz.
48
- 9 -
Überprüfung vorzunehmen, um zu beurteilen, ob die Kapitalgesellschaft im
insolvenzrechtlichen Sinne überschuldet ist und somit gemäß § 16 InsO in
Verbindung mit § 19 (1) InsO eine Insolvenzantragspflicht vorliegt.
11
Somit ist
eine bilanzielle Überschuldung stets ein Krisenindikator, er zeigt jedoch nur
die Differenz zwischen Schulden und Vermögen an. Wobei hier das Vermö-
gen lediglich mit Buchwerten bilanziert wird.
12
Eine bilanzielle Überschuldung
wird häufig auch als Unterbilanz bezeichnet.
13
Wobei eine Unterbilanz jedoch
bereits dann vorliegt, wenn das gesamte Aktivvermögen nach Abzug sämtli-
cher Verbindlichkeiten nicht ausreicht den Nennbetrag des Stammkapitals zu
decken.
14
Eine Insolvenzantragspflicht besteht bei einer bloßen bilanzielle Überschul-
dung nicht. Jedoch ist gemäß § 49 (3) GmbHG unverzüglich eine Gesell-
schafterversammlung einzuberufen, wenn sich aus der Jahresbilanz oder
einer während des Geschäftsjahres aufgestellten Bilanz ergibt, dass die Hälf-
te des Stammkapitals verloren ist.
15
Ein Ausnahme dieser Pflicht besteht le-
diglich für die Einpersonen-GmbH oder aber wenn alle Gesellschafter gleich-
zeitig Geschäftsführer sind.
16
Der Begriff der Unterkapitalisierung ist nicht mit dem Überschuldungsbegriff
gleichzusetzen. Die Gesellschafter der Kapitalgesellschaft sind in ihrer Ent-
scheidung frei, ob sie die Kapitalgesellschaft mit Eigenkapital oder Fremdka-
pital ausstatten. Eine Fremdfinanzierung ist oftmals flexibler und ist aus steu-
errechtlicher Sicht attraktiver. Da der Begriff der Unterkapitalisierung ver-
wendet wird sobald die Eigenmittel der Kapitalgesellschaft den Finanzbedarf
11
Vgl. Memento-Redaktion Gesellschaftsrecht (Hrsg.), Gesellschaftsrecht für die Praxis
2009, 7. Auflage, Freiburg 2008, Rz. 76.300
12
Vgl. Wolf, Thomas; Schlagheck, Markus, Überschuldung, Hamm 2007, Seite 3
13
Vgl. Amelung, Andreas, in: Kraemer, Joachim; Vallender, Heinz; Vogelsang, Norbert
(Hrsg.), Handbuch zur Insolvenz, Band 1, Bonn 1997, 42. Aktualisierung, Fach 2 Kapitel
2
Rz.
48
14
Vgl. Roser, Frank, Kapitalerhaltung, in: Gosch, Dietmar; Schwedhelm, Rolf; Spiegelberg,
Sebastian (Hrsg.), GmbH-Beratung, 16. Lieferung, Köln 2007, Seite K 12
15
Vgl. Lohr, Martin, Geschäftsführer, in: Gosch, Dietmar; Schwedhelm, Rolf; Spiegelberg,
Sebastian (Hrsg.), GmbH-Beratung, 16. Lieferung, Köln 2007, Seite G 35; Vgl. Memento-
Redaktion Gesellschaftsrecht (Hrsg.), Gesellschaftsrecht für die Praxis 2009, 7. Auflage,
Freiburg
2008,
Rz.
22.905
16
Vgl. Memento-Redaktion Gesellschaftsrecht (Hrsg.), Gesellschaftsrecht für die Praxis
2009, 7. Auflage, Freiburg 2008, Rz. 92.160
- 10 -
der Kapitalgesellschaft nicht mehr entsprechen, kann die Unterkapitalisierung
eine Vorstufe zur Überschuldung beziehungsweise Zahlungsunfähigkeit
sein.
17
2.3 Insolvenzrechtliche Überschuldung
Gemäß § 19 (2) InsO liegt eine insolvenzrechtliche Überschuldung vor, wenn
das Vermögen der Kapitalgesellschaft die Verbindlichkeiten nicht mehr deckt
und eine Fortführung des Unternehmens nicht wahrscheinlich ist. Dies wird
durch eine Überschuldungsprüfung beziehungsweise durch eine Fortfüh-
rungsprognose festgestellt. Meist wird hierzu auch eine Überschuldungsbi-
lanz aufgestellt. Eine insolvenzrechtliche Überschuldung ist vollständig von
der Unterbilanz, also der bilanziellen Überschuldung, zu unterscheiden.
18
Eine Überschuldungsbilanz ist eine sogenannte Sonderbilanz.
19
Bei der Überschuldungsprüfung sind die handelsrechtlichen Bewertungsvor-
schriften nicht anzuwenden. Die Vermögensgegenstände sind realistisch zu
bewerten.
20
Auf der Aktivseite sind in der Überschuldungsbilanz alle selbst-
ständig verwertbare Vermögensgegenstände anzusetzen.
21
Auf der Passiv-
seite sind die bestehenden und im Falle eines Insolvenzverfahrens zu bedie-
nenden Verbindlichkeiten aufzuführen.
22
Daher sind bei der Überschul-
dungsprüfung Forderungen auf Rückgewähr von Gesellschafterdarlehen o-
der aus Rechtshandlungen, die wirtschaftlich einem solchen Darlehen ent-
sprechen gemäß § 19 (2) Satz 2 InsO, nicht den Verbindlichkeiten hinzuzu-
17
Vgl. Amelung, Andreas, in: Kraemer, Joachim; Vallender, Heinz; Vogelsang, Norbert
(Hrsg.), Handbuch zur Insolvenz, Band 1, Bonn 1997, 42. Aktualisierung, Fach 2 Kapitel
2
Rz.
49
18
Vgl. Wolf, Thomas; Schlagheck, Markus, Überschuldung, Hamm 2007 Seite 3 f.; Vgl. A-
melung, Andreas, in: Kraemer, Joachim; Vallender, Heinz; Vogelsang, Norbert (Hrsg.),
Handbuch zur Insolvenz, Band 1, Bonn 1997, 42. Aktualisierung, Fach 2 Kapitel 2 Rz. 48
19
Vgl. Schiffers, Joachim, Sonderbilanzen, in: Gosch, Dietmar; Schwedhelm, Rolf; Spiegel-
berg,
Sebastian
(Hrsg.),
GmbH-Beratung, 16. Lieferung, Köln 2007, Seite S 24
20
Vgl. Goetsch, Hans-W., in: Blersch, Jürgen u. a. (Hrsg.), Berliner Kommentar Insolvenz
recht, 23. Lieferung, Freiburg 2009, § 19 Rz. 33
21
Vgl. Wolf, Thomas; Schlagheck, Markus, Überschuldung, Hamm 2007 Seite 34; Vgl.
Goetsch, Hans-W., in: Blersch, Jürgen u. a. (Hrsg.), Berliner Kommentar Insolvenzrecht,
23. Lieferung, Freiburg 2009, § 19 Rz. 34
22
Vgl. Goetsch, Hans-W. in: Blersch, Jürgen u. a. (Hrsg.), Berliner Kommentar Insolvenz-
recht, 23. Lieferung, Freiburg 2009, § 19 Rz. 35
- 11 -
rechnen. Voraussetzung hierfür ist aber, dass zwischen Gläubiger und
Schuldner der Nachrang im Insolvenzverfahren hinter den in § 39 (1) Num-
mer 1 bis 5 InsO bezeichneten Forderungen vereinbart worden ist.
23
Hier-
durch wird insbesondere bei kleinen Kapitalgesellschaften, die von Gesell-
schafter-Geschäftsführern geführt werden, die insolvenzrechtliche Über-
schuldung abgewandt. Allerdings ist der Rangrücktritt hierfür erforderlich,
denn durch ein solches Darlehen wird der Kapitalgesellschaft Vermögen zu-
geführt, ohne das die dafür nötige Verbindlichkeit bei der Überschuldungs-
prüfung anzusetzen ist.
24
Dadurch kann der Gesellschafter die notleidende
Kapitalgesellschaft vor der Insolvenz retten, ohne eine Kapitalerhöhung
durchführen zu müssen. Bei Besserung der wirtschaftlichen Lage der Kapi-
talgesellschaft kann das Darlehen durch die Kapitalgesellschaft wieder getilgt
werden. Dadurch erhält der Gesellschafter sein Geld einfacher zurück, als
dies bei einer Kapitalerhöhung möglich wäre. Neben dem Gesellschafterdar-
lehen mit Rangrücktritt und der Kapitalerhöhung könnte auch die Aufnahme
eines stillen Gesellschafters in Betracht kommen.
25
Somit sind grundsätzlich
alle Möglichkeiten, die die Kapitalgesellschaft entschulden, dazu geeignet,
die Kapitalgesellschaft vor der Insolvenzantragspflicht aufgrund von Über-
schuldung zu retten.
2.4 Fortführungsprognose
Die Fortführungsprognose ist unverändert der Kern der Überschuldungsprü-
fung.
26
Um eine positive Fortführungsprognose zu erstellen ist subjektiv ein
Fortführungswille und objektiv eine Fortführungsmöglichkeit notwendig. Die
objektive Überlebensfähigkeit muss aus einem schlüssigen und aussagekräf-
23
Vgl. Memento-Redaktion Gesellschaftsrecht (Hrsg.), Gesellschaftsrecht für die Praxis
2009, 7. Auflage, Freiburg 2008, Rz. 92.850
24
Vgl. Amelung, Andreas, in: Kraemer, Joachim; Vallender, Heinz; Vogelsang, Norbert
(Hrsg.), Handbuch zur Insolvenz, Band 1, Bonn 1997, 42. Aktualisierung, Fach 2 Kapitel
2
Rz.
106
25
Vgl. Amelung, Andreas, in: Kraemer, Joachim; Vallender, Heinz; Vogelsang, Norbert
(Hrsg.), Handbuch zur Insolvenz, Band 1, Bonn 1997, 42. Aktualisierung, Fach 2 Kapitel
2
Rz.
105
26
Vgl. Hirte, Heribert; Knof, Bela; Mock, Sebastian, Überschuldung und Finanzmarktstabili-
sierungsgesetz, in: ZinsO, Heftnummer 22, 2008, Seite 1221
- 12 -
tigen Unternehmenskonzept hergeleitet werden können.
27
Die Fortführungs-
prognose ist anhand der Finanzkraft der Kapitalgesellschaft vorzunehmen.
Demnach ist zu prüfen, ob die Kapitalgesellschaft mittelfristig in der Lage
sein wird die bestehenden Verbindlichkeiten und die durch die Fortführung
noch entstehenden Verbindlichkeiten durch ihr vorhandenes Vermögen und
ihre durch die Fortführung hinzukommenden Erträgen mindestens abzude-
cken.
28
Der mittelfristige Zeitraum ist dabei gesetzlich nicht festgelegt. Allge-
mein wird von einem Prognosezeitraum von zwei Jahren ausgegangen.
29
Durch das Finanzmarktstabilisierungsgesetz liegt demnach bei einer positi-
ven Fortführungsprognose keine Überschuldung vor. Damit gewinnt die Fort-
führungsprognose enorm an Bedeutung.
30
Vor Inkrafttreten des Finanzmarktstabilisierungsgesetzes und der damit ver-
bundenen Änderung der Bedeutung der Fortführungsprognose hatte die Fort-
führungsprognose lediglich Auswirkung auf die Bewertung der Vermögens-
gegenstände. Das bedeutet, dass die Vermögensgegenstände bei einer po-
sitiven Fortführungsprognose nicht mit Zerschlagungswerten bewertet wer-
den mussten. Somit konnte trotz positiver Fortführungsprognose eine Insol-
venzantragspflicht wegen Überschuldung gegeben sein, wenn der Wert der
Vermögensgegenstände den Wert der Verbindlichkeiten nicht mehr deckte.
31
Hiernach war mit Hilfe einer dreistufigen Prüfung zu prüfen, ob eine insol-
venzrechtliche Überschuldung vorlag. Zunächst wurden die Vermögensge-
genstände nach Liquidationswerten bewertet. Deckten die Vermögenswerte
nun die Verbindlichkeiten, lag keine Überschuldung vor. War dies nicht der
Fall, so folgte der zweite Prüfungsschritt. Hier war bei Fortführungswillen eine
Fortführungsprognose zu erstellen. War diese positiv, folgte der dritte Prü-
fungsschritt. Nun mussten die Vermögensgegenstände mit Fortführungswer-
27
Vgl. Memento-Redaktion Gesellschaftsrecht (Hrsg.), Gesellschaftsrecht für die Praxis
2009, 7. Auflage, Freiburg 2008, Rz. 92.845
28
Vgl. Goetsch, Hans-W., in: Blersch, Jürgen u. a. (Hrsg.), Berliner Kommentar Insolvenz-
recht, 23. Lieferung, Freiburg 2009, § 19 Rz. 26
29
Vgl. Memento-Redaktion Gesellschaftsrecht (Hrsg.), Gesellschaftsrecht für die Praxis
2009, 7. Auflage, Freiburg 2008, Rz. 92.845
30
Vgl. Hirte, Heribert; Knof, Bela; Mock, Sebastian, Überschuldung und Finanzmarktstabili-
sierungsgesetz, in: ZinsO, Heftnummer 22, 2008, Seite 1220
31
Vgl. Goetsch, Hans-W., in: Blersch, Jürgen u. a. (Hrsg.), Berliner Kommentar Insolvenz-
recht, 23. Lieferung, Freiburg 2009, § 19 Rz. 15
- 13 -
ten bewertet werden. Deckten die Vermögenswerte alle Verbindlichkeiten, so
lag keine Überschuldung vor. Deckten die Vermögensgegenstände die Ver-
bindlichkeiten nicht oder war bereits die Fortführungsprognose negativ, lag
eine Überschuldung vor.
32
Diese Überschuldungsprüfung wird voraussicht-
lich wieder in Kraft treten, sobald das Finanzmarktstabilisierungsgesetz au-
ßer Kraft gesetzt wird.
33
2.5 Insolvenzantragspflicht
Ein Insolvenzantrag kann gemäß § 13 (1) InsO in Verbindung mit § 14 (1)
InsO von einem Gläubiger, der ein berechtigtes Interesse hat, gestellt wer-
den. Ein Insolvenzantrag muss jedoch durch den Schuldner auf jeden Fall
ohne schuldhaftes Zögern gestellt werden, wenn ein Insolvenzgrund eintritt.
Das bedeutet, dass spätestens drei Wochen nach Eintritt eines Insolvenz-
grundes ein Insolvenzantrag gestellt werden muss.
34
Bei einer juristischen
Person ist jedes Mitglied des Vertretungsorgans gemäß § 15 (1) Satz 1 InsO
berechtigt Insolvenzantrag zu stellen. Ist eine Kapitalgesellschaft führungs-
los, so ist gemäß § 15 (1) Satz 2 InsO jeder Gesellschafter beziehungsweise
jedes Mitglied des Aufsichtsrates berechtigt Insolvenzantrag zu stellen. Wie
bereits erwähnt entsteht hieraus eine Antragspflicht, sobald ein Insolvenz-
grund vorliegt.
35
Für Kapitalgesellschaften gibt es drei Insolvenzgründe. Der
erste ist die Zahlungsunfähigkeit gemäß § 17 InsO. Die drohende Zahlungs-
unfähigkeit gemäß § 18 InsO ist der zweite Insolvenzgrund. Der dritte Insol-
venzgrund ist die Überschuldung gemäß § 19 InsO, dieser Insolvenzgrund
gilt gemäß § 19 (1) InsO nur für Kapitalgesellschaften.
32
Vgl. Hirte, Heribert; Knof, Bela; Mock, Sebastian, Überschuldung und Finanzmarktstabili-
sierungsgesetz, in: ZinsO, Heftnummer 22, 2008, Seite 1220; Vgl. Goetsch, Hans-W., in:
Blersch, Jürgen u. a. (Hrsg.), Berliner Kommentar Insolvenzrecht, 23. Lieferung, Freiburg
2009, § 19 Rz. 30
33
Vgl. Goetsch, Hans-W., in: Blersch, Jürgen u. a. (Hrsg.), Berliner Kommentar Insolvenz
recht, 23. Lieferung, Freiburg 2009, § 19 Rz. 21 ff.
34
Vgl. Engelsing, Lutz, Insolvenz, in: Gosch, Dietmar; Schwedhelm, Rolf; Spiegelberg, Se-
bastian (Hrsg.), GmbH-Beratung, 16. Lieferung, Köln 2007, Seite I 7
35
Vgl. Memento-Redaktion Gesellschaftsrecht (Hrsg.), Gesellschaftsrecht für die Praxis
2009, 7. Auflage, Freiburg 2008, Rz. 92.820
- 14 -
Durch das Finanzmarktstabilisierungsgesetz wurde die Insolvenzantrags-
pflicht, insbesondere bei insolvenzrechtlicher Überschuldung, gelockert.
Demnach besteht bei insolvenzrechtlicher Überschuldung generell keine In-
solvenzantragspflicht, wenn die Finanzkraft des Unternehmens mittelfristig
zur Fortführung ausreicht. Es entfällt der Insolvenzgrund der Überschuldung,
wenn eine positive Fortführungsprognose abgegeben werden kann.
36
Ur-
sprünglich galt diese Regelung, die am 18.10.2008 in Kraft getreten ist, bis
zum 31.12.2010. Durch das Gesetz zur Erleichterung der Sanierung von Un-
ternehmen wurde es bis zum 31.12.2012 verlängert.
37
Das Bundesministeri-
um der Justiz hat eine nochmalige Verlängerung bis 31.12.2013 in Aussicht
gestellt, danach wird voraussichtlich wieder die vorherige Regelung ange-
wandt.
38
Diese gelockerte Vorschrift ist keine faktische Abschaffung der In-
solvenzantragspflicht bei Überschuldung. Die Fortführungsprognose ist nur
dann positiv, wenn es überwiegend wahrscheinlich ist, dass die Kapitalge-
sellschaft fortgeführt wird. Dies ist von Amts wegen zu untersuchen. Lässt
sich nicht abschließend festlegen, ob die Fortführung der Kapitalgesellschaft
überwiegend wahrscheinlich ist, so ist im Zweifel von einer Überschuldung
auszugehen und somit einem Insolvenzantragsgrund. Der Geschäftsführer
ist jedoch hinsichtlich einer eventuellen strafrechtlichen Verfolgung aufgrund
von Insolvenzverschleppung auf der sicheren Seite, wenn durch einen unab-
hängigen, fachlich qualifizierten Berufsträger eine positive Fortführungsprog-
nose erstellt wird.
39
Durch diese Lockerung der Insolvenzantragspflicht bei Überschuldung rea-
gierte der Gesetzgeber auf die weltweite Finanzkrise. Er reformierte jedoch
nur die Insolvenzantragspflicht aufgrund von Überschuldung. Der allgemeine
Insolvenzgrund der Zahlungsunfähigkeit gemäß § 17 InsO bleibt unverän-
36
Vgl. Goetsch, Hans-W., in: Blersch, Jürgen u. a. (Hrsg.), Berliner Kommentar Insolvenz-
recht, 23. Lieferung, Freiburg 2009, § 19 Rz. 12
37
Vgl. Amelung, Andreas, in: Kraemer, Joachim; Vallender, Heinz; Vogelsang, Norbert
(Hrsg.), Handbuch zur Insolvenz, Band 1, Bonn 1997, 42. Aktualisierung, Fach 2 Kapitel
2
Rz.
46
38
Vgl. Bundesministerium der Justiz, Pressemitteilung vom 18.09.2009
39
Vgl. Rokas, Alexandros, Die "neue" Legaldefinition der Überschuldung, in: ZinsO, Heft-
nummer 1/2, 2009, Seite 20
- 15 -
dert.
40
In einschlägigen Fachzeitschriften wird jedoch bereits diskutiert, ob
auch für die Zahlungsunfähigkeit ähnliche Regeln wie für die Überschul-
dungsprüfung gelten müssten.
41
Die Reform der Überschuldung gemäß § 19 InsO wird aber teilweise auch
sehr kritisch gesehen. Den durch eine fragwürdige optimistische Fortfüh-
rungsprognose kann einem eigentlich insolvenzreifen Unternehmen eine
Fortführung ermöglichet werden, die dann zu Lasten von bestehenden und
zukünftigen Gläubigern geht. Dies wäre nicht im Sinne der Insolvenzordnung.
Denn nur durch eine frühzeitige Insolvenzeröffnung mit ausreichender Masse
ermöglicht eine Sanierung.
42
40
Vgl. Poertzgen, Christoph, Fünf Thesen zum neuen (alten) Überschuldungsbegriff (§ 19
InsO n. F.), in: ZinsO, Heftnummer 10, 2009, Seite 406
41
Siehe: Hirte, Heribert; Knof, Bela; Mock, Sebastian, Überschuldung und Finanzmarktstabi-
lisierungsgesetz, in: ZinsO, Heftnummer 22, 2008, Seite 1223
42
Vgl. Rokas, Alexandros, Die "neue" Legaldefinition der Überschuldung, in: ZinsO, Heft-
nummer 1/2, 2009, Seite 20
- 16 -
3 Entwicklung der Pensionsrückstellungen
3.1 Pensionsrückstellungen vor und nach BiRiLiG
3.1.1 Voraussetzung für die Bildung von Pensionsrückstellungen
in der Handelsbilanz
Grundsätzlich sind folgende Pensionsformen zu unterscheiden: Pension aus
einer Direktversicherung, Pension aus einer Pensions- oder Unterstützungs-
kasse und die unmittelbare Pension. Bei einer Direktversicherung schließt
die Kapitalgesellschaft für den Arbeitnehmer bei einer betriebsfremden Ver-
sicherung eine Lebens- beziehungsweise Invaliditätsversicherung ab.
Dadurch fließen die periodisch gezahlten Versicherungsleistungen in der
Gewinn- und Verlustrechnung in den Aufwand. Das Versicherungsunterneh-
men ist Träger der Pension. Bei einer Pensions- oder Unterstützungskasse
ist das Prinzip identisch mit dem Unterschied, dass die Kapitalgesellschaft
meist Gesellschaftsanteile an dem rechtlich selbstständigen Versicherungs-
unternehmen besitzt.
43
Bei diesen beiden Pensionsformen handelt es sich
um sogenannte mittelbare Pensionszusagen.
44
Bei einer unmittelbaren Pen-
sionszusage ist die Kapitalgesellschaft selbst Träger der Pension. Dadurch
muss die Kapitalgesellschaft die Pensionsleistungen selbst aufbringen. Somit
entstehen Verbindlichkeiten, die erst in ferner Zukunft ausgeglichen werden
müssen. Daher ist zu überprüfen, ob eine Rückstellung anzusetzen ist.
45
Vor Einführung des Bilanzrichtliniengesetzes gab es in der Handelsbilanz ein
Passivierungswahlrecht für Pensionszusagen. Demnach musste das Unter-
nehmen unmittelbar erteilte Pensionszusagen nicht in der Handelsbilanz
passivieren. Dieses Passivierungswahlrecht gilt gemäß Artikel 28 (1) EGHGB
nach wie vor. Somit besteht weiterhin ein Passivierungswahlrecht für unmit-
telbare Pensionszusagen, die vor dem 01.01.1987 erteilt wurden. Diese lang-
43
Vgl. Coenenberg, Adolf; Haller, Axel; Schultze, Wolfgang, Jahresabschluss und Jahresab-
schlussanalyse, 21. Auflage , Stuttgart 2009, Seite 420 f.
44
Vgl. Ellrott, Helmut; Rhiel, Raimund, in: Ellrott, Helmut u. a. (Hrsg.), Beck'scher Bilanz-
kommentar, 7. Auflage, München 2010, § 249 Rz. 164
45
Vgl. Coenenberg, Adolf; Haller, Axel; Schultze, Wolfgang, Jahresabschluss und Jahresab-
schlussanalyse,
21.
Auflage
,
Stuttgart 2009, Seite 421
- 17 -
fristige Übergangsregelung wird erst dann überflüssig, wenn alle sogenann-
ten Altzusagen hinfällig werden (biologische Lösung).
46
Durch das Bilanzrichtliniengesetz wurde unter anderem die Rückstellungs-
pflicht im Handelsgesetzbuch geändert. Dadurch wurde das Passivierungs-
wahlrecht bei einer unmittelbaren Pensionszusage in eine Passivierungs-
pflicht abgeändert. Denn durch eine Pensionszusage an einen Arbeitnehmer
entsteht der Kapitalgesellschaft aufgrund dieser Verpflichtung eine Verbind-
lichkeit. Diese Verbindlichkeit ist in ihrer Fälligkeit und Höhe ungewiss und
erfüllt somit die Voraussetzung des § 249 (1) HGB.
47
Auch mittelbare Pensionsverpflichtungen können zu einem Passivierungs-
wahlrecht führen. Hier ist eine Unterscheidung zwischen Altzusagen vor dem
01.01.1987 und Neuzusagen nach dem 31.12.1986 irrelevant, da das Passi-
vierungswahlrecht auch nach dem Bilanzrichtliniengesetz bestehen blieb.
48
Demnach musste selbst dann keine Rückstellung gebildet werden, wenn die
Kapitalgesellschaft aufgrund von Deckungslücken für einen Teil der Pensi-
onsverpflichtung einzustehen hat.
49
3.1.2 Voraussetzungen für die Bildung von Pensionsrückstellun-
gen für die Steuerbilanz
Das Steuerrecht erkennt Pensionsrückstellungen lediglich an, wenn diese die
Vorrausetzungen des § 6a EStG erfüllen. Auch im Steuerrecht ist zwischen
Altzusagen und Neuzusagen zu unterscheiden. Pensionsrückstellungen für
Altzusagen werden lediglich anerkannt, wenn für die Pension auch in der
Handelsbilanz eine Rückstellung gebildet wurde. Im Falle einer Neuzusage
46
Vgl. Ellrott, Helmut; Rhiel, Raimund, in: Ellrott, Helmut u. a. (Hrsg.), Beck'scher Bilanz-
kommentar, 7. Auflage, München 2010, § 249 Rz. 260
47
Vgl. Coenenberg, Adolf; Haller, Axel; Schultze, Wolfgang, Jahresabschluss und Jahresab-
schlussanalyse,
21.
Auflage
,
Stuttgart 2009, Seite 421
48
Vgl. Ellrott, Helmut; Rhiel, Raimund, in: Ellrott, Helmut u. a. (Hrsg.), Beck'scher Bilanz-
kommentar, 7. Auflage, München 2010, § 249 Rz. 266
49
Vgl. Coenenberg, Adolf; Haller, Axel; Schultze, Wolfgang, Jahresabschluss und Jahresab-
schlussanalyse,
21.
Auflage
,
Stuttgart 2009, Seite 421
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Erstausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2010
- ISBN (Paperback)
- 9783958203679
- ISBN (eBook)
- 9783958208674
- Dateigröße
- 759 KB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Duale Hochschule Baden-Württemberg Mannheim, früher: Berufsakademie Mannheim
- Erscheinungsdatum
- 2015 (Oktober)
- Note
- 2
- Schlagworte
- pensionsrückstellungen segen fluch
- Produktsicherheit
- BACHELOR + MASTER Publishing