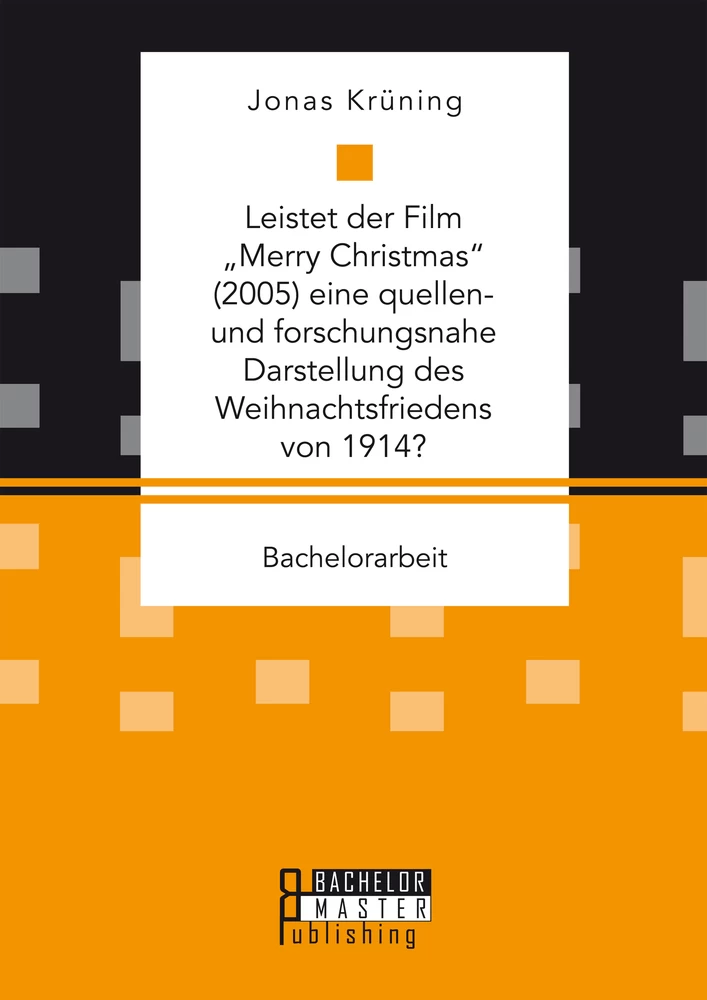Leistet der Film „Merry Christmas“ (2005) eine quellen- und forschungsnahe Darstellung des Weihnachtsfriedens von 1914?
©2014
Bachelorarbeit
53 Seiten
Zusammenfassung
Mit dem Weihnachtsfrieden von 1914 sieht sich die Forschung zum Ersten Weltkrieg einem sehr paradoxen und zugleich faszinierenden Themenkomplex konfrontiert. Während der Kampfhandlungen kommt es an vielen Stellen der belgischen, britischen und französischen Front zu spontanen Verbrüderungen an Heiligabend. Dabei scheint sich ein bestimmtes Handlungsmuster abzuzeichnen, wonach die meisten Fraternisationen charakterisiert werden können. Das Singen von Weihnachtsliedern zusammen mit dem Feind, der Abschluss eines Waffenstillstands zu Heiligabend, das Treffen im Niemandsland zum Austausch von kleinen Geschenken bis hin zur gemeinsamen Bestattung der Toten oder Fußballspiele zwischen fraternisierenden Soldaten sind wesentliche Aspekte dieses historischen Ereignisses.
Die Auseinandersetzung mit dem Weihnachtsfrieden und jenem kennzeichnenden Handlungsmuster blieb zumeist Aufgabe der historischen Forschung und weniger eine Umsetzung des Ereignisses in der Literatur oder einer visuellen Repräsentation als Bestandteil des Ersten Weltkriegs. Erst mit der Jahrtausendwende und der nötigen zeitlichen Distanz zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs fand die Thematik des Weihnachtsfriedens Einzug in die filmische Repräsentation und Interpretation statt. 2005 erscheint mit »Merry Christmas« (original: »Joyeux Noël«) von Regisseur Christian Carion die bislang längste Verfilmung zur Thematik der Fraternisationen. Unter französischer, deutscher, britischer, belgischer und rumänischer Beteiligung entstand eine retrospektive Sichtweise zu den Ereignissen des Weihnachtsfriedens. Aufgrund dieser Inszenierung will die vorliegende Untersuchung herausfinden, ob für die visuelle Repräsentation des Weihnachtsfriedens in »Merry Christmas« eine quellen- und forschungsnahe Darstellung des historischen Ereignisses gewährleistet ist. Anhand von ausgewählten Untersuchungsschwerpunkten versucht die Bearbeitung, wesentliche Bezüge zwischen dem Film und seinem Einsatz von wissenschaftlich fundierten Erkenntnissen zum historischen Kontext herauszustellen. Mithilfe von zahlreichem Quellenmaterial und aktuellen Forschungsmeinungen soll herausgefunden werden, inwiefern Regisseur Christian Carion ein authentisches Bild des Weihnachtsfriedens von 1914 nachzeichnet.
Die Auseinandersetzung mit dem Weihnachtsfrieden und jenem kennzeichnenden Handlungsmuster blieb zumeist Aufgabe der historischen Forschung und weniger eine Umsetzung des Ereignisses in der Literatur oder einer visuellen Repräsentation als Bestandteil des Ersten Weltkriegs. Erst mit der Jahrtausendwende und der nötigen zeitlichen Distanz zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs fand die Thematik des Weihnachtsfriedens Einzug in die filmische Repräsentation und Interpretation statt. 2005 erscheint mit »Merry Christmas« (original: »Joyeux Noël«) von Regisseur Christian Carion die bislang längste Verfilmung zur Thematik der Fraternisationen. Unter französischer, deutscher, britischer, belgischer und rumänischer Beteiligung entstand eine retrospektive Sichtweise zu den Ereignissen des Weihnachtsfriedens. Aufgrund dieser Inszenierung will die vorliegende Untersuchung herausfinden, ob für die visuelle Repräsentation des Weihnachtsfriedens in »Merry Christmas« eine quellen- und forschungsnahe Darstellung des historischen Ereignisses gewährleistet ist. Anhand von ausgewählten Untersuchungsschwerpunkten versucht die Bearbeitung, wesentliche Bezüge zwischen dem Film und seinem Einsatz von wissenschaftlich fundierten Erkenntnissen zum historischen Kontext herauszustellen. Mithilfe von zahlreichem Quellenmaterial und aktuellen Forschungsmeinungen soll herausgefunden werden, inwiefern Regisseur Christian Carion ein authentisches Bild des Weihnachtsfriedens von 1914 nachzeichnet.
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
8
Minuten die längste Verfilmung des historischen Ereignisses ist. Betrachtet man die Leistung
anderer Regisseure, welche in ihren Werken Bezug auf den Weihnachtsfrieden nahmen, so
fallen zwei Kurzfilme auf, die in ihrer Handlung mit ,,Merry Christmas" verglichen werden
können. Einerseits setzt sich Leanna Creel mit ,,Offside"
7
(2001) als eine der ersten
Regisseure mit dem Thema der Verbrüderungen im Ersten Weltkrieg auseinander. Der Fokus
in diesem Kurzfilm liegt auf der Inszenierung der Annäherung zwischen britischen und
deutschen Soldaten sowie die historische Überlieferung der Fußballspiele im Niemandsland.
Als möglicher Hinweis auf eine quellenorientierte Darstellung wird im Abspann das
Weihnachtslied ,,Silent Night" wiedergegeben, welches zu Weihnachten an der Front häufig
von Briten wie Deutschen gesungen wurde und in der historischen Überlieferung
nachgewiesen werden kann. Andererseits existiert neben ,,Offside" ein anderer
amerikanischer Kurzfilm mit dem Titel ,,The Truce"
8
(2001) von Eric Rolnick. Neben einer
weiteren Vorstellung des Waffenstillstands, erneut zwischen Briten und Deutschen, zeigt
dieses Werk nicht nur das Fußballspiel, sondern auch den gegenseitigen Austausch von
kleinen Geschenken wie Zigaretten und Schokolade sowie die Beendigung des Friedens und
die Wiederaufnahme der Kampfhandlungen.
Der Weihnachtsfrieden ist aber auch zum Bestandteil von anderen Verfilmungen und
Dokumentationen zum Ersten Weltkrieg avanciert. In der satirischen Inszenierung ,,Oh! What
a Lovely War"
9
(1969) von Richard Attenborough nach dem gleichnamigen britischen
Musical handeln circa sieben Minuten über die Verbrüderung zwischen britischen und
deutschen Soldaten. Die deutsche Dokumentation ,,Weltenbrand"
10
(2012) von Dr. Guido
Knopp gilt als aktuellster Rückgriff auf die Ereignisse zu den Fraternisationen. Auffällig in
dieser Darstellung ist die Verwendung der Filmmusik aus ,,Merry Christmas". In der Szene
zur Verbrüderung nutzt die Fernsehserie das Lied ,,I'm dreaming of home"
11
, was zur
Annahme führt, dass ,,Weltenbrand" aufgrund der relativ kurzen Inszenierung des
Weihnachtsfriedens Christian Carions Produktion als maßgeblichen Verweis für die
Darstellung anführt.
7
Creel, Leanna: Offside, R: Leanna Creel, Drehbuch: Leanna Creel, USA, 2001, 12min (Zugriffsdatum:
http://vimeo.com/31744014, 12.10.2014, 18:36).
8
Rolnick, Eric: The Truce, R: Eric Rolnick, Drehbuch: Eric Rolnick, USA 2001, 9min (Zugriffsdatum:
http://www.youtube.com/watch?v=m05-27UBQV4, 12.10.2014, 19:02).
9
Attenborough, Richard: Oh! What a Lovely War, R: Richard Attenborough, Drehbuch: Len Deighton, UK,
Paramount Pictures 1969, 144min.
10
Knopp, Dr. Guido: Weltenbrand, R: Dr. Guido Knopp, DE, Studio Hamburg Enterprises 2012, 135min.
11
Vgl.: Rombi, Philippe: Joyeux Noël. Bande Originale du Film. Chorale Scala London Symphony Orchestra.
Dessay, Natalie; Villazón, Rolando. Virgin Classics (094633827929) 2005.
9
Vergleicht man die filmischen Umsetzungen zum Weihnachtsfrieden untereinander, so
fällt stets die Aufmerksamkeit der Regisseure auf die Verbrüderung zwischen Briten und
Deutschen auf. ,,Merry Christmas" liefert mit seiner Handlung eine neue Perspektive in der
Beschäftigung mit dem Weihnachtsfrieden, da in diesem Film gezielt eine Verbrüderung
zwischen Briten/Schotten, Deutschen und auch Franzosen stattfindet. Weiterhin scheint das
Werk eine unkonventionelle Darstellung des historischen Kontextes gegenüber der
Forschungsliteratur zu verfolgen. Nicht nur der französischen Seite wird ein höherer
Stellenwert gegenüber den Fraternisationen zugeschrieben, sondern auch eine Frau Diane
Krüger in der Rolle von Anna Sörensen nimmt im Film am Weihnachtsfrieden teil.
Aufgrund dieser Inszenierung will die vorliegende Analyse herausfinden, ob ,,Merry
Christmas" eine quellen- und forschungsnahe Darstellung des Weihnachtsfriedens von 1914
leistet. Anhand von ausgewählten Untersuchungsschwerpunkten versucht die Bearbeitung,
wesentliche Bezüge zwischen dem Film und seinem Einsatz von wissenschaftlich fundierten
Erkenntnissen zum historischen Kontext herauszustellen. Dabei gliedert sich die Betrachtung
in mehrere Bereiche. Nach einer kurzen Einführung in die Handlung des Films soll anhand
ausgesuchter Filmszenen geprüft werden, ob der Handlungsschauplatz in ,,Merry Christmas"
verortet werden kann und inwiefern Ort sowie dessen historische Überlieferung zum
Weihnachtsfrieden übereinstimmt. Daraufhin widmet sich die Analyse der genaueren
Untersuchung einzelner Filmcharaktere und hinterfragt ihren Stellenwert hinsichtlich realer
historischer Akteure. In diesem Zusammenhang wird auch auf die Problematik der weiblichen
Protagonistin Anna Sörensen näher eingegangen, die als einziger fiktiver Charakter in
wichtigen Schlüsselszenen des Films auftritt. Anschließend konzentriert sich der
Untersuchungsschwerpunkt auf die konkrete Darstellung des Weihnachtsfriedens im Film,
wobei Filmmusik und Verwendung der Mehrsprachigkeit eingehend erläutert werden. Des
Weiteren dienen verschiedene Szenen, in denen charakteristische Handlungsmuster des
Weihnachtsfriedens dargestellt werden, zur Verdeutlichung der Untersuchung. So beschäftigt
sich die Analyse mit der in ,,Merry Christmas" gezeigten Messe im Niemandsland, dem
Fußballspiel zwischen Deutschen, Franzosen und Schotten sowie der Beendigung des
Waffenstillstands und vergleicht die genannten Szenen mit der Quellen- und
Forschungsliteratur. Die Schlussbetrachtung fasst die gesammelten Ergebnisse zusammen und
beurteilt, inwiefern Christian Carions Film einer wissenschaftlichen Darstellung des
Weihnachtsfriedens entspricht.
Innerhalb der historischen Forschung ist ebenfalls eine Entwicklung hin zur internationalen
Betrachtung des Weihnachtsfriedens zu erkennen. Besteht in den 1960er Jahren ein rein
10
regionales Interesse am historischen Ereignis, wie beispielsweise in der belgischen Stadt
Diksmuide, wo eine der vielen Verbrüderungen verortet werden konnte
12
, beginnt mit den
Untersuchungen von Malcolm Brown in den 1980er Jahren eine transnationale Perspektive.
13
In seiner Publikation ,,Christmas Truce" behandelt der britische Historiker die Beziehung
zwischen englischen und deutschen Soldaten während des Weihnachtsfriedens. Er verknüpft
zudem viele schriftliche Quellen aus privaten Tagebüchern, Briefen der realhistorischen
Akteure oder zeitgenössischen Zeitungen aus britischer und deutscher Sicht.
14
2005
veröffentlicht Michael Jürgs die erste umfassende deutsche Abhandlung
15
aus der Motivation
des 90-jähirgen Jubiläums des Weihnachtsfriedens heraus.
16
In der wissenschaftlichen
Diskussion Malcolm Brown gegenübergestellt
17
, liefert Jürgs Forschung neue
Forschungsansätze. Förderlich für eine transnationale Betrachtung der Verbrüderungen von
1914 sind diesbezüglich umfassende Quellenrecherchen, welche auch die französische
Perspektive zum Weihnachtsfrieden behandeln. Trotz der umfassenden Rekonstruktion und
Zitation historischer Dokumente, versäumt Jürgs jegliche Quellenkommentare sowie
Verweise seiner Recherchen mittels Fußnoten
18
, was eine Rückverfolgung der verwendeten
schriftlichen Überlieferungen immens erschwert.
Die vorliegende Analyse betreibt keine Aufarbeitung der Archivbestände zum
Weihnachtsfrieden, sondern bezieht sich im Wesentlichen auf zitierte und kritisch beurteilte
Quellen durch die zuvor erläuterte Forschungsliteratur. Besonders hilfreich gestalteten sich
Malcolm Browns und Michael Jürgs Untersuchungen, um wichtige Dokumentationen zur
Fraternisation herauszustellen und sie auf ,,Merry Christmas" anzuwenden. Aber auch die
französischsprachige Forschung führte zu vielen Erkenntnissen hinsichtlich der Bearbeitung
des Films, wobei Yves Buffetaut in diesem Zusammenhang hervorzuheben ist.
19
12
Einen umfassenden Überblick zur wissenschaftlichen Forschung bietet: Paletschek, Sylvia: Der
Weihnachtsfrieden 1914 und der Erste Weltkrieg als neuer (west-)europäischer Erinnerungsort Epilog, in:
Hochbruck, Wolfgang; Korte, Barbara; Paletschek, Sylvia (Hrsg.): Der Erste Weltkrieg in der populären
Erinnerungskultur, Essen 2008, S. 213f.
13
Paletschek, Der Weihnachtsfrieden 1914 und der Erste Weltkrieg, S. 214.
14
Brown, Malcolm: Christmas Truce. The Western Front, December 1914, Oxford 2001, S. xxiv.
15
Siehe hierzu: Jürgs, Michael: Merry Christmas. Der kleine Frieden im Großen Krieg. Westfront 1914: Als
Deutsche, Franzosen und Briten gemeinsam Weihnachten feierten, München 2005.
16
Paletschek, Der Weihnachtsfrieden 1914 und der Erste Weltkrieg, S. 215.
17
Vgl.: Kellerhoff, Sven F.: Bunte Bilder einer Katastrophe, in: Die Welt, 12.12.2003.
18
Pöhlmann, Markus: Rezension. Michael Jürgs: Der kleine Frieden im Großen Krieg. Westfront 1914: Als
Deutsche, Franzosen und Briten gemeinsam Weihnachten feierten, in: Benz, Wolfgang (Hrsg.): Zeitschrift für
Geschichtswissenschaft, Heft 3, Berlin 2005, S. 275.
19
Buffetaut, Yves: Batailles de Flandres et d'Artois 1914-1918, 1992.
11
2. Die Filmhandlung in ,,Merry Christmas"
Die Handlung um den Weihnachtsfrieden beginnt im besetzten Nordfrankreich an der
Westfront im Dezember 1914. Französische, schottische und deutsche Truppen liefern sich im
Stellungskrieg einen erbitterten Kampf, um die Linien des Feindes zu durchbrechen. Die
Hauptprotagonisten stehen sich in den drei nationalen Lagern gegenüber, zum einen Leutnant
Audebert und Ponchel, zum anderen Jonathan, William, der Geistliche Palmer und Leutnant
McKenzie und schließlich Nikolaus Sprink, Anna Sörensen, Kronprinz Wilhelm und
Oberleutnant Horstmayer. Während des Films stehen diese Charaktere im Vordergrund,
wobei ihre Handlungen, Erfahrungen und Gefühle zur Fraternisation vor, während und nach
dem Weihnachtsfest dem Zuschauer vermittelt werden. Nachdem Nikolaus Sprink mit Anna
Sörensen ein Konzert für den Kronprinzen absolviert, reist der deutsche Tenor mit seiner
Geliebten in der Nacht zu Heiligabend zum deutschen Schützengraben, um Weihnachtslieder
für seine Kameraden zu singen. Auch Franzosen und Schotten feiern zu diesem Zeitpunkt
Weihnachten in den eigenen Stellungen. Beeindruckt von der musikalischen Darbietung
vereinbaren die drei Befehlshaber eine Waffenruhe für diesen Abend. Schnell entwickelt sich
der kurze Waffenstillstand jedoch zu einer umfassenden Verbrüderung. Soldaten aus den
unterschiedlichen Bataillonen treffen im Niemandsland aufeinander, beschenken sich und
halten gemeinsam eine christliche Messe ab.
Die kurze Pause vom Krieg hält bis zum zweiten Weihnachtstag an. Nachdem die Truppen
zusammen die Toten im Niemandsland beerdigt und ein Fußballspiel veranstaltet haben,
werden die neu gewonnenen Freundschaften durch die Realität des Ersten Weltkriegs zerstört.
Die militärischen Führungsstäbe wollen die Fraternisation unter allen Umständen aufheben,
sodass der Film mit der Versetzung der französischen und deutschen Soldaten an einen
anderen Frontabschnitt, Verdun und Tannenberg, endet. Die Liebesgeschichte zwischen
Nikolaus Sprink und Anna Sörensen, welche mittlerweile vom deutschen Führungsstab wegen
plötzlichen Verschwindens aus dem Hauptquartier gesucht werden, erfährt eine dramatische
Entwicklung. Beide stellen sich nach Beendigung des Friedens Leutnant Audebert als
Kriegsgefangene, damit sie durch die Wiederaufnahme der Kampfhandlungen nicht mehr
getrennt werden.
12
3. Analyse des Films: Leistet ,,Merry Christmas" eine quellen- und forschungsnahe
Darstellung des Weihnachtsfriedens von 1914?
3.1 Verortung des Weihnachtsfriedens
In einem Gespräch zwischen Leutnant Audebert und Ponchel erfährt der Zuschauer, dass
Ponchel den Bauernhof hinter den deutschen Linien sehr gut kenne. Vor dem Krieg sei er
öfter mit dem Fahrrad von seiner Heimatstadt Lens aus dorthin gefahren, um Eier und Milch
zu kaufen. Entscheidend ist der Hinweis, dass nach seiner Erfahrung die Entfernung zwischen
Bauernhof und Lens eine Stunde Fußweg beanspruche.
20
Somit findet laut dieser Aussage die
Verbrüderung zwischen deutschen, französischen und schottischen Soldaten im Film in der
Nähe der nordfranzösischen Stadt Lens im Département Pas-de-Calais statt.
Der Weihnachtsfrieden von 1914 spielte sich während des Ersten Weltkriegs vor allem an
der Westfront ab.
21
Über Fraternisationen zwischen verfeindeten Soldaten an der Ostfront zu
Heiligabend berichten die Quellen nur wenig, jedoch war der Abschluss von
Waffenstillständen durchaus möglich wenn auch nur aus Kriegsmüdigkeit, wie zum
Beispiel in Galizien 1917.
22
Betrachtet man den Frontverlauf im Dezember 1914, so
durchzieht der Stellungskrieg Flandern in Belgien, verläuft über Nordfrankreich hinunter bis
nach Reims und Elsass-Lothringen.
23
In der Forschungsliteratur werden verschiedene
Stationen der Verbrüderungen an der Westfront genannt, wobei Flandern und der Nordosten
des Départements Pas-de-Calais stets den Hauptschauplatz des Weihnachtsfriedens
bestimmen.
Christian Bunnenberg konzentriert den Weihnachtsfrieden maßgeblich auf den belgischen
Kampfraum
24
, insbesondere im 30 km langen Abschnitt zwischen Diksmuide und dem
nordfranzösischen Armentières.
25
Zu nennen sind hier Stationen wie Ploegsteert, Messines
und St. Yvon.
26
Sylvia Paletschek merkt zudem an, dass Belgien der bevorzugte
Kriegsschauplatz für die Fraternisation zwischen Deutschen auf der einen, als auch Briten und
20
Carion, Merry Christmas, TC: 00:27:45-00:29:15.
21
Jahr, Christoph: Weihnachten 1914, in: Hirschfeld, Gerhard; Krumeich, Gerd; Renz, Irina (Hrsg.):
Enzyklopädie Erster Weltkrieg, Paderborn 2009, S. 957f.
22
Prinz Ernst Heinrich von Sachsen: Mein Lebensweg vom Königsschloß zum Bauernhof, Frankfurt am Main
1979, S. 79.
23
Siehe auch: Brown, Malcolm; Cazals, Rémy; Ferro, Marc; Mueller, Olaf (Hrsg.): Frères de tranchées, Paris
2006, S. 6.
24
Bunnenberg, Christian: Christmas Truce. Die Amateurfotos vom Weihnachtsfrieden 1914 und ihre Karriere,
in: Paul, Gerhard (Hrsg.): Jahrhundert der Bilder, Bd. 1, Göttingen 2009, S. 160.
25
Ders., Dezember 1914: Stille Nacht im Schützengraben Die Erinnerung an die Weihnachtsfrieden in
Flandern, in: Arand, Tobias (Hrsg.): Die ,,Urkatastrophe" als Erinnerung Geschichtskultur des Ersten
Weltkriegs, Münster 2006, S. 19.
26
Jürgs, Der kleine Frieden im Großen Krieg, S. 100.
13
Franzosen auf der anderen Seite war.
27
Die Westfront 1914 im Bereich Flandern und
Nordfrankreich charakterisiert sich durch ihre Aufteilung der Operationsgebiete durch die vier
beteiligten Armeen: Der deutschen Armee steht gegenüber die belgische Armee im
Nordwesten Flanderns bei Diksmuide, die ,,British Expeditionary Force" zwischen Ypern und
La Bassée und die französische Armee ab La Bassée und Lens.
28
Die in ,,Merry Christmas" von Ponchel genannte nordfranzösische Stadt Lens schien auch
in der Realität des Ersten Weltkriegs als Verlaufspunkt von drei unterschiedlichen Armeen
gedient zu haben. In seinen Forschungen über den Weihnachtsfrieden beschäftigt sich
Malcolm Brown mit dem britischen Frontabschnitt zwischen Ypern und La Bassée, wobei er
durch intensive Sondierung der Quellen einzelne Szenen der Verbrüderung zwischen
britischen und deutschen Soldaten lokalisiert.
29
La Bassée bildete den südlichsten Abschnitt
der britischen Armee, welche ungefähr 18 km von Lens entfernt liegt. Brown weist zwar auf
Kampfhandlungen nahe Lens hin
30
, jedoch zeigt seine verwendete Karte die Stadt nicht mehr
auf, da sie nicht zum hauptsächlichen Operationsgebiet des britischen Expeditionskorps
gehört. Lens unterstand dem französischem Frontabschnitt, welche somit in unmittelbarer
Nachbarschaft zum britischen Verbündeten gegen die Deutschen agierte.
31
Dieselbe Konstellation von Akteuren äußert sich auch im Film. Da La Bassée
beziehungsweise Lens der Verlaufspunkt zwischen britischer und französischer Front ist,
orientiert sich ,,Merry Christmas" durchaus an der Forschungsliteratur bezüglich der
Verortung der Filmszenerie mit ihrer Kampfhandlung und den dort beteiligten Armeen. Die
Nachbarschaft zu den Franzosen dokumentiert sich auch in manchen Tagebucheinträgen von
britischen Soldaten: ,,Towards evening it got heavy firing, the French are too mad. The
flashes from their guns can be seen, they don't take enough cover and they draw the fire."
32
Darüber hinaus liefert die Forschung zum Weihnachtsfrieden auch Angaben über einen
umkämpften Bauernhof um Heiligabend 1914. Der eingangs genannte Bauernhof, Ponchels
zweite Heimat neben Lens und konkreter Kriegsschauplatz im Film, ist laut britischen
Quellen Ziel einer militärischen Operation gegen die deutschen Stellungen: ,,Orders came
27
Paletschek, Der Weihnachtsfrieden 1914 und der Erste Weltkrieg, S. 213.
28
Siehe auch: Brown, Malcolm; Cazals, Rémy; Ferro, Marc; Mueller, Olaf (Hrsg.): Frères de tranchées, Paris
2006, S. 6.
29
Siehe auch: Brown, Christmas Truce, S. xx
30
Zitiert nach: Ebd., S. 17.
31
Siehe auch: Brown, Malcolm; Cazals, Rémy; Ferro, Marc; Mueller, Olaf (Hrsg.): Frères de tranchées, Paris
2006, S. 6.
32
Zitiert nach: Ders., Meeting in No Man's Land: Christmas 1914 and Fraternisation in the Great War, London
2007, S. 47.
14
through to our Brigade, and so to my battery, that fire was to be opened the following
morning on a certain farm which stood behind the German support line."
33
Allerdings löst die Quellen- und Forschungslage nicht die Frage, ob nahe Lens auch
wirklich zu Weihnachten 1914 Verbrüderungen zwischen Deutschen, Franzosen und Schotten
stattgefunden haben. Zwar tangiert Brown in seinen Untersuchungen kurz die Situation der
französischen Stadt im Krieg, doch explizite Quellen von Soldaten, die an einer Fraternisation
in Lens teilgenommen hätten, sind bisher unentdeckt.
3.2 Historische Persönlichkeiten im Film
3.2.1 Protagonisten nach historischen Vorbildern
Auffällig bei der Charakteraufstellung von ,,Merry Christmas" ist, dass Regisseur Carion
hauptsächlich fiktionale Namen für die Protagonisten des Films auswählt. Gegenüber der
Fiktionalität der Namen steht allerdings die Orientierung an wichtigen historischen
Vorbildern, welche als Akteure am Weihnachtsfrieden 1914 beteiligt gewesen waren und die
Filmcharaktere inspiriert haben. Im Folgenden soll anhand der Quellen- und
Forschungsliteratur herausgefunden werden, für welche Protagonisten in ,,Merry Christmas"
welche historische Vorlage verwendet wurde, um den Film als quellen- und
forschungsorientiert bewerten zu können.
Die erste Hauptfigur tritt gleich nach der Ouvertüre des Werks auf und verkörpert sich im
schottischen Geistlichen Palmer, der zu Beginn des Ersten Weltkriegs in seiner Gemeinde als
Priester tätig ist.
34
Nach Kriegsausbruch meldet sich Palmer für den Sanitätsdienst an der
Front und findet sich am Frontabschnitt, wo die Verbrüderung im Laufe des Films stattfinden
wird, wieder. Zum einen in der Rolle als Sanitäter, spendet er zum anderen in seiner früheren
Funktion als Priester geistlichen Beistand für die erschöpften Soldaten, insbesondere für
seinen ehemaligen Schüler Jonathan, dessen Bruder William während eines Gefechts fällt.
35
Seinen wohl wichtigsten Auftritt hat Palmer während der Verbrüderung zu Heiligabend, wo er
selbst Dudelsack spielt und durch die Musik die Fraternisation zusammen mit Nikolaus
Sprink initiiert.
36
Die Hauptfigur sieht sich von da an nicht mehr dem Sanitätsdienst
verpflichtet, sondern führt ihre geistliche Arbeit als Priester nun primär aus. Dies äußert sich
33
Wakefield, Alan: Christmas in the trenches, Gloucestershire 2006, S. 14.
34
Carion, Merry Christmas, TC: 0:03:55-0:05:26.
35
Ebd., TC: 0:12:36-0:14:00.
36
Ebd., TC: 0:41:09-0:48:46.
15
dadurch, dass der Geistliche eine Messe mit den fraternisierenden Soldaten im Niemandsland
abhält
37
und am ersten Weihnachtstag die Bestattung der Toten leitet.
38
Der schottische Priester Palmer findet sein historisches Vorbild in Kaplan J. Esslemont
Adams, der dem schottischen Bataillon der 6
th
Gordon Highlanders angehörte.
39
Im offiziellen
Kriegstagebuch dieses Bataillons wird von einer gemeinsamen Gedenkfeier zwischen
schottischen und deutschen Soldaten unter dem Geleit Kaplan Adams berichtet. Person und
Ereignis stimmen mit der Konzeption in ,,Merry Christmas" bezüglich des Charakters und der
Filmhandlungen von Palmer in wesentlichen Punkten überein: Die schottische Abstammung
und das Wirken in einem schottischen Bataillon, die Gestaltung einer Messe für sich
verbrüdernde Soldaten zu Weihnachten sowie das Spenden von geistlichem Beistand während
der Bestattung der Toten im Niemandsland. Diese vergleichbaren Eigenschaften liefern
prägnante Hinweise für die historische Vorlage des Palmer in Kaplan J. Esslemont Adams
laut der Quellen- und Forschungslage.
Auf der französischen Seite richtet sich weniger die Person, sondern mehr der Beruf an ein
historisches Vorbild. Der Soldat Ponchel tritt in Filmminute 0:08:45 das erste Mal auf und
nimmt an einer Attacke gegen die deutschen Stellungen teil. Später offenbart sich dem
Zuschauer, dass Ponchel Adjutant des französischen Leutnants Audebert ist.
40
Neben ihrer
Rolle als Adjutant weist diese Figur in ,,Merry Christmas" allerdings eine Besonderheit auf.
Im ganzen Film ist Ponchel der einzige Protagonist, welcher seinen Beruf, den er vor dem
Krieg ausgeübt hatte, an der Front weiter praktiziert. In einer Szene sieht man ihn die Haare
von Audebert schneiden, wobei sich Ponchel selbst als bester Friseur in ganz Lens
bezeichnet.
41
Während der Verbrüderungen war der Beruf des Friseurs an der Front häufig vertreten und
diente an manchen Abschnitten zu Weihnachten als Katalysator für die brüderliche
Annäherung der verfeindeten Soldaten. Prinz Ernst Heinrich von Sachsen betont in seinen
Erinnerungen die harmonische Atmosphäre, hervorgerufen durch die Interaktion zwischen
einem deutschen Offizier und einem britischen Friseur:
,,Am Weihnachtsfest besuchten sich die Sachsen und Engländer in ihren
beiderseitigen Stellungen und beschenkten sich. Ein mir bekannter Offizier ließ
sich sogar jeden zweiten Tag bei den Engländern rasieren. Diese Idylle, die sich
37
Carion, Merry Christmas, TC: 0:57:00-1:03:10.
38
Ebd., TC: 1:10:40-1:13:14.
39
Jürgs, Der kleine Frieden im Großen Krieg, S. 143.
40
Carion, Merry Christmas, TC: 0:18:25-0:19:00.
41
Ebd., TC: 0:27:34-0:27:48.
16
auf einen Abschnitt von zwei Regimentern erstreckte, dauerte drei Wochen
lang."
42
Die Chance zur Fraternisation scheint auch insofern durch Friseure gefördert worden zu
sein, da viele deutsche Soldaten vor dem Krieg in Großbritannien lebten und eben diesen
Beruf verrichteten. Viele ehemalige britische Kunden der deutsch-englischen Friseure standen
sich Weihnachten 1914 mit diesen im Feld gegenüber. Ereignete sich die Verbrüderung, so
erkannten viele britische Soldaten ihre bekannten deutschen Haarschneider, weshalb direkt
eine freiwillige Nähe durch persönliches Kennen aus derselben Heimat aufgebaut werden
konnte.
43
Das Leben aus dem Vorkriegsstadium wurde alsbald auf die Situation an der Front
übertragen, indem deutsche wie englische Friseure zum Weihnachtsfest gegen Lohn, meist
bestehend aus Zigaretten, die Haare ihrer neu gewonnenen Kameraden schnitten.
44
Daher
bietet die Figur des Ponchel einen historischen Bezug zu den beteiligten Akteuren in Form der
einfachen Soldaten, die mit ihrem Beruf als Friseur einen wesentlichen Beitrag zur
freundschaftlichen Zusammenkunft zwischen den verfeindeten Soldaten leisteten. Jedoch
interagiert Ponchel in seiner Rolle als Friseur nur mit Leutnant Audebert und nicht mit dem
verbrüderten Feind im Film. Die Darstellung des Berufs gilt aber durchaus als Beweis für eine
intensivere Recherche, welche Berufsgruppen an den Fraternisationen 1914 teilnahmen.
Welche historischen Akteure können für die deutschsprachige Seite ermittelt werden? Zum
einen für Oberleutnant Horstmayer, dem Befehlshaber des Anhaltischen Infanterie-Regiments
Nr. 93. In der offiziellen Chronik des Regiments ist der Name unter der militärischen
Organisationsleitung nicht verzeichnet
45
, allerdings lässt sich die Figur im Film mit einer
historischen Person, die aktiv am Weihnachtsfrieden teilgenommen hat, vergleichen. Nach der
musikalischen Darbietung von Nikolaus Sprink, treffen sich die drei Befehlshaber ihres
jeweiligen Landes im Niemandsland, um einen Waffenstillstand zu vereinbaren. Als
Kommunikationssprache wird Englisch eingeführt, welche Horstmayer selbst sehr gut
beherrscht. Dies wird besonders in der Konversation zwischen ihm und Audebert deutlich.
Allerdings verbleibt der deutsche Leutnant nicht bei der englischen Sprache, sondern
erleichtert das Gespräch für Audebert dadurch, dass er spontan auf Französisch spricht.
46
Somit beherrscht Horstmayer alle drei Sprachen der an der Verbrüderung beteiligten
Nationen. Leutnant Kurt Zehmisch aus der 11. Kompanie des 134. Königlich-Sächsischen
42
Prinz Ernst Heinrich von Sachsen, Mein Lebensweg, S. 77.
43
Jürgs, Der kleine Frieden im Großen Krieg, S. 73.
44
Ebd., S. 99.
45
Vgl.: Falkenstein, Hans Trüßschler von (Hrsg.): Das Anhaltische Infanterie-Regiment Nr. 93 im Weltkriege.
Erster Teil, Berlin 1929, S. 121-129.
46
Carion, Merry Christmas, TC: 0:54:50-0:55:40.
17
Infanterieregiments könnte laut der Forschung das historische Beispiel für Horstmayer sein.
In der Nähe von St. Yvon in Flandern stationiert, fraternisierten Zehmisch und seine
sächsische Einheit mit den 1
st
Royal Warwickshires. Seine guten Englischkenntnisse halfen
ihm, zusammen mit einem Soldaten aus seiner Kompanie den Briten aus den deutschen
Stellungen heraus zuzurufen und sie in eine Unterhaltung zu verwickeln, die letztlich zu einer
Verbrüderung führte. Neben Englisch, konnte Kurt Zehmisch ebenfalls Französisch, was die
Kommunikation mit dem Feind häufig erleichterte und das gegenseitige Vertrauen förderte.
47
Zum anderen ist der deutsche Soldat Nikolaus Sprink, vor dem Krieg Tenor an der Berliner
Oper, als vielleicht wichtigste Figur der Handlung von ,,Merry Christmas" zu nennen. Sprink
wirkt als einer der Initiatoren der Verbrüderung, denn durch seine Entscheidung, ,,Stille
Nacht, Heilige Nacht" für die Kameraden an der Front zu singen, entwickelt sich das
musikalische Zusammenspiel aus Palmer und ihm, was die Fraternisation im Film erst
ermöglicht.
48
Das historische Vorbild für Sprink ist in diesem Fall Walter Kirchhoff, der seit
1906 ebenfalls Tenor an der Berliner Oper
49
und für seine Auftritte in Operetten nach Richard
Wagner bekannt gewesen war.
50
Den Quellen entsprechend, singt auch die Filmfigur zu
Heiligabend den deutschen Soldaten Weihnachtslieder vor, was Kronprinz Wilhelm
persönlich in seinen Memoiren verfasste: ,,Der Kammersänger Kirchhoff, der eine Zeitlang
im Stabe des Oberkommandos als Ordonnanzoffizier kommandiert war, hat am selbigen
heiligen Abend im vorderen Graben des Regiments 130 seine Weihnachtslieder gesungen."
51
Der Charakter Sprink stimmt in wesentlichen Eigenschaften mit denen des historischen
Kirchhoff überein. Im Film zwar nur einfacher Soldat und kein Ordonnanzoffizier, stellt sich
die Figur zu Beginn an als Künstler und Sänger dar, was durch den Kriegsausbruch vorerst
beendet wird.
52
Auch die Interaktion zwischen Sprink und dem Kronprinz, welcher für diesen
einen Liederabend in dessen Hauptquartier aufführt
53
, zeigt den historischen Bezug zwischen
beiden Personen, die laut der Erinnerungen des Kronprinzen kooperierten. Inwiefern jedoch
die Teilhabe Kirchhoffs beziehungsweise die Filmfigur Sprinks mit seiner Musik an der
Verbrüderung 1914 der Quellen- und Forschungsliteratur entspricht, wird im weiteren Verlauf
der Analyse näher behandelt.
47
Jürgs, Der kleine Frieden im Großen Krieg, S. 82-84.
48
Carion, Merry Christmas, TC: 0:44:00-0:48:46.
49
Weintraub, Stanley: Silent Night. The remarkable Christmas Truce of 1914, London 2001, S. 35.
50
http://93.81.250.215/BLOG/_German%20Singers/kirchho/kirch.htm, 12.10.2014, 17:30.
51
Kronprinz Wilhelm, Meine Erinnerungen an Deutschlands Heldenkampf, Berlin 1923, S. 115.
52
Carion, Merry Christmas, TC: 0:05:25-0:07:36.
53
Ebd., TC: 0:34:00-0:38:00.
18
3.2.2 Darstellung von realhistorischen Personen
Neben den Protagonisten, welche anhand von historischen Vorbildern geschaffen wurden, ist
Kronprinz Wilhelm die einzige realhistorische Persönlichkeit in ,,Merry Christmas". Zweimal
tritt der Kronprinz im Film auf, wobei die Handlung im Hauptquartier sich maßgeblich an den
historischen Quellen orientiert. Zum Weihnachtsfest organisiert der Befehlsstab des
Kronprinzen im Hauptquartier eine große Feier, zu welcher die dänische Sopranistin Anna
Sörensen mit Nikolaus Sprink zusammen einen Liederabend veranstalten soll. Der Zuschauer
erfährt nicht, wo das Hauptquartier genau lokalisiert ist, doch liefert eine kurze Szene den
entscheidenden Hinweis: Auf der Suche nach Sprink entdeckt Anna, dass in der
Befehlszentrale des Kronprinzen ein altes französisches Ehepaar wohnt, das von den
deutschen Besatzern die Erlaubnis bekam, weiter in ihrem Anwesen leben zu dürfen.
54
Kronprinz Wilhelm bezog von September 1914 bis Februar 1918 das Château des Tilleuls im
französischen Stenay nahe Sedan und richtete dort sein Hauptquartier ein. Ursprünglich als
Kommandeur für die 1. Garde-Infanterie-Division vorgesehen
55
übernahm der Kronprinz den
Oberbefehl über die 5. Deutsche Armee wegen eines krankheitsbedingten Ausfalls des
zuständigen Generalobersts von Eichhorn.
56
Das französische Schloss in Stenay gehörte zum
Zeitpunkt der Besatzung der Familie Vernier, wobei Madame du Vernier die damalige
Besitzerin des Anwesens war.
57
Die rechtmäßige Schlossherrin durfte auch über den Zeitraum
der deutschen Inbesitznahme im Château des Tilleuls wohnen, sodass Anna Sörensen
durchaus mit der Familie Vernier als historisches Vorbild für die Szene in Kontakt kommt.
Dementsprechend richtet sich die filmische Darstellung des Hauptquartiers sehr nah an die
Quellen- und Forschungsliteratur zur Befehlszentrale des Kronprinzen.
Allerdings lässt sich die weitere Inszenierung Wilhelms nur schwerlich mit den gegebenen
historischen Überlieferungen vergleichen. Es fand kein Liederabend für ihn statt, ob Walter
Kirchhoff wirklich für seine Majestät gesungen hat, ist nur indirekt aus den Erinnerungen des
Kronprinzen abzulesen. Tenor und Prinz haben sich nach dessen Angaben nur am ersten
Weihnachtstag getroffen, wo Kirchhoff ihm über Heiligabend und dem gesanglichen Auftritt
in den Schützengräben erzählt.
58
Wilhelm selbst befand sich nach eigenen Angaben am
Weihnachtsabend nicht primär im Hauptquartier, sondern 45 km südwestlich von Stenay
entfernt, nämlich in den Argonnen:
54
Carion, Merry Christmas, TC: 0:30:07-0:31:23.
55
Jonas, Klaus W.: Der Kronprinz Wilhelm, Frankfurt am Main 1962, S. 125.
56
Herre, Paul: Kronprinz Wilhelm. Seine Rolle in der deutschen Politik, München 1954, S. 52.
57
Klekowski, Ed; Klekowski, Libby: Eyewitnesses to the Great War.
American Writers, Reporters, Volunteers
and Soldiers in France, 1914-1918, Jefferson/N.C. 2012, S. 47.
58
Vgl.: Kronprinz Wilhelm, Meine Erinnerungen an Deutschlands Heldenkampf, S. 115.
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Erstausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2014
- ISBN (Paperback)
- 9783959930048
- ISBN (PDF)
- 9783959935043
- Dateigröße
- 843 KB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf – Institut für Geschichtswissenschaften II - Neuere Geschichte
- Erscheinungsdatum
- 2015 (Dezember)
- Note
- 1,0
- Schlagworte
- Erster Weltkrieg Erinnerungskultur Erster Weltkrieg im Film
- Produktsicherheit
- BACHELOR + MASTER Publishing