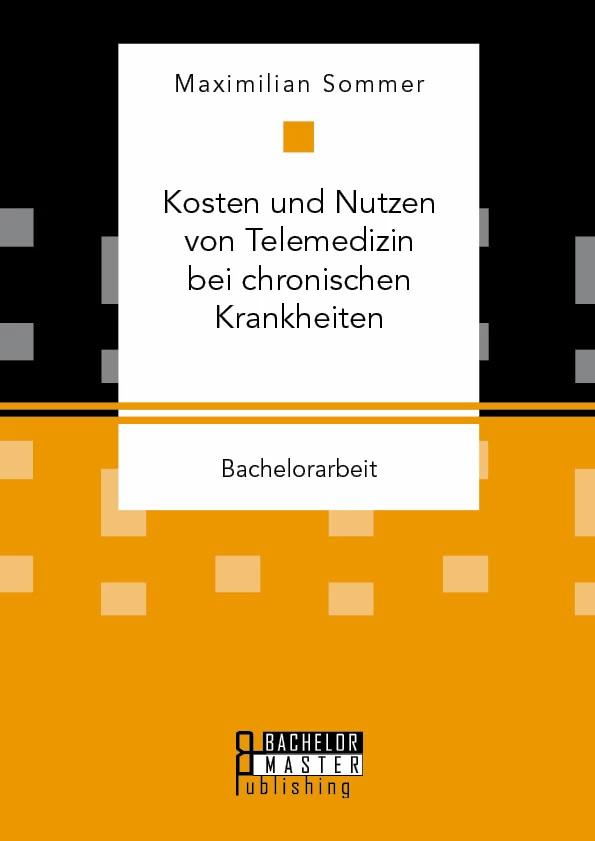Kosten und Nutzen von Telemedizin bei chronischen Krankheiten
©2014
Bachelorarbeit
58 Seiten
Zusammenfassung
Der demographische und soziokulturelle Wandel, der steigende Ärztemangel und die Ausbreitung chronischer Krankheiten gefährden das deutsche Gesundheitssystem. Darüber hinaus lässt der medizinische und technologische Fortschritt in Zusammenhang mit einer niedrigen Geburtenrate die Bevölkerung altern. Daraus resultiert eine erhöhte Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen, die zu erhöhten Gesundheitsausgaben führt. Das gleichzeitige Sinken des Einkommensniveaus ist die Folge eines steigenden Anteils an Nicht-Erwerbstätigen und einer Abnahme der Erwerbstätigen. Der Telemedizin wird eine Schlüsselrolle in der Überwindung des demographischen Wandels und der Reformierung des Gesundheitssystems zugesprochen.
Um das Thema „Kosten und Nutzen von Telemedizin bei chronischen Krankheiten“ adäquat darzustellen, werden im ersten Schritt die Begrifflichkeiten der Telemedizin eingegrenzt. Daraufhin erfolgen die Definition der „Telemedizin“ und die Darstellung der telemedizinischen Anwendungsarten. Die Begriffe des „Nutzens“ und der „Kosten“ werden hinsichtlich der Instrumente der Kosten-Nutzen-Analysen der gesundheitsökonomischen Evaluation erläutert. In Kapitel 5 werden die zentralen Kosten-Nutzen-Analysen der Telemedizin an den Beispielen der chronischen Herzinsuffizienz (CHI) und der chronisch obstruktiven Lungenerkrankung (COPD) veranschaulicht.
Um das Thema „Kosten und Nutzen von Telemedizin bei chronischen Krankheiten“ adäquat darzustellen, werden im ersten Schritt die Begrifflichkeiten der Telemedizin eingegrenzt. Daraufhin erfolgen die Definition der „Telemedizin“ und die Darstellung der telemedizinischen Anwendungsarten. Die Begriffe des „Nutzens“ und der „Kosten“ werden hinsichtlich der Instrumente der Kosten-Nutzen-Analysen der gesundheitsökonomischen Evaluation erläutert. In Kapitel 5 werden die zentralen Kosten-Nutzen-Analysen der Telemedizin an den Beispielen der chronischen Herzinsuffizienz (CHI) und der chronisch obstruktiven Lungenerkrankung (COPD) veranschaulicht.
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Systematik gesundheitsökonomischer Evaluationen ... 9
Abbildung 2: Inhalte des Cochrane Review ... 15
Abbildung 3: Kostenersparnisse durch die Telemedizin ... 16
Abbildung 4: Ergebnisse des Telemonitoring bei der COPD ... 18
Abbildung 5: Charakteristika der nationalen Studienlage bei der CHI... 19
Abbildung 6: Studienergebnisse TIM-HF I ... 20
Abbildung 7: Medizinische Effekte und Ergebnisse des Telemonitoring ... 23
Abbildung 8: Ergebniss des Projektes ,,Zertiva``... 24
Abbildung 9: Gesamt- und effektivitäts-adjustierte Kosten ... 24
Abbildung 10: Ergebnisse ausgewählter Studien des Cochrane Review ... 27
Abbildung 11: Klinische Effekte bei der chronischen Herzinsuffizienz ... 29
Abbildung 12: Arten und Formeln der gesundheitsökonomischen Evaluation ... 42
Abbildung 13: Komponenten einer gesundheitsökonomischen Evaluation ... 42
Abbildung 14: Arbeits-und Ausstattungskosten der Telemedizin ... 42
Abbildung 15: Darstellung TIM-HF Studie ... 43
Abbildung 16: Ein- und Ausschlusskriterien TIM-HF I ... 43
Abbildung 17: Darstellung Kosten INH-Studie ... 44
Abbildung 18: Charakteristika TIM-HF II ... 44
Abbildung 19: Vergleich TIM-HF I und TIM-HF II ... 45
IV
Zusammenfassung / Abstract
Einleitung: Der demographische und soziokulturelle Wandel, der steigende
Ärztemangel und die Ausbreitung chronischer Krankheiten gefährden das deutsche
Gesundheitssystem. Darüber hinaus lässt der medizinische und technologische
Fortschritt in Zusammenhang mit einer niedrigen Geburtenrate die Bevölkerung altern.
Daraus resultiert eine erhöhte Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen, die zu
erhöhten Gesundheitsausgaben führt. Das gleichzeitige Sinken des Einkommensniveaus
ist die Folge eines steigenden Anteils an Nicht-Erwerbstätigen und einer Abnahme der
Erwerbstätigen. Der Telemedizin wird eine Schlüsselrolle in der Überwindung des
demographischen Wandels und der Reformierung des Gesundheitssystems
zugesprochen.
Methodik: Um das Thema ,,Kosten und Nutzen von Telemedizin bei chronischen
Krankheiten" adäquat darzustellen, werden im ersten Schritt die Begrifflichkeiten der
Telemedizin eingegrenzt. Daraufhin erfolgen die Definition der ,,Telemedizin" und die
Darstellung der telemedizinischen Anwendungsarten. Die Begriffe des ,,Nutzens" und
der ,,Kosten" werden hinsichtlich der Instrumente der Kosten-Nutzen-Analysen der
gesundheitsökonomischen Evaluation erläutert. In Kapitel 5 werden die zentralen
Kosten-Nutzen-Analysen der Telemedizin an den Beispielen der chronischen
Herzinsuffizienz (CHI) und der chronisch obstruktiven Lungenerkrankung (COPD)
veranschaulicht. Bei der COPD umfasst die Darstellung der Forschungslage die Studien
des Cochrane-Review, die Silver Chain Studie und zwei Studien von Paré et al. Bei der
CHI liegt der Fokus auf den nationalen Studien von Köhler (TIM-HF), Kielblock,
Angermann, Neumann, Heinen-Kammerer und der MOBITEL Studie. Diese Arbeiten
werden gegenübergestellt und verglichen. Die Literaturrecherche erfolgte mithilfe der
Funktionalitäten der Universitätsbibliothek der Ludwig-Maximilians-Universität
München (OPAC, Elektronische Zeitschriftenbibliothek, Datenbank-Infosystem) und
insbesondere mithilfe der medizinischen Datenbank PubMed.
Ergebnis: Die untersuchten Studien zu den telemedizinischen Effekten bei der COPD
und der CHI weisen unterschiedliche Studienziele auf. Des Weiteren unterscheidet sich
der Aufbau der Studien in der Teilnehmerzahl, der Art der telemedizinischen
Anwendung und der Durchführungsdauer der Studien. Die Teilnehmerzahlen der
dargestellten Studien des Cochrane Review von Vitacca, Bourbeau, de Toledo und
Casas sind in einer Bandbreite von 155 bis 240 Teilnehmern anzusiedeln. In den
einzelnen Studien ist eine Reduzierung der Krankenhausaufenthalte, der
Hausarztbesuche, der Notaufnahmen sowie der Mortalität zu beobachten. Darüber
V
hinaus ist eine Steigerung der Lebensqualität zu vermerken. Die klinischen Effekte
bewirken eine Verbesserung der Kosteneffektivität bzw. eine Kosteneinsparung
aufgrund der verminderten Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen. Abgesehen
von der Anzahl der Hausarztbesuche erzielt die Silver Chain Studie, ebenfalls eine
Reduzierung der benötigten Gesundheitsleistungen infolge einer telemedizinischen
Anwendung. Bei dieser Studie beläuft sich die Quantifizierung der jährlichen Pro-Kopf-
Einsparungen der Telemedizin auf 2.931 USD. Eine ähnliche Vorgehensweise ist bei
zwei untersuchten Studien von Paré zu beobachten, die eine Kosteneinsparung von 710
USD bzw. 1.613 USD eruieren. Eine der meist zitierten Studien bei der CHI ist die
TIM-HF Studie von Köhler. Allerdings erzielt diese keine signifikanten positiven
Effekte bei den primären bzw. sekundären Endpunkten der Mortalität sowie der Dauer
der Krankenhausaufenthalte und Notaufnahmen. Bei Neumann beläuft sich der Betrag
der Kosten-Effektivitätsanalyse auf 10.582 pro verhindertem Todesfall. Das Ergebnis
der Kosten-Nutzwert-Analyse ist ein Geldbetrag von 31.685 pro gewonnenem QALY.
Das Zertiva-Projekt, dargestellt von Heinen-Kammerer, eruiert eine Einsparung der
effektivitäts-adjustierten Kosten in der Telemedizingruppe von 3.332 . Ähnliche
Ergebnisse erzielt die MOBITEL-Studie von Scherr. Diese umfasst 174 Patienten und
erzielt eine Reduktion der Krankenhausaufenthaltsdauer, der Mortalität und der
Hospitalisierung.
Fazit: Die vorliegende Arbeit zeigt, dass in der Mehrheit der dargestellten Studien sich
die Telemedizin gegenüber den Standardtherapien als vorteilhafter erweist. Dies äußert
sich insbesondere in einer Reduzierung der klinischen Parameter. Dabei sind die Anzahl
der Krankenhausaufenthalte, die Dauer der Aufenthalte, die Mortalität und die
Notaufnahmen zu nennen. Damit einhergehend erfolgt eine Kosteneinsparung aufgrund
einer verminderten Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen. Der Grund für die
fehlende Evidenz liegt in der geringen Verwendung der Elemente der
gesundheitsökonomischen Evaluation. Darüber hinaus ist die Gegenüberstellung der
Studien und damit einhergehend der Kosten-Nutzen-Vorteilhaftigkeit der Telemedizin
aufgrund der starken Variationen der Studienaufbauten äußerst diffizil. Der geforderte
Nachweis des Nutzens, der medizinischen Notwendigkeit und Wirtschaftlichkeit des
Sozialgesetzbuches kann somit nicht zweifelsfrei belegt werden. In naher Zukunft muss
die Priorität auf der Durchführung weiterer Studien liegen, die den Anforderungen an
eine gesundheitsökonomische Evaluation gerecht werden.
VI
Introduction: The demographic and socio-cultural change combined with the
progressive shortage of physicians and the increase in chronic diseases constitutes a
severe problem for the German health system. Moreover, the advent of modern medical
technologies and the discovery of novel tools and drugs for treating human infections
and diseases result in an increased life expectancy. As a consequence of this
development, the demand for health services along with the associated costs is on the
rise. On the other hand, the current birth rate in the western world remains low.
Therefore, the percentage decreases of the labor force with respect to the whole
population and an increasing number unemployed workers lead to a lower level of
revenue. The telemedicine is attributed a key role in overcoming the demographic
change and in reforming the health system.
Methodology: At first, the operation of the theme "costs and benefits of telemedicine in
chronic diseases" limits the concepts of telemedicine investigating in the present thesis.
In addition to the definition of the term "telemedicine" and the representation of the
types of applications the terms "benefit" and "cost" are detailed with respect to the
instruments of the cost-benefit analysis of the health economic evaluation. In the results
section the central cost-benefit analysis of telemedicine is illustrated by examples of
both chronic heart failure (CHF) and chronic obstructive pulmonary disease (COPD).
For the latter part studies of the Cochrane review, the Silver Chain study and two
studies of Paré are included in the discussion. Concerning heart failure, the focus lies on
national studies by Köhler (TIM-HF), Kielblock, Neumann, Heinen-Kammerer and the
MOBITEL study. Based on these reports, the study results are compared and evaluated.
The required literature research was performed utilizing the functionalities of the
University Library of the University of Munich (OPAC, Elektronische
Zeitschriftenbibliothek, Datenbank-Infosystem) and particularly the medical database
PubMed. The Ponzi scheme extends the literature base and refines the containment. The
requirement of the study design is to conduct a randomized controlled trial, as well as
national and international events.
Results: The study results of telemedical applications in COPD and CHF are based on
different study objectives. Furthermore, the design of the studies differs in the number
of participants, the type of telemedical application and the duration of study conduct.
The number of participants of the studies reported the Cochrane review of Vitacca,
Bourbeau, Casas de Toledo ranges from 155 to 240 participants. In these individual
studies a reduction of hospitalization, the medical rounds, the mortality and the
emergency rooms visits were observed when applying telemedicine. Beneficially, the
VII
patients also experienced a better quality of life. Overall, these factors reduced the use
of health services and thus resulted in a better cost-effectiveness ratio or lowered the
treatment costs. In agreement with the Cochrane Review, the Silver Chain study also
reported, with exception of the number of medical rounds, a reduction in the use of
health services as a result of a telemedicine application. The quantification of the annual
per capita savings of telemedicine in this study amounts to USD 2,931. A similar
approach in two studies reviewed by Paré results in a cost savings of USD 710 or USD
1,613. Regarding the profitability of telemedicine in CHF, one of the most cited studies
is the TIM-HF by Köhler. However, this study revealed no significant positive effects
concerning the primary endpoints of mortality and the secondary endpoints of the length
of hospital stays and emergency room visits. In contrast, the Neumann´s work showed
that the use of telemedicine amounts in the cost-effectiveness analysis to 10,582 per
impeded death. The result of the cost-utility analysis is a QALY gained of 31,685.
The Zertiva project presented by Heinen-Kammerer elicited a reduction of the adjusted
cost-effectiveness in the telemedicine group of 3,332. Similar results were obtained by
the MOBITEL study of Scherr. This study with 174 patients determined a reduction in
the overall length of hospital, mortality and hospitalization.
Conclusion: Based on the discussed studies, this Bachelor Thesis demonstrates that the
application of telemedicine is favored in comparison with standard therapies. In
particular, this is expressed in a reduction of clinical parameters of hospitalizations,
duration of stay, mortality and emergency room visits. Consequently, cost savings are
due to a reduced use of health services. However, the comparably low use of the
elements of health economic evaluation account for the lack of evidence. In addition,
the comparability of studies and cost-benefit advantages of the telemedicine is
extremely challenging due to the strong variation of the study structures. The required
proof of the benefits of medical necessity and viability of the Social Security Code can
therefore not unambiguously be assigned. In the near future the priority on the
implementation of comprehensive studies on the merits of telemedicine is to meet the
requirements of health economic evaluation needs.
VIII
1
Herausforderungen an das deutsche Gesundheitssystem
Das deutsche Gesundheitssystem steht vor verschiedenen Herausforderungen. Ein
zunehmender Ärztemangel, ein demografischer und soziokultureller Wandel und eine
steigende Anzahl chronischer Krankheitsverläufe gefährden eine optimale Versorgung
der Bevölkerung. Künftig wird die bestmögliche Versorgung durch steigende Kosten
und eine Limitation der vorhandenen Ressourcen auf die Probe gestellt. (Dittmar et al.,
2009) Der medizinische und technische Fortschritt äußert sich in einer höheren
Lebenserwartung der Bevölkerung und einem voranschreitenden demographischen
Wandel. Als Folge daraus gefährdet der zunehmende Alterungsprozess die Strukturen
des Gesundheitssystems. In Deutschland lag im Jahr 2010 der Anteil der Bevölkerung
in der Altersklasse 60-79 Jahre bei 21 %. In der Altersgruppe der Über-80-Jährigen
betrug der Anteil 5%. Bereits im Jahre 2030 wird der Anteil der 60-79 Jährigen auf
29 % und der Anteil der Über-80-Jährigen auf 8% geschätzt. (Leidl, 2014, S.18) Daten
des Statistischen Bundesamtes aus dem Jahr 2009 verdeutlichen die Verschiebung der
Altersstruktur. Prognosen zufolge ist im Jahre 2050 der Anteil der 60-Jährigen doppelt
so hoch wie die Geburtenrate. (Reiter et al., 2011, S.8; Statistisches Bundesamt, 2012)
Um den Alterungsprozesses zu kompensieren, erfordert es eine Geburtenrate von 2,1
Kindern pro Frau. Die aktuelle Geburtenrate von 1,37 Kindern pro Frau verfehlt diesen
Richtwert deutlich. (Statistisches Bundesamt, 2013; Leidl, 2014, S. 19)
In Deutschland finanzieren sich die gesetzlichen Krankenkassen mithilfe des
Umlageverfahrens. Innerhalb einer Periode decken dabei alle Versicherten durch die
gezahlten Versicherungsprämien die anfallenden Gesundheitsausgaben. Die
zunehmende Verschiebung der Altersstruktur in höhere Altersschichten, die niedrige
Geburtenrate und der medizinische und technologische Fortschritt führen zu einem
Anstieg der Gesundheitsausgaben. Zusätzlich steigt der Anteil der multimorbiden und
chronisch kranken Patienten. (Leidl, 2014, S. 24) Darüber hinaus sinkt das
Einnahmenniveau des Gesundheitssystems. Aus der niedrigen Geburtenrate, die bereits
seit ca. 40 Jahren unter der alterungskompensierenden Geburtenrate von 2,1 Kindern
liegt, resultiert gegenwärtig - wie auch zukünftig - eine geringere Anzahl an
Erwerbstätigen. Aufgrund des demographischen Wandels erhöht sich im gleichen Zug
die Anzahl der Rentner und somit der Nicht-Erwerbstätigen. Studien belegen, dass es
mit zunehmender Lebenserwartung zu einem Anstieg der Inanspruchnahme von
Gesundheitsleistungen kommt. Darüber hinaus vermindert sich die Erwerbsfähigkeit
durch die Zunahme chronischer Erkrankungen im fortgeschrittenen Alter. Ein weiterer
Grund für die sinkenden Einnahmen des Gesundheitssystems ist in den diffizilen
Formen der Beschäftigung angesiedelt. Volatile Beschäftigungsverhältnisse, temporäre
1
Beschäftigung, Arbeitslosigkeit und schwankende Erwerbsbiographien führen zu
inkonstanten Einkommensverhältnissen. Als Konsequenz muss eine sinkende Anzahl
Erwerbstätiger einen steigenden Anteil an Nicht-Erwerbstätigen finanzieren. Aus der
Finanzierungslücke können erhebliche Zusatzlasten, wie beispielsweise erhöhte Pro-
Kopf-Beitragszahlungen, für die kommenden Generationen resultieren. Statistiken
verdeutlichen die Bedrohung von steigenden Gesundheitsausgaben. Im ambulanten
Sektor sind die Gesamtausgaben für Gesundheitsleistungen im Zeitraum von 1992 bis
2008 von 77,712 Mrd. auf 130,890 Mrd. gestiegen. Im gleichen Zeitraum haben sich
die Ausgaben im Stationären- und Teilstationärenbereich von 57,884 Mrd. auf 94,610
Mrd. erhöht. Diese Werte entsprechen einem prozentualen Anstieg um 68,4 % bzw.
63,1 % innerhalb von 16 Jahren. (Leidl, 2014, S. 18-23; Reiter et al., 2011, S. 7-10)
Eine zentrale Rolle bei den Kostenträgern nehmen die chronischen Erkrankungen ein.
Laut Statistischem Bundesamt waren beispielsweise im Jahr 2012 die chronische
Herzinsuffizienz (CHI) und die chronisch obstruktive Lungenerkrankung (COPD) mit
45.410 bzw. 26.654 Todesfällen als zwei der zehn häufigsten Todesursachen zu
verzeichnen. (Statistisches Bundesamt, 2012b)
Die bisherigen Ausführungen verdeutlichen, dass eine Reformierung der etablierten
Versorgungsformen und Strukturen unumgänglich ist. Das deutsche Gesundheitssystem
benötigt neue Ansätze und Maßnahmen, um die Effizienz und Wirtschaftlichkeit des
Systems aufrechtzuerhalten und zu gewährleisten. Dabei werden verschiedene moderne
Technologien, insbesondere im Informationssektor, als Alternativen zu den aktuellen
Versorgungsstrukturen angesehen. Die größten Hoffnungen zur Überwindung des
Reformbedarfs und zur Effizienzsteigerung des Gesundheitssystems liegen in der
Telemedizin. Der Telemedizin werden zentrale Attribute zur Bewältigung der aktuellen
Herausforderungen des Gesundheitssystems zugesprochen. (Reiter et al., 2011, S. 3-4)
Klaus Theo Schröder, Staatssekretär des Bundesministeriums für Gesundheit, betonte
im Rahmen des Telehealth-Kongress im Jahr 2009 dass, ,,[...] das Versorgungsniveau
des Gesundheitssystems [...] sich nur mit Hilfe von Telemedizin aufrecht erhalten
lässt." (Lange, 2009) Mithilfe eines Berichts aus dem Jahr 2008 kann geschlussfolgert
werden, dass die Europäische Kommission Hoffnungen in die Telemedizin setzt: ,,Ein
größerer Einsatz der Telemedizin könnte enorme gesellschaftliche und wirtschaftliche
Vorteile mit sich bringen." Jedoch merkt die Kommission im Gegenzug an: ,,Zum
jetzigen Zeitpunkt liegt die volle Würdigung und Nutzung dieser Vorteile jedoch noch
in weiter Ferne."(Kommission der europäischen Gemeinschaften, 2008) Diese Zitate
symbolisieren den aktuellen Stand der Handhabung der Telemedizin. Experten und
fachspezifische Institutionen sind sich grundsätzlich einig, dass die Telemedizin
2
gesellschaftliche und wirtschaftliche Vorteile mit sich bringt. Dabei wird der
Telemedizin das Potential zugeschrieben, die Finanzierungslücke im Gesundheitswesen
zu schließen. (Reiter et al., 2011, S. 24)
Das Thema der vorliegenden wissenschaftlichen Arbeit lautet: ,,Kosten und Nutzen von
Telemedizin bei chronischen Krankheiten". Im Folgenden wird die Frage erläutert, wie
die Telemedizin definiert ist, welche Anwendungsbereiche innerhalb der Telemedizin
existieren und welche Begriffsabgrenzung vollzogen wird. Darüber hinaus wird für die
Bearbeitung des Ergebnisteils ein Überblick über die Kosten-Nutzen-Instrumente der
gesundheitsökonomischen Evaluation geschaffen. Die Methodik veranschaulicht, wie
die Durchführung der Literaturrecherche, der Datenanalyse und der Datenerhebung
vollzogen wird. In diesem Rahmen wird auch ein Überblick über die Verwendung der
Daten und Literatur gegeben. Der Ergebnisteil beinhaltet die Darstellung der
Studienlage telemedizinsicher Anwendungen am Beispiel der chronischen
Herzinsuffizienz und der chronisch obstruktiven Lungenerkrankung. Im Zentrum stehen
die in der Literatur gängigen und meist zitierten Studien dieser beiden chronischen
Krankheiten. Die Themenstellung Kosten und Nutzen von Telemedizin bei chronischen
Krankheiten ist die Basis für die Beantwortung der Fragestellung dieser Arbeit in der
Diskussion. Es gilt festzustellen, ob auf Grundlage der Kosten-Nutzen-Analysen von
chronischen Krankheiten ein Zusatznutzen der Telemedizin gegenüber der
Standardtherapie feststellbar ist. Darauf aufbauend erlaubt die Darstellung und
Bewertung der Studienlage ebenso eine Einschätzung, ob eine Aufnahme der
Telemedizin in den Leistungskatalog der Krankenkassen denkbar ist, und sie somit als
eine Lösung zur Überwindung der Herausforderungen des Gesundheitssystems
angesehen werden kann. Diese Fragestellung und die Ergebnisse werden in den Kontext
zu anderen Arbeiten gestellt. Das abschließende Fazit gibt einen Überblick über die
Ergebnisse der Arbeit und liefert einen Ausblick über die zukünftige Entwicklung der
Telemedizin.
2
Was ist Telemedizin?
Der Begriff der Telemedizin stammt aus dem Gesundheitswesen. Sie wird im Kontext
zum Begriff der Telematik und als Unterkategorie der Gesundheitstelematik betrachtet.
Die Begriffe der Telemedizin und der eHealth werden zunehmend synonym verwendet,
obwohl unterschiedliche Bedeutungen vorliegen. (Link, 2007, S. 5) Im Folgenden wird
eine Begriffsabgrenzung und ein Überblick über die Begriffseinordnung der
,,Telemedizin" vorgenommen. Des Weiteren erfolgt die Abbildung verschiedener
Definitionen unterschiedlicher Institutionen und Autoren sowie die Darstellung
3
telemedizinischer Anwendungsarten- und bereiche. Aufgrund einer fehlenden
Einheitsdefinition für den Begriff der ,,Telemedizin", existiert in Deutschland ein hohes
Spektrum an abweichenden Definitionen. Dieser Gliederungspunkt liefert eine
Übersicht, welche die umfassende Bandbreite an Definitionen und zentralen
Komponenten der Telemedizin möglichst präzise widerspiegeln soll.
2.1
Begriffseinordnung und -abgrenzung
Der Begriff der Telemedizin bzw. Telematik leitet sich vom griechischen Wort ,,Telos"
ab und bedeutet übersetzt ,,Ferne". Mit Telematik wird die Nutzung von moderner
Telekommunikation und Methoden der Informatik gemeint. Die Anwendung der
Telematik im Gesundheitswesen wird als Gesundheitstelematik bezeichnet. Synonyme
Bezeichnungen sind eHealth und Health Telematics. (Paulus und Romanowski, 2009, S.
2; Hermeler, 2000, S. 5) Die Definition der Gesundheitstelematik ist breit gefasst. Der
voranschreitende technische Fortschritt und die rapide wachsende Digitalisierung
erschweren eine präzisere Formulierung einer Definition. (Link, 2007, S. 5) Jedoch
gewährt der Bezug auf den synonymen Begriff eHealth einen umfassenderen Überblick
über die Definition der Gesundheitstelamtik. Die EU definiert den synonymen Begriff
eHealth wie folgt: "e-Health refers to the use of modern information and
communication technologies to meet needs of citizens, patients, healthcare
professionals, healthcare providers, as well as policy makers." (Europäische Union,
2004) Dietzel versteht unter Gesundheitstelematik die ,,Anwendung moderner
Telekommunikations- und Informationstechnologien auf das Gesundheitswesen,
insbesondere auf administrative Prozesse, Wissensvermittlung und
Behandlungsverfahren." (Dietzel, 2001, S. 14) Beckers geht mit dieser Definition
konform, indem er e-Health charakterisiert als den ,,Einsatz von Informations- und
Kommunikationstechnologien im Gesundheitswesen, mit Schwerpunktlegung auf
einrichtungsübergreifende und vernetzte Geschäfts- und Versorgungsprozesse."
(Beckers, 2014, S. 10) Die Telemedizin wird, als zentraler Begriff dieser
wissenschaftlichen Arbeit, als ein Bestandteil der Gesundheitstelematik verstanden.
Diese ist wiederum Teil der Telematik. Auf diese Weise kann eine klare Abgrenzung
zwischen den Begriffen vollzogen werden.
2.2
Definition der Telemedizin
Wie bereits erläutert, bedeutet Telemedizin übersetzt Fernmedizin (griech. Telos =
Ferne). Die Telemedizin ist eine Anwendung die über eine spezielle
4
Telematikinfrastruktur abgewickelt wird. Dabei überbrückt diese spezifische
Informations- und Kommunikationstechnik die Distanz zwischen Ärzten und Patienten.
(Hermeler, 2000, S. 5) Im deutschsprachlichen Raum existiert eine Vielzahl an
Definitionen. Laut den Einbecker Empfehlungen, anlässlich eines Workshop der
Deutschen Gesellschaft für Medizinrecht im Jahre 1999, ermöglicht und unterstützt die
Telemedizin in Überwindung räumlicher Entfernungen medizinische Dienstleistungen
durch die kombinierte Anwendung von Telekommunikation und Informatik. (DGMR,
1999, S. 133-136) Im selben Jahr beschreibt Goetz die Telemedizin als die konkrete
Erbringung medizinischer Leistungen, seien diese Diagnostik oder Therapie, mit den
Mitteln der Telematik. (Goetz, 1999, S. 502) Das Bundesministerium für Bildung,
Wissenschaft, Forschung und Technologie definiert den Begriff der Telemedizin als
,,jegliches Behandlungsverfahren, das als Element die unmittelbare Überwindung
räumlicher Distanz zwischen Patient und Arzt enthält." (Hermeler, 2000, S. 5) Eine u.a.
von Link und der AnyCare Schriftenreihe zitierte Definition stammt von Dietzel: Die
Telemedizin ist der ,,Einsatz von Gesundheitstelematik zur Überwindung einer
räumlichen Trennung zwischen Patient und Arzt oder zwischen mehreren behandelnden
Ärzten." (Dietzel, 2001, S. 14) Die World Health Organisation charakterisiert die
Telemedizin als das Erbringen von Gesundheitsleistungen zur Diagnose, Therapie oder
Prävention durch Gesundheitsberufstätige, aber auch für Forschung, Auswertungen und
Weiterbildung von Gesundheitsberufstätigen unter Überwindung von räumlicher
Entfernung. (WHO, 1998) Die bisherigen Erläuterungen zeigen, dass in Deutschland
keine einheitliche Telemedizin-Definition vorherrscht. Vielmehr gibt es eine Vielzahl
an Definitionen von unterschiedlichen Institutionen, Wissenschaftlern und Verbänden.
Dennoch sind bei den verschiedenen Quellen Ähnlichkeiten und Überschneidungen zu
vermerken. Beim Vergleich der vielfältigen Definitionen lassen sich kontinuierlich
auftretende Attribute der Telemedizin filtern. Als Basis für die weitere Vorgehensweise
der vorliegenden wissenschaftlichen Arbeit wird die Definition der Telemedizin aus der
AnyCare Schriftenreihe zum Gesundheitsmanagement zugrunde gelegt. Durch den
Einbezug verschiedener Experten der Krankenkassen und der Leistungserbringer liefert
sie eine stichhaltige und umfassende Definition, die alle Begriffsattribute beinhaltet.
Demzufolge lässt sich die Telemedizin als ein Verfahren oder System charakterisieren,
das Patientendaten und andere medizinische Informationen über eine Distanz hinweg
erhebt, verfügbar macht, auswertet oder diese Prozesse unterstützt. Dabei dienen die
eingesetzten Techniken der Diagnostik und der Therapie. Unter Einbezug der
Patientensicht wird zusätzlich zu einem ,,doctor-to-doctor" und ,,doctor-to-patient"
Austausch auch eine ,,patient-to-patient" Kommunikation ermöglicht. (Thielscher,
5
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Erstausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2014
- ISBN (Paperback)
- 9783959930109
- ISBN (PDF)
- 9783959935104
- Dateigröße
- 945 KB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Ludwig-Maximilians-Universität München – Gesundheitsökonomie und Management
- Erscheinungsdatum
- 2015 (Dezember)
- Note
- 2,0
- Schlagworte
- Telemedizin chronische Krankheiten Kosten Nutzen COPD chronische Herzinsuffizienz cost-benefit cost-utility
- Produktsicherheit
- BACHELOR + MASTER Publishing