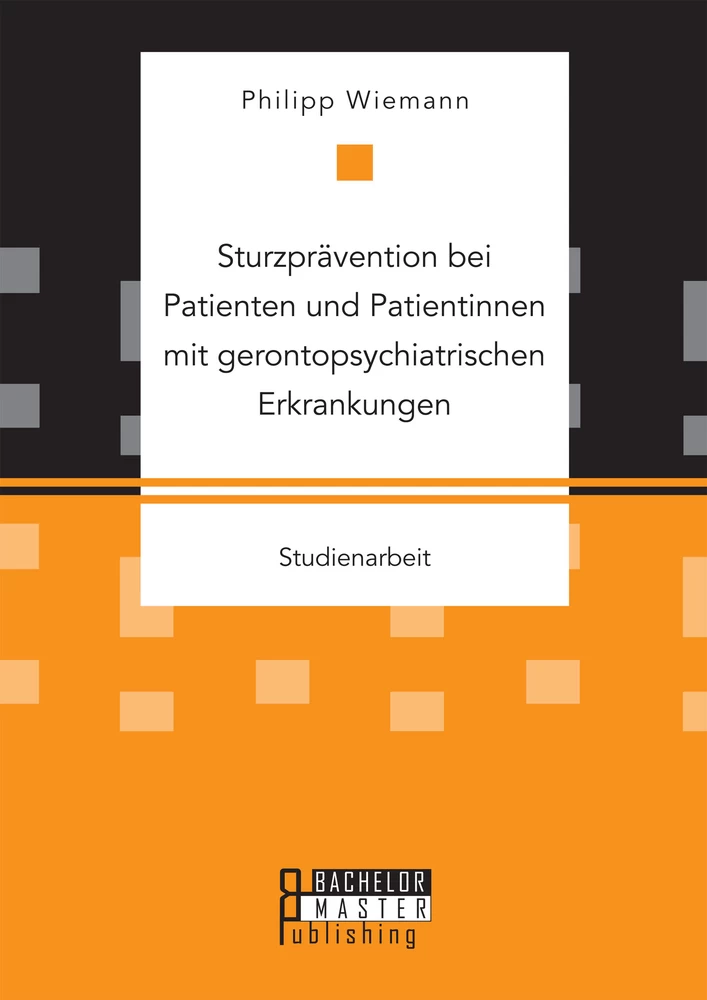Sturzprävention bei Patienten und Patientinnen mit gerontopsychiatrischen Erkrankungen
©2016
Studienarbeit
25 Seiten
Zusammenfassung
In seiner Tätigkeit als Präventionsberater fiel dem Autor vermehrt auf, dass Kollegen unterschiedlichster Stationen, Patient_innen mit Sturzneigung eher mechanisch oder medikamentös fixieren, als fachgerecht zu mobilisieren. Hier stellt sich ihm folgende Frage: Muss jeder Sturz mit allen Mitteln verhindert werden? Diese Frage lässt sich bereits im Vorfeld mit nein beantworten. Man kann nicht überall sein. Jedem Menschen steht das Recht zu sich, wenn noch möglich, frei bewegen zu dürfen. Kommt es in diesem Zusammenhang zu einem Sturzereignis, hätte dieses nicht verhindert werden können. Wann ist ein Sturz ein Sturz und ist eigentlich jeder Sturz ein Sturz?
Vom Sturz und der Sturzprophylaxe sind vor allem Menschen betroffen, die auf Grund ihrer körperlichen Verfassung weniger Kraft und Balance aufweisen, als körperlich gesunde Menschen. Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit präventiven Maßnahmen zur Sturzminimierung bei Patient_innen mit gerontopsychiatrischen Erkrankungen.
Vom Sturz und der Sturzprophylaxe sind vor allem Menschen betroffen, die auf Grund ihrer körperlichen Verfassung weniger Kraft und Balance aufweisen, als körperlich gesunde Menschen. Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit präventiven Maßnahmen zur Sturzminimierung bei Patient_innen mit gerontopsychiatrischen Erkrankungen.
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
4
deutlich höher, insbesondere in Bereichen mit gerontopsychiatrischen Schwerpunkt (bis
>50/1.000 Belegtage)."
3
Die Dunkelziffer in solchen Fachabteilungen sollte deutlich höher
sein, da nicht alle Stürze auch wirklich gesehen oder wahrgenommen werden. Viele
Patient_innen sind zudem nicht in der Lage sich adäquat zu äußern, beziehungsweise
Schmerzen anzugeben und zu lokalisieren. Demnach werden wichtige Untersuchungen gar
nicht erst durchgeführt. Dies betrifft Stürze, bei denen Patient_innen möglicher Weise
rücklinks auf den Hinterkopf fallen. Bei Betroffenen, die eine demenzassoziierte Diagnose
in der Vorgeschichte aufweisen, fällt dies zunächst nicht auf, da sie mit großer
Wahrscheinlichkeit im Erstkontakt vigilanzgemindert erscheinen. Trifft dieses zu, bleiben
zum Beispiel subarachnoidale Blutungen unentdeckt und werden eventuell erst in
Zufallsbefunden sichtbar. Was sind nun mögliche Interventionen, um Stürze vermeiden zu
können beziehungsweise ihnen präventiv entgegen zu wirken? In erster Linie ist es wichtig
sich mit den nachfolgenden Grundbegriffen gezielt auseinander zu setzen. Gerade im
Bereich der Gerontopsychiatrie ist es von Vorteil spezielle gerontopsychiatrische
Erkrankungen zu kennen und vor allem auch zu verstehen. Im Verlauf werden nicht nur
Interventionsmöglichkeiten erläutert, sondern auch ein Exkurs zu speziell ausgewählten
gerontopsychiatrischen Erkrankungen gegeben. Wichtig ist das der Mensch als Individuum
gesehen wird. Nur so lassen sich Stürze minimieren oder im besten Fall verhindern.
2
Relevante Begriffserklärungen
Dieses Kapitel dient zur Erlangung grundlegender Kenntnisse, um sich gezielt mit den
Themen Sturz und Prävention auseinanderzusetzen. Es wurden bewusst unterschiedliche
Definitionsansätze gewählt, um zu verdeutlichen, dass diese Begriffe nicht zwangsläufig
eindeutig definiert werden können.
2.1
Definition des Begriffes Prävention
Als Prävention bezeichnet man Maßnahmen ,,zur Abwendung von unerwünschten
Ereignissen oder Zuständen, die mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit eintreffen könnten,
falls keine Maßnahmen ergriffen werden. Präventive Interventionen setzten voraus, dass
Maßnahmen zur Verfügung stehen, die geeignet sind, den Eintritt dieser Ereignisse zu
3
Mahoney JE.: Immobility and Falls. Clin Geriatr Med 1998; 14:699-726.
5
beeinflussen."
4
Der Begriff der Vorbeugung wird in diesem Zusammenhang als Synonym
verwendet. In der Regel wird der Ausdruck Prävention in der Medizin verwendet, während
in der Pflege, speziell für pflegerische Maßnahmen, das Wort Prophylaxe gängiger ist. Man
unterscheidet im Allgemeinen zwischen primärer, sekundärer und tertiärer Prävention.
Primäre Prävention bedeutet Faktoren auszuschalten, welche die Gesundheit schädigen
können. Sekundäre Prävention meint, Erkrankungen durch Vorsorgeuntersuchungen so
früh wie möglich zu diagnostizieren, um mit der Therapie der Krankheit in einem noch
möglichst frühen Stadium beginnen zu können und so die Aussichten zu erhöhen, die
Krankheit zu heilen. Tertiäre Prävention umfasst Maßnahmen, die bei einer bereits
eingetretenen Krankheit eingeleitet werden, um zu verhindern, dass sich die Krankheit
verschlimmert oder dass Folgeerkrankungen eintreten. Hierzu zählen viele Prophylaxen der
Pflege. Die Sturzprävention beginnt in erster Linie im Bereich der primären
Präventionsansätze und geht nach einem schweren Sturzereignis in den Bereich der
tertiären Prävention über.
2.2
Definition des Begriffes Sturz
Im Rahmen des Expertenstandards Sturzprophylaxe in der Pflege, welcher im Jahre 2005
veröffentlicht wurde, wird der Sturz in Anlehnung an die Kellog International Work Group
on the Prevention of Falls by the Elderly definiert als ,,jedes Ereignis, in dessen Folge eine
Person unbeabsichtigt auf dem Boden oder einer tieferen Ebene zu liegen kommt."
5
Die
genannte Definition umfasst lediglich den ersten Teil der eigentlichen, umfassenderen
Definition. In dieser heißt es weiter, ,,dass Stürze aufgrund eines Stoßes, aufgrund von
Bewusstseinsverlust, aufgrund plötzlich eintretender Lähmungen, sowie aufgrund
epileptischer Anfälle nicht als Stürze im Sinne des obenstehenden ersten Teils der
Definition gelten."
6
Die Expertenarbeitsgruppe hat sich jedoch dazu entschieden, den
zweiten Teil der Definition nicht aufzunehmen, weil nicht immer hinreichend genau die
Ursache eines Sturzes feststeht, da Stürze häufig unbeobachtet stattfinden. Einen
umfassenderen und plausibleren Definitionsansatz für Stürze im eigentlichen Sinne wählt
die Deutsche Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin e.V. in ihrer
Leitlinie ,,Ältere Sturzpatienten". Demnach ist ein Sturz zu verstehen als ,,ein
4
Peter Fuchs: Prävention Zur Mythologie und Realität einer paradoxen Zuvorkommenheit, erscheint in: Saake, I./Vogd, W. (Hrsg.)
Mythen der Medizin
5
Deutsches Netzwerk für Qualitätsentwicklung in der Pflege (DNQP) 2005, S.12
6
Deutsches Netzwerk für Qualitätsentwicklung in der Pflege (DNQP) 2005, S.12
6
unfreiwilliges, plötzliches, unkontrolliertes Herunterfallen oder gleiten des Körpers auf
eine tiefere Ebene aus dem Stehen, Sitzen oder Liegen. Als Sturz beziehungsweise beinahe
Sturz ist auch zu verstehen, wenn ein solches Ereignis nur durch ungewöhnliche Umstände,
die nicht im Patienten selbst begründet sind, verhindert wird, zum Beispiel durch das
Auffangen durch eine andere Person.
7
Im klinischen Bereich wird in diesem
Zusammenhang von einem ,,kontrollierten zu Boden gleiten" gesprochen, welches im
Allgemeinen nicht als Sturz gewertet wird, jedoch als dieser gewertet werden sollte. Nun
müsste man davon ausgehen, dass es scheinbar nicht eindeutig ist, wie ein Sturz definiert
werden sollte. Im Hinblick auf die unterschiedlichen Definitionen, ist meiner Ansicht nach
ausschlaggebend immer zum Wohle der Patient_innen zu handeln. Als Faustregel gilt:
Lieber einmal zu viel einen Arzt zu Rate gezogen, als einmal zu wenig. Zu beachten ist,
dass jeder Sturz schwerwiegende Folgen nach sich ziehen kann, auch wenn diese nicht
zwangsläufig unmittelbar nach dem Ereignis in Erscheinung treten müssen.
2.3
Definition des Begriffes Risiko
Das Risiko wird im Allgemeinen als ,,Produkt aus Eintrittswahrscheinlichkeit eines
unerwünschten Ereignisses und Schadensschwere als Konsequenz aus einem etwaigen
Eintritt des Ereignis"
8
angesehen. Der Begriff des Risikos wird in verschiedenen
wissenschaftlichen Disziplinen unterschiedlich definiert. Allen Definitionen gemeinsam ist
die Beschreibung des Risikos als Ereignis mit möglicher negativer, eventuell auch mit
positiver Auswirkung. Da nicht alle Einflussfaktoren bekannt sind, beziehungsweise vom
Zufall abhängen, ist das Risiko mit einem Wagnis verbunden. Betrachtet werden sollte, in
der vorliegenden Ausarbeitung, das Risiko als Ergebnis mit möglicher negativer
Auswirkung, da ein Sturz nur einen positiven Aspekt aufweist, wenn bei der nachfolgenden
Behandlung und der damit einhergehenden Diagnostik, Erkrankungen zu Tage kommen,
welche aufgrund dieses Zufallsbefundes, möglicher Weise eine höhere Heilungschance
bürgen.
7
Deutsche Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin e.V. 2004,S.7
8
Krause, Lars / Borens, David: Das strategische Risikomanagement der ISO 31000, zweiteilig, ZRFG 4+5/2009
7
3
Sturzrisikofaktoren
Der nachfolgende Abschnitt beschäftigt sich speziell mit zwei großen Gruppen von
Risikofaktoren. Die Erste bezieht sich auf die Einschränkungen aufgrund des
fortgeschrittenen Alters und der damit unter Umständen zusammenhängenden
Multimorbidität. Dies bezeichnet man als personenbezogene Risikofaktoren. Die Zweite
beschäftigt sich mit medikamentenbezogenen Risikofaktoren. Hierzu zählen spezielle
Gruppen von Medikamenten, welche aufgrund der Wirkungsweise oder möglicher
Nebenwirkungen zu einem erhöhten Sturzrisiko führen, aber auch der Aspekt der
Polypharmazie, welcher in Anbetracht der steigenden Lebenserwartung mehr und mehr an
Bedeutung gewinnt.
3.1
Einschränkungen der kognitiven Fähigkeiten
Menschen mit Gedächtnis- und Aufmerksamkeitsstörungen, welche in erster Linie bei
demenziellen Erkrankungen auftreten, sind im besonderen Maße sturzgefährdet. Sollte es
zu einem stationären Aufenthalt kommen, werden die Betroffenen vor ganz besondere
Herausforderungen gestellt. Es können unter anderen folgende Probleme auftreten, welche
die Erkrankten nur bedingt selbstständig oder zum Teil nicht ohne fremde Hilfe bewältigen
können. Hierzu könnten zählen, dass Patient_innen ihre Zimmer nicht wiederfinden, dass
ungenügende Lichtverhältnisse vorhanden sind, dass Betroffene ein Zimmer mit vier oder
fünf Personen teilen müssen. Nicht selten kommt es vor, dass Patient_innen in sogenannten
Flurbetten die Nacht beziehungsweise Tage verbringen, da keine freien Betten vorhanden
sind. Nun kann es sein, dass dieser Umstand dazu führt, dass Situationen mehr oder minder
verkannt werden und die Betroffenen komplett ihre Orientierung verlieren, was auch
dadurch bedingt ist, dass kaum noch Bezugspersonen vorhanden sind. Aufgrund der
stationären Überbelegung ist es bedauerlicherweise nicht einmal möglich jedem Erkrankten
ein Bettalarmsystem zur Verfügung zu stellen, wodurch die Betroffenen, die auf den Fluren
nächtigen, ein deutlich erhöhtes Sturzrisiko aufweisen. Die Überbelegung ist darauf zurück
zu führen, dass es sich bei stationären gerontopsychiatrischen Abteilungen um
Akutaufnahmebereiche handelt. Diese Bereiche sind zur Auf- und Übernahme verpflichtet.
Eine Verlegung ist selten möglich, da es innerhalb der Einzugsgebiete nur ein geringes
Angebot an diesen Spezialeinrichtungen gibt.
8
3.2
Beeinträchtigung sensomotorischer Funktionen
Als Sensomotorik bezeichnet man die Verknüpfung von sensorischen und motorischen
Leistungen. Damit ist die Steuerung und Kontrolle der Bewegungen von Lebewesen in
Verbindung mit Sinnesrückmeldungen gemeint. Die Wahrnehmung des Reizes durch
Sinnesorgane und motorisches Verhalten stehen in direktem Zusammenhang, diese
Prozesse verlaufen im Normalfall parallel. Demnach ist die Sensomotorik das
Zusammenspiel der Sinnessysteme mit den motorischen Systemen. Das Krankheitsbild des
Morbus Parkinson ist hierfür ein passendes Beispiel. Charakteristisch wäre in diesem Fall
,,der schlurfende Gang". Eine weitere Möglichkeit für eine beeinträchtigte sensomotorische
Funktion findet sich bei Chorea Huntington, hier zeigen sich klassischer Weise
unkontrollierte, ausladende Bewegungen, welche eine starke Sturzneigung nach sich
ziehen.
3.3
Beeinträchtigte Sehfähigkeit
Als sehbeeinträchtigt gelten Personen, die trotz optimaler Korrektur eines Sehfehlers, zum
Beispiel Kurzsichtigkeit, nur ein stark eingeschränktes Sehvermögen erreichen. Dies wird
in der Literatur auch als ,,Low Vision" bezeichnet. Mittels spezieller optischer und
elektronischer Sehhilfen, sogenannter ,,Vergrößernde Sehhilfen", gelingt es jedoch, diese
Personen bis zu einem gewissen Maße alltagstauglich und ,,sehend" zu machen.
Patient_innen in geschützten gerontopsychiatrischen Einrichtungen, vergessen unter
Umständen zunehmend die Handhabung der Sehhilfen. Brillen werden in der häuslichen
Umgebung vergessen oder im stationären Aufenthalt verlegt. Nicht selten befinden sich die
Hilfsmittel in Blumenkästen, Toiletten oder in Zimmern anderer Patient_innen. Präventiv
könnte man dies verhindern, indem mitgebrachte Hilfsmittel, wenn vorhanden, bei der
Aufnahme beschriftet werden, um die Zuordnung zu vereinfachen.
3.4
Medikamentöse Therapie
Die meisten einer Demenz zugrunde liegenden Erkrankungen sind prozesshaft
fortschreitend, nur für wenige gibt es zugelassene Medikamente, die jedoch die Krankheit
weder beseitigen noch den Krankheitsverlauf beeinflussen können. Die bislang vor allem
für die Morbus Alzheimer verfügbaren Medikamente beschränken sich auf die Behandlung
der Symptome und können im Optimalfall eine zeitweise Stabilisierung der Denkleistung
und Alltagskompetenz bewirken.
9
3.4.1
Sedativa
Ein Sedativum ist ein Arzneimittel, welches eine beruhigende beziehungsweise
aktivitätsdämpfende Wirkung aufweist. Unerwünschte Nebenwirkungen sind zum Beispiel
Konzentrations- und Aufmerksamkeitsstörungen, Kopfschmerzen, kardiale Entgleisungen
und, seltener, Gedächtnislücken und psychische Störungen wie depressive Verstimmung
und Fehlverhalten. Längerfristige Einnahmen können zu Konzentrationsstörungen,
Leistungsminderung, Veränderung der Stimmung und Gleichgültigkeit führen. Aufgrund
der dämpfenden Wirkung ,,taumeln" Patient_innen über die Stationsflure, da Betroffene,
die mit dieser Arzneimittelgruppe therapiert werden, zur Sichtkontrolle auf den Fluren,
unter Monitorüberwachen liegen sollten. Im Allgemeinen sind Personen, bei denen eine
demenzassoziierte Diagnose in der Krankengeschichte vorliegt, nur noch bedingt
absprachefähig. Das heißt, dass Erkrankte, auch nach mehrfachen Hinweisen das Bett
möglichst nicht zu verlassen, einfach aufstehen und stürzen. Gerade Patient_innen, die neu
eingestellt werden sind in erster Linie kardial instabil. Eine Vielzahl der Betroffenen klagt
über Schwindel und ,,Schwarzsehen". In dieser Phase kommt es aufgrund der Symptomatik
vermehrt zu Stürzen. Demnach ist es für Pflegekräfte obligat sich mit den Nebenwirkungen
dieser Arzneimittelgruppe expliziet auseinander zu setzten.
3.4.2
Benzodiazepine
Benzodiazepine finden in der Medizin Verwendung als angstlösende, zentral
muskelrelaxierende, sedierend und hypnotisch wirkende Arzneistoffe, sogenannte
Tranquilizer. Manche Benzodiazepine zeigen auch antikonvulsive Eigenschaften und
dienen als Antiepileptika. Die Sensibilität älterer Menschen gegenüber der Wirkung von
Benzodiazepinen ist deutlich erhöht, das heißt erhöhte Empfindlichkeit für erwünschte und
unerwünschte Wirkungen. Sie wirken sich bei Menschen, in höherem Lebensalter, in
gleicher Weise wie chronisch degenerative Erkrankungen aus. Merkmale hierfür sind
Trittunsicherheit, erhöhte Sturzgefahr und Beeinträchtigung der Kognition bis hin zu
Beeinträchtigungen auf die Aktivitäten des täglichen Lebens. Wichtig zu wissen, ist dass
diese Medikamentengruppe auch gleichzeitig die Herzeigenleistung herabsetzt. Es kommt
zu ähnlichen Symptomen, wie bei dem Einsatz von Sedativa. Auch hier sollte, gerade in
Akutphasen, der Erkrankte via Monitor überwacht werden. Akutphase heißt in diesem
Zusammenhang, dass sich Betroffene massiv fremd- beziehungsweise eigengefährdet
10
zeigen. Beispielsweise kommt es in diesem Zusammenhang zu Übergriffen gegenüber dem
Pflegepersonal oder anderen Patient_innen.
3.4.3
Neuroleptika
Neuroleptika sind ein Sammelbegriff für eine Gruppe von ,,Nervendämpfungsmitteln", die
beruhigend wirken und häufig bei wahnhaftem Erleben oder Halluzinationen eingesetzt
werden. Es kann vorkommen, dass die nicht kognitiven Symptome die kognitiven
Symptome verstärken, zum Beispiel kann eine Depression die Gedächtnisleistung negativ
beeinflussen. So ist es durchaus möglich, dass sich durch die Behandlung der Depression
auch die kognitive Leistung verbessert. Bei dieser Medikamentengruppe ist zu beachten,
dass sie langsam ,,eingeschlichen" wird und dass das Medikament nicht abrupt abgesetzt
werden darf, um Komplikationen, wie zum Beispiel Entzugserscheinungen, zu vermeiden,
um den Therapieerfolg nicht zu gefährden. Aufgrund der meist optischen Halluzinationen,
welche im Zusammenhang mit der Einnahme dieser Medikamentengruppe auftreten
können, kommt es dazu, dass Betroffene gegen Fenster und Türen laufen und stürzen.
3.4.4
Nicht-steroidale Entzündungshemmer (NSAR)
Als nicht-steroidale Antirheumatika bezeichnet man entzündungshemmende
Medikamente, die sich nicht von Sterinen ableiten und über eine Hemmung der
Cyclooxygenase wirken. Die gesetzlichen Krankenversicherungen wenden jährlich fast
,,125 Millionen Euro für die Behandlung gastrointestinaler Nebenwirkungen der NSAR
auf. 1100 bis 2200 Menschen sterben in Deutschland jährlich an gastrointestinalen
Komplikationen."
9
Die Dunkelziffer dürfte deutlich höher liegen. Während das Coxib
Rofecoxib® 2004 aufgrund eines erhöhten Herzinfarktrisikos vom Markt genommen
wurde, sind Ibuprofen® und Diclofenac® immer noch erhältlich und weit verbreitet,
obwohl laut einer neuen Studie ein ähnlich hohes Risiko besteht. Im Unterschied zu
Rofecoxib® kommt es jedoch nur bei der Langzeitanwendung zu einem erhöhten Risiko.
In einer Medwatch-Warnmeldung vom 9. Juli 2015 warnt die FDA erneut vor möglichen
Herzinfarkten und Schlaganfällen bei der Anwendung nichtsteroidaler Antirheumatika. Als
Medwatch bezeichnet man das interne Meldesystem der FDA. Die amerikanische Food and
Drug Administration, FDA, ins Deutsche übersetzt: ,,Nahrungs- und Medizinverwaltung",
ist die behördliche Lebensmittelüberwachungs- und Arzneimittelzulassungsbehörde der
9
,,Reduziert den Schmerz, schont die Organe", Der Allgemeinarzt 9/2007, S. 39
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2016
- ISBN (Paperback)
- 9783959930598
- ISBN (PDF)
- 9783959935593
- Dateigröße
- 776 KB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Diploma Fachhochschule Nordhessen Berlin-Treptow – Gesundheitspolitik
- Erscheinungsdatum
- 2018 (Januar)
- Note
- 1,3
- Schlagworte
- Sturzprävention Sturz Sturzrisiko Therapie Demenz Alzheimer Morbus Korsakow
- Produktsicherheit
- BACHELOR + MASTER Publishing