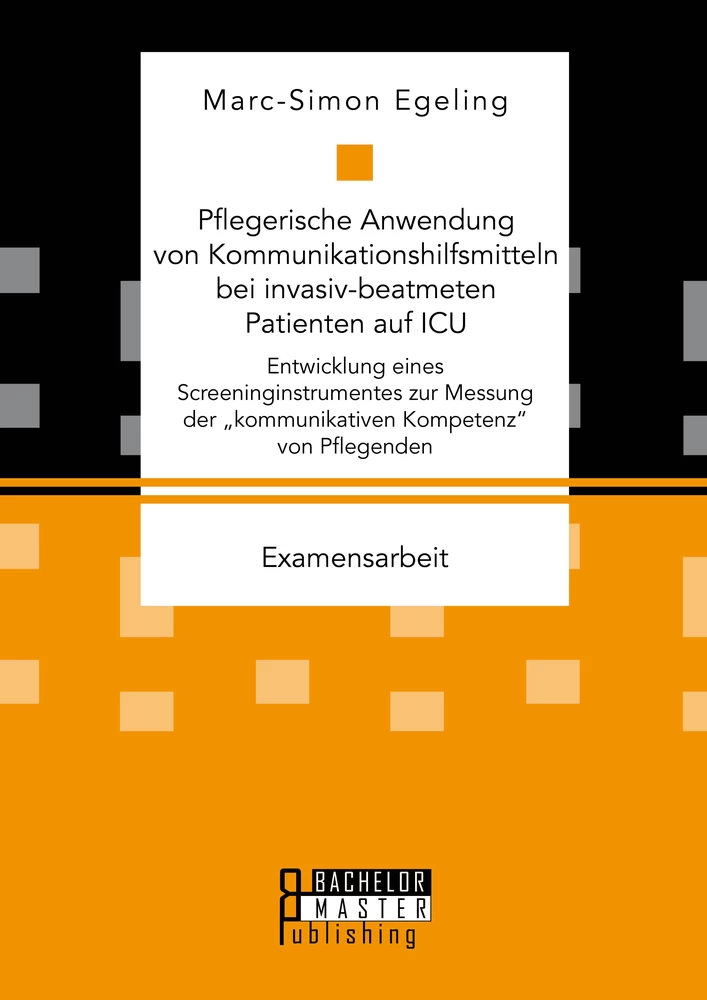Pflegerische Anwendung von Kommunikationshilfsmitteln bei invasiv-beatmeten Patienten auf ICU
Entwicklung eines Screeninginstrumentes zur Messung der "kommunikativen Kompetenz" von Pflegenden
©2017
Examensarbeit
70 Seiten
Zusammenfassung
Neben dem fachspezifischen Wissen und den Handlungskompetenzen von Pflegenden sind kommunikative Fähigkeiten im Rahmen der Interaktion mit dem Patienten wesentlich für Gestaltung von erfolgreichen Pflegeprozessen. Es gibt jedoch krankheitsbedingte Situationen des Patienten, die die verbale Kommunikation des wachen aber intensivpflichtigen Patienten aus therapeutischen Gründen vorübergehend einschränken.
In dieser empirisch-quantitativ ausgerichteten Arbeit werden Intensivpflegende eines Universitätsklinikums hinsichtlich der Strategieanwendung zur Förderung der "kommunikativen Kompetenz" des o.a. Patiententypus über eine Online-Erhebung befragt.
In dieser empirisch-quantitativ ausgerichteten Arbeit werden Intensivpflegende eines Universitätsklinikums hinsichtlich der Strategieanwendung zur Förderung der "kommunikativen Kompetenz" des o.a. Patiententypus über eine Online-Erhebung befragt.
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
2
Pflegemodellen. Hier könnte u.a. die Theorie nach Orlando mit ihrer
Untersuchungsfrage erwähnt werden: ,,Was sind Eigenschaften einer lebendigen,
offenen Pflegekraft-Patienten-Beziehung, die zu einer effektiven pflegerischen
Versorgung führt?" (Meleis, 1999, S.534 f.). Denn nach ihrem Modell ist erst aus
dem durch Interaktion mit dem Klienten verifiziertem Verhalten eine adäquate und
damit gültige Ableitung von Bedürfnissen des Klienten möglich. So kann nach
diesem Modell ,,Leiden und Hilflosigkeit" des Klienten erst dann vermieden
werden, wenn über Interaktion / Kommunikation die eigentlichen Bedürfnisse des
Klienten validiert worden sind (Meleis, 1999, S.537).
In Umkehrung haben Umstände, die eine Einschränkung der Interaktions-
/Kommunikationsfähigkeit des Patienten bedeuten wie die in dieser Arbeit
betrachtete Interaktion bei invasiver Beatmung auf Intensivstation (ICU)
erhebliche Auswirkungen auf die Qualität des Heilungsprozesses. So weist
Friesacher (2000, S.424) auf einen Zusammenhang zwischen therapeutisch
bedingten Kommunikationseinschränkungen des Patienten auf ICU und dem
Erwerb von psychischen und neurologischen Ausfallerscheinungen hin. Diese
können sich u.a. in Tendenzen zur Deprivation, zu Wahrnehmungsstörungen,
Angst-/Panikreaktionen des Patienten manifestieren, die u.U. sogar zu
posttraumatischen Belastungsstörungen nach Entlassung führen können. Eine
besondere Affinität hierfür haben nach Friesacher (2000, S.425) wache
Langzeitpatienten, die zu dem noch länger als drei Tage beatmet werden.
Zudem beeinflussen Kommunikationseinschränkungen des Patienten unmittelbar
die pflegerische Gestaltung der Beziehung zwischen Patient und Pflegenden. So
verweist Friesacher (2000, S.427) auf eine in einem Interview erhobene Aussage
eines Intensivpflegenden, nach der im Einklang mit eigenen empfundenen
Praxiserfahrungen auf ICU die pflegerische Interaktion mit wachen, kognitiv-
adäquaten und ,,relativ gesunden" Patienten anstrengender sei. Denn im
Gegensatz zu der eigentlich pflegerisch aufwendigeren Versorgung von
bewusstlosen Patienten, scheint beim wachen und kognitiv-adäquaten Patienten
der kommunikative Anteil pflegerischen Handelns erheblich höher zu sein.
Diese Aussage lässt zum einen auf die Existenz von bestimmten pflegerischen
Situationen schließen, wo die persönlichen Eigenschaften der ,,Kommunikativen
Kompetenz" (Light, J., 1989) des Pflegenden nicht hinreichend sind und zum
3
anderen aber auch auf Frustreaktion des Pflegenden in diesen bestimmten
Situationen schließen, wo dieser sich nutzlos und inkompetent empfindet (Magnus
et al., 2006, S.170). Es stellt sich somit folgende Fragestellung:
Welche Kommunikationsstrategien im Rahmen der vorhandenen ,,kommunikativen
Kompetenz" (Light, J., 1989) des Intensivpflegenden werden von diesem
verwendet, um pflegerisch adäquat mit invasiv beatmeten Patienten interagieren
zu können?
Der in dieser Arbeit verwendete Terminus ,,Kommunikationsstrategie" steht im
engen Zusammenhang mit dem zur ,,kommunikativen Kompetenz" (Light, J., 1989;
Light, Janice et al., 2014; Pivit, 2008). Es handelt sich bei diesem Begriff um ein
aus therapeutischen Alltagserfahrungen abgeleitetes Konglomerat in der
Behindertenhilfe, das wissenschaftlich von Experten der International Society for
Augmentative and Alternative Communication (ISAAC) (Braun, 2008b, S.4)
systematisiert worden ist. Diese Definition kategorisiert Fähigkeiten der jeweiligen
Kommunikationspartner in der jeweiligen Lebenssituation, um unterstützende
(augmentative) bzw. alternative Hilfsmittel (AAC) bei Menschen mit
Kommunikationseinschränkungen klientenspezifisch einsetzen zu können.
Basierend auf den Erkenntnissen der ,,Unterstützen Kommunikation" im Rahmen
der Behindertenhilfe und den Literaturkenntnissen zum Forschungstand des
Einsatzes von Kommunikationshilfsmitteln im Krankenhaussetting soll in dieser
empirisch-quantitativ ausgerichteten Arbeit ein Screeninginstrument entworfen und
auf Pretest-Niveau im ICU-Setting einer deutschen Universitätsklinik auf interne
Konsistenz geprüft werden. Dieses ,,Screeninginstrument" soll zum einen die
Erfahrungen des Pflegenden quantitativ erfassen, bestimmte Strategien zur
Förderung der momentanen ,,Kommunikativen Kompetenz" des Patienten auf ICU
adäquat einsetzen zu können. Denn erkennt der Pflegende die kommunikativen
Ressourcen des Patienten adäquat, kann der Pflegende mit Wahl der richtigen
Strategie selbst erst ,,kommunikativ kompetent" werden. In diesem
Zusammenhang wird im Bereich der ,,Unterstützten Kommunikation" auch vom
,,Cleveren Kommunikationspartner" (Hüning-Meier et al., 2012, S.14) gesprochen.
Zum anderen soll dieses Screeninginstrument dazu dienlich sein, mit Erhebung
der ,,kommunikativen Kompetenz" von Pflegenden diese in unterschiedliche
Qualitätsklassen einzuteilen. Denn wie die Bias von aktuellen Wirksamkeitsstudien
4
zu Multi-Level-Interventionen (SPEACS) zur Förderung der ,,kommunikativen
Kompetenz von Pflegenden" (Happ et al., 2014, S.11) darlegen, ist trotz
Randomisierung bei erforderlicher Klasseneinteilung eine Verfälschung der
Wirksamkeit von SPEACS durch nicht erfasste pflegerische Vorerfahrungen,
Einstellung / Motivation der Pflegenden und Kultur des Settings nicht
ausschließbar.
Eine ,,Kommunikative Kompetenz des Pflegenden" wird im Screeninginstrument
operationalisiert aus den Postulaten an Intensivpflegende vonseiten des
Fachgebiets der ,,Unterstützten Kommunikation" (Diesener, 2010). Diese Postulate
entsprechen vier Einflussfaktoren Erkenntnisfähigkeit der patientenspezifischen
Ressourcen für adäquate Hilfsmittelanwendung (A), Fachkompetenz (B),
Einstellung und Motivation gegenüber Kommunikationseingeschränkten (C),
Gegebenheiten des ICU-Settings (D) , die in gegenseitiger Wechselwirkung
zueinanderstehend die ,,kommunikative Kompetenz des Patienten" bestimmen.
Eine Gewichtung dieser Faktoren und ihrer Wechselwirkungen zueinander durch
Selbsteinschätzung der ,,Kommunikativen Kompetenz des Pflegenden" ermöglicht
somit über anonyme Online-Befragung und stochastischen Ansatz (Satz von
Sylvester-Poincare) eine systematische Einteilung der Bewertungen von
Pflegenden in Klassentypen, die Qualitätsklassen entsprechen.
Kapitel 2: Definition grundlegender Begriffe aus dem Bereich der Behindertenhilfe
wie ,,Unterstützte Kommunikation (UK bzw. AAC)", ,,kommunikative Kompetenz",
Skizzierung wesentlicher Gruppen von Kommunikationshilfsmitteln, Ableitung
wesentlicher Faktoren für Operationalisierung der ,,Kommunikativen Kompetenz
des Intensivpflegenden".
Im Kapitel 3: Forschungsstand über systematische Literatursuche zur Anwendung
von Kommunikationshilfsmitteln auf ICU (Schwerpunkt Übersichtsarbeiten).
Im Kapitel 4: Einordnung der im Anhang II, III, IV aufgelisteten Kernaussagen (f**)
von drei Reviews in die o.a. Faktoren/Kategorien A, B, C und D zur
vergleichenden Schwerpunktsetzung der Reviews und im Gesamtüberblick über
diese drei Reviews. Daraus Begründung des stochastischen Ansatzes,
Begründung für Durchführung einer Erhebung, Arbeitshypothese und Konstruktion
des Online-Fragebogens für den Pflegenden.
5
In Kapitel 5: Auswertung der Erhebung und Vergleich der Ergebnisse mit aktuellen
Forschungsstand, Limitationen.
Kapitel 6: Zusammenfassung der Kernergebnisse + Fazit.
Kapitel 2.
Termini des Fachgebiets ,,Unterstützte Kommunikation"
2.1. Definition ,,Unterstützte Kommunikation" (UK bzw. AAC)
Der Terminus ,,Augmentative and Alternative Communication" (AAC)" (im
Deutschen: ,,Unterstützte Kommunikation (UK)") impliziert ohne Beschränkung der
Allgemeinheit die Existenz von Menschen, die aufgrund bestimmter Umstände
(u.a. Behinderung, Erkrankung) sich selbst nicht wirksam hinsichtlich der
Interaktion mit der Umwelt über den Weg der verbalen Kommunikation empfinden
(Braun, 2008b, S.1). In diesem Fall besitzen diese Menschen bzgl. der verbalen
Selbstveräußerung Bedürfnisse, die mit dem Begriff Complex Communication
Needs (CCN) (Finke et al., 2008) umfasst werden können. Das Fachgebiet der
,,Unterstützten Kommunikation" hat demzufolge das Ziel, die für soziale Teilhabe
über Interaktion mit der Umwelt eigentlich erforderliche aber unzureichende
Lautsprache des Betroffenen je nach Entwicklungsstand seiner sprachlichen
Fähigkeiten zu ergänzen (augmentative) oder gar zu ersetzen (alternative) (Braun,
2008b, S.1). ,,Unterstützte. Kommunikation" ist somit ein klientenspezifisches
Konzept, das den Betroffenen unter Berücksichtigung der Eigenschaften des
jeweiligen sozialen Umfeldes (z.B. privates, berufliches) zu einem aktiven und
sozial gleichwertigen Interaktionsteilnehmer empowern soll (Braun, 2008b, S.1).
Damit dient dieses Konzept der Entwicklung und Förderung der im nächsten
Abschnitt zu behandelnden ,,Kommunikativen Kompetenz" aller an jeweiliger
Interaktion beteiligten Kommunikationspartner (Braun, 2008b, S.1). Das
Fachgebiet ,,Unterstützen Kommunikation" unterteilt die Hilfsmittel für
Kommunikation (AAC) in drei Hauptgruppen (Braun, 2008b, S.1 f.):
(1) AAC als expressives Hilfsmittel, (2) AAC als unterstützendes Hilfsmittel und (3)
AAC als alternatives Hilfsmittel. Die Hilfsmittel der Gruppe (1) sind angemessen
für die Menschen, die ein gut ausgebildetes Sprachverständnis haben aber
aufgrund bestimmter Umstände die Fähigkeit zur lautsprachlichen Kommunikation
vorübergehend oder dauerhaft verloren haben. Für Gruppe (2) sind jene
Menschen vorgesehen, die Ansätze von verbaler Lautsprache besitzen und somit
6
generell in der Sprachentwicklung verzögert sind. AAC als Hilfsmittel hat hier die
Funktion, über eine Erleichterung der sozialen Teilhabe die lautsprachliche
Entwicklung und damit die ,,Kommunikative Kompetenz" zu fördern und zu
verbessern. Die Gruppe 3 von AAC ist für jene Menschen vorgesehen, die über
den Weg der verbalen Lautsprache generell nicht kommunizieren können. Gemäß
vorhandener Ressourcen des Betroffenen muss in diesem Fall eine
klientenspezifische Kommunikationsform sogar eigene Sprache erst
entwickelt werden, deren Signale im Sinne einer erfolgreichen sozialen Teilhabe
des Betroffenen für außenstehende Interaktionspartner für Verständigung
desweiteren transformiert werden müssen (Braun, 2008b, S.2). Grundlage des
Fachgebiets der ,,Unterstützten Kommunikation" ist demzufolge der Begriff der
,,Kommunikativen Kompetenz", dessen Anwendungen in folgenden Abschnitten
betrachtet wird.
2.2. Der Begriff ,,Kommunikative Kompetenz" (AAC)
2.2.1. Sinn und Schema des Begriffs ,,Kommunikative Kompetenz"
Die Einführung eines Begriffs der ,,Communicative Competence" (Light, J., 1989;
Light, Janice et al., 2014) bzw. ISAAC (2015, Kommunikationskompetenz )
vonseiten des Fachgebiets der ,,Unterstützten Kommunikation" ist aus mehreren
Gründen als notwendig betrachtet worden:
Mit einer Definition sollen zum einen im Sinne einer Art ,,Evaluation" die
vorauszusetzenden Minimalkompetenzen potentieller AAC-Anwender für
adäquate Anwendung der jeweiligen Hilfsmittel genannt und mit dem momentanen
Status der Kompetenzausprägung des konkret Betroffenen verglichen werden.
Eine definitorische Aufstellung einer Art Raster bzw. Koordinatensystems
ermöglicht somit erst eine klientenspezifische Auswahl des richtigen Instrumentes
(Light, J., 1989, S.137). Zum anderen dient eine Definition dazu, sich von den
normativen Ansprüchen einer Sprachtherapie abzugrenzen. Denn das Idealziel
der Beherrschung einer verbalen Lautsprache ist zwar auch für den Fachbereich
der ,,Unterstützten Kommunikation" erstrebenswert aber weder von allen
Menschen erreichbar noch notwendig für das eigentliche Ziel einer weitgehend
selbständigen sozialen Teilhabe im Sinne der o.a. Definition des Begriffs
,,Unterstützte Kommunikation" (Light, J., 1989, S.137).
7
Vom definitorischen Schema entspricht die Definition ,,Communicative
Competence" nach Light, J. (1989); (Light, Janice et al., 2014) einer
Nominaldefinition (Kutscherer et al., 2000, S.151 ff.). D.h., dem zunächst
bedeutungsleeren und damit zu definierenden Begriff ,,Communicative
Competence" (sog. ,,definiendum") werden formallogisch bestimmte, notwendige
und damit zueinander widerspruchsfreie Eigenschaften (sog. ,,definientia") zu
geordnet, so dass das Definiendum erst mit dieser festgelegten
Eigenschaftszuordnungsvorschrift eine Bedeutung (Intension) und damit seinen
Begriffsumfang (Extension) erhält. Eine Veränderung der Eigenschaftszuordnung
zu einem zu definierenden Begriff (z.B. bedingt durch neue Erkenntnisse) hat
gleichzeitig Veränderungen des Bedeutungsinhaltes des Begriffs und damit seines
Begriffsumfanges zu Folge. Bezogen auf den Begriff ,,Communicative
Competence" ist der ursprüngliche Definitionsvorschlag von Light, J. (1989), der
sich auf notwendige Eigenschaften wie u.a. Linguistische, Operationale, Soziale
und Strategische Kompetenzen (Light, Janice et al., 2014, S.13) bezieht, im Jahr
2003 (Light, Janice et al., 2014) um weitere mögliche die o.a. Kompetenzen
unmittelbar beeinflussenden Faktoren wie den ,,Psychosocial Factor" (Light,
Janice et al., 2014, S.4 f.) und den Faktor ,,Environmental Support and Barriers"
(Light, Janice et al., 2014, S.5 f.) erweitert worden. Der psychosoziale Faktor
umfasst die psychologischen Umstände des jeweiligen AAC-Anwenders wie
Motivation, Einstellung, Vertrauen und Resilienz (Light, Janice et al., 2014, S.12 f)
der Faktor ,,Environmental Support Barriers" umfasst die jeweiligen
settingspezifischen Eigenschaften wie Vorhandensein von AAC-Tools, Personal
mit ,,Kommunikativer Kompetenz" u.a.. Ferner schlägt Light, Janice et al. (2014,
S.7) weitere Einflussfaktoren auf die ,,Communicative Competence" als
Begriffserweiterung vor wie u.a. demographischer Wandel der AAC-Nutzer,
Veränderung der Bedürfnislage von AAC-Nutzern, technischer Fortschritt der
AAC-Hilfsmittel, Veränderungen in den Erwartungen bzgl. der sozialen Teilhabe
der AAC-Nutzer.
Wesentlich bei Betrachtung der o.a. weiteren möglichen Einflussfaktoren auf die
,,kommunikative Kompetenz" ist aber, dass diese schon implizit nach der
ursprünglichen Definition (Light, J., 1989) wirksam sind und somit kaum für
empirische Überprüfung explizit operationalisierbar und damit kaum fassbar sind.
So sind z.B. psychologische Faktoren wie Motivation, Einstellung zum Nutzen von
8
AAC-Hilfsmittel u.a. immer erst indirekt über Verbesserung oder Verschlechterung
der konkreter operationalisierbaren Linguistischen, Operationalen, Sozialen und
Strategische Kompetenzen zuschließen. Denn diese Kompetenzen verstanden
als psychologische Leistungsbegriffe implizieren immer mindestens kognitions-,
lern- und entwicklungspsychologische Komponenten. Insofern ist eine explizite
Nennung sich implizit gegenseitig bedingender weiterer Faktoren (deren Wirkung
nicht bestritten wird) als mögliche weitere Begriffseigenschaften keine wirkliche
Erweiterung des Begriffs ,,Communicative Competence". U.U. ist diese
Begründung gültig für die Tatsache, dass die International Society for
Augmentative and Alternative Communication (ISAAC) sich in ihrem
Begriffslexikon (ISAAC, 2015, Kommunikationskompetenz) ebenfalls an die
Komponenten der Begriffsdefinition nach Light, J. (1989) orientiert. Diese
Definition von 1989 ist deshalb Basis für Skizzierung der wesentlichen Aspekte
des Fachbereichs ,,Unterstütze Kommunikation" Der Aspekt o.a. ,,psychosozialer"
und ,,settingspezifischer Faktoren" von 2003 wird in der Übersichtsarbeit von Finke
et al. (2008) unter den Begriffen ,,intrinsischer" und ,,extrinsischer Faktoren" bei
Konstruktion des Screeninginstrumentes zur Erhebung der ,,Kommunikativen
Kompetenz bei Pflegenden" auf ICU aufgegriffen. Denn dort geht es um die Frage,
ob der Pflegende die ,,Kommunikative Kompetenz" seines Klienten in Abhängigkeit
von seinen momentanen Ressourcen einschätzen und im gegebenen Rahmen
des Settings adäquat pflegerisch intervenieren kann. Dies erfordert aber sich
gegenseitig bedingende Faktoren wie Fachkompetenz und Motivation des
Pflegenden.
2.2.2. Begriff ,,Kommunikative Kompetenz" (AAC / Stand: 1989)
Mit Verweis auf einen ,,Kompetenzbegriff" nach Websters English Dictionary
(Light, J., 1989, S. 138) und Erkenntnissen u.a. aus Sprachwissenschaften wie
u.a. Linguistik, Soziolinguistik, Zweitspracherwerb (Light, J., 1989, S.139) wird der
Begriff der ,,Kommunikativen Kompetenz" folgend definiert:
,,(...) communicative competence is a relative and dynamic, interpersonal construct based on
functionality of communication, adequacy of communication, and sufficiency of knowledge,
judgement, and skill in four interrelated areas: linguistic competence, operational
competence, social competence, and strategic competence. Linguistic and operational
competencies refer to knowledge and skills in the use of the tools of communication; social
and strategic competencies reflect functional knowledge and judgement in interaction."
(Light, J., 1989, S.137).
9
Diese Definition zeigt zunächst, dass ,,kommunikative Kompetenz" selbst keine
absolute innewohnende Personeneigenschaft ist, sondern eine höhere
Systemeigenschaft als Resultat eines dialektisch geprägten Interaktionsprozesses
der jeweiligen an dieser Interaktion beteiligten Personen ist. Insofern könnte
potentiell jede Person in Abhängigkeit von der jeweiligen sozialen
Rahmensituation kommunikativ kompetent oder inkompetent werden. Somit ist
,,kommunikative Kompetenz" ein relatives Abbild der jeweiligen in Relation
zueinanderstehenden durch Sozialisation bedingten Eigenschaften der einzelnen
Personen, die den Habitus (Bourdieu, 1982) bestimmen. Dem Fachbereich der
,,Unterstützten Kommunikation" obliegt somit die Kernaufgabe, gemäß
vorhandener Ressourcen des kommunikativ Eingeschränkten seinen sozialen
Interaktionsrahmen so um zu gestalten, dass dieser ohne große Mühen in diesem
(interaktiv selbständig werden kann (Pivit, 2008, S.10). Im Rahmen der o.a.
Definition des Begriffs ,,Kommunikative Kompetenz" haben die o.a. Eigenschaften
folgende Bedeutung:
,,Functionality of Communication" (Light, J., 1989, S.138 f.) ist als ein zu
forderndes Qualitätsmerkmal hinsichtlich der Wirksamkeit der für Klienten in
Betracht gezogenen AAC-Maßnahmen zu verstehen. Funktionalität der
Kommunikation ist nach diesem Kriterium genau dann geben, wenn der in der
Kommunikation Eingeschränkte in seinem sozialen Lebensbereich in die Lage
versetzt wird, seinen Alltag selbständig nach eigenem Ermessen zu gestalten.
Dies impliziert aber, dass dieser nach seinem Ermessen mögliche Kommunikation
in seinen Lebensbereichen initiieren kann (Pivit, 2008,S.10). In diesem
Zusammenhang steht auch das Kriterium ,,Adequacy of Communication" (Light, J.,
1989, S.138). Das Kriterium entspricht einer Forderung nach Begrenztheit der
Anwendbarkeit von AAC-Hilfen. Denn zu viele potentielle Auswahl- und
Kombinationsmöglichkeiten (z.B. zu viele zur Verfügung gestellten Symbole, zu
großes Vokabular) im Rahmen der jeweiligen ACC-Instrumente (Pivit, 2008, S.8)
können eine Überforderung je nach Ressourcen des Betroffenen darstellen.
Ebenso führt ein zu gering ausgestattetes ACC-Hilfsmittel zu einer Unterforderung
mit ähnlicher Konsequenz einer Ablehnung des Hilfsmittels. Zur Bestimmung der
Grenzen des Hilfsmitteleinsatzes ist somit abzuklären, in welchen
Lebenszusammenhängen der Betroffene dieses benötigt (z.B. beruflich oder
privat). In diesem Zusammenhang sind entsprechende Interaktionspartner (z.B.
10
Angehörige, Kollegen) bei Entwicklung von Strategien mit einzubeziehen (Pivit,
2008, S.11). Eine totale Beherrschung der unterstützten Kommunikation als Art
,,Muttersprache" (d.h. in jedem beliebigen sozialen Rahmen adäquat interagieren
zu können) wird als zu hohes Ziel von Vertretern der ,,Unterstützten
Kommunikation" somit nicht verfolgt.
O.a. Kriterien implizieren wiederum gewisse Kompetenzen des jeweiligen AAC-
Anwenders, die mit dem Oberbegriff ,,Sufficiency of Knowlegde, Judgement, and
Skills" als weiteres Kriterium für adäquate AAC-Anwendung zusammenfasst
werden, da diese voneinander abhängen und damit sich gegenseitig bedingen
(Light, J., 1989, S. 141f). Dieser Oberbegriff umfasst die Eigenschaften ,,Linguistic
Competence", Operational Competence, Social Competence" und ,,Strategic
Competence" (Light, J., 1989S.139 ff.). Wie aus der o.a. Gruppeneinteilung der
AAC-Instrumente zu schließen ist, ist die Auswahl des angemessen AAC-
Instrumentes für den Anwender u.a. abhängig von dem bis dato ausgeprägten
Stand des Schrift-Sprachverständnisses (linguistic competence). Diese
Ausprägung ist jedoch abhängig von Lebenserfahrungen des Nutzers, die u.U. die
Auswahl eines technisch-aufwendigeren Instrumentes mit größerem Wortschatz
rechtfertigen (Light, J., 1989, S.139 f.). Da es aber keine 1:1-Übesetzung von
gedachten Sprachinhalten in entsprechende AAC-Kodierung des jeweiligen
Instrumentes gibt, ist zusätzlich ein kognitiver, sensomotorischer, perzeptiver
Leistungsaufwand vom Anwender notwendig, um das jeweilige Instrument
anzusteuern und damit bedienen zu können (Light, J., 1989, S.140);(Pivit, 2008,
S.9). Diese in der alltäglichen Kommunikation nicht erforderliche Zusatzleistung
beim kommunikativ Nicht-Eingeschränkten wird von Vertretern der Unterstützen
Kommunikation auch als ,,Operationale Kompetenz" bezeichnet. Diese Kompetenz
steht auch im engen Zusammenhang mit der ,,Strategischen Kompetenz" (Light,
J., 1989, S.141). Darunter ist die Fähigkeit zu verstehen, bei vorhandenem
begrenzten Vokabular/Symbolen der jeweiligen AAC-Instrumente (in Analogie zur
Kommunikation in einer Zweiten Fremdsprache), zu kommunizierende
Sachverhalte mit dem begrenzten Wortschatz ausdrücken und damit durch das
Hilfsmittel bedingte Wortschatzdefizite kompensieren zu können. Ferner sind zu
dem ,,Soziale Kompetenzen" soziolinguistische Verhaltensregeln in der
jeweiligen Rahmensituation notwendig, die von der Persönlichkeitsentwicklung
abhängig sind und u.U. im Rahmen der zu entwickelnden Strategien erst erlernt
11
werden müssen (Light, J., 1989, S.140). Kommunikationsregeln sind u.a.
Sprecherwechsel erkennen (Turn-Taking-Prinzip), Blickkontakt halten,
Missverständnisse erkennen und aufklären, Fragenstellen, Gesprächsthemen
finden und führen können, sich auf einen Gesprächspartner einstellen können
(Pivit, 2008, S.8);(Braun, 2008a, S.26).
Diese o.a. Anforderungen für adäquate Anwendung von AAC-Hilfen erfordern
einen enormen Leistungswillen und gleichzeitig eine hohe Frustationstoleranz aller
am Interaktionsprozess Beteiligten im Erlernen einer AAC-Anwendung. Denn
,,Unterstützte Kommunikation" beansprucht Zeit und bestimmt zu dem die
Gesprächsqualität zwischen den Kommunikationspartnern (so ist z.B. Humor über
AAC-Instrumente kaum wirksam). Zudem ist im Vergleich zur ,,natürlichen"
Kommunikation bei Anwendung von Kommunikationshilfsmitteln (z.B. bei Ja-
Nein-Kommunikation) häufig ein Rollentausch der Interaktionspartner notwendig.
So erhält der eigentlich passive Zuhörer eine aktive Rolle, da dieser mit einer JA-
Nein-Fragebatterie die Intention des passiv gewordenen Sprechers verifizieren
muss (Braun, 2008a, S.2 f.). Der folgende Abschnitt zeigt einen groben Überblick
über
die
drei
wesentlichen
ACC-Instrumentengruppen
,,Körpereigene
Kommunikationsform",
,,Nicht-Elektronische"
und
,,Elektronische
Kommunikationshilfsmittel".
2.3. Skizze von Kommunikationsstrategien aus der Behindertenhilfe
2.3.1. ,,Körpereigene Kommunikation" und ,,JA-NEIN-Kommunikation"
Wesentliches Ziel im Sinne der o.a. ,,Kommunikativen Kompetenz" ist es, dass ein
Klient eine multimodale Interaktionsfähigkeit (Pivit, 2008, S.6) erlernt, die
annähernd der ,,normalen" verbalen und non-verbalen Kommunikation entspricht.
Somit sind auch im Fachgebiet der ,,Unterstützten Kommunikation" die unmittelbar
und vegetativ beeinflussten Stimmungen des Klienten, die sich u.a. über
Gesichtsmimik, Muskelspannung, Vitalparametertendenzen (Braun et al., 2008,
S.6) in Abhängigkeit von der jeweiligen Rahmensituation veräußern, notwendige
Ausgangslage für Bestimmung des eigentlichen Bedeutungsinhaltes von Signalen
anderer Kommunikationshilfsmittel. Der Körper als Kommunikationsmedium
(Braun et al., 2008, S.6) ist somit nicht nur notwendig für Konzepte der Basalen
Stimulation (Fröhlich, 1998) bzw. Basalen Kommunikation (Mall, 1984) in der
12
Schwerstbehindertenpflege, sondern auch Grundlage jeder auszuarbeitenden
Kommunikationsstrategie im Rahmen der ,,Unterstützten Kommunikation".
,,Körpereigene Kommunikation" als ,,vorsymbolische Kommunikation" hat zwar
Gemeinsamkeiten mit der non-verbalen Kommunikation der wesentliche
Unterschied ist jedoch, dass Betreuer/Kommunikationspartner im Rahmen der
,,Unterstützten Kommunikation" das Erscheinen von körpereigenen Signalen in
Abhängigkeit von der jeweiligen Rahmensituation über Beobachtung,
Wiederholung, Bestätigung, Dokumentation erst zu einem klientenspezifischen
und
für
jeweilige
Kommunikationspartner
kontinuierlich
anwendbaren
Symbolsystem erst systematisieren müssen (Braun et al., 2008, S.6 f.). Dieser
Aspekt der systematischen Zuordnung von Bedeutungsinhalten zu einem Signal
oder Signalsequenz vonseiten des Klienten in Zusammenarbeit mit dem
Kommunikationspartner (z.B. Therapeut) wird im Fachgebiet der ,,Unterstützten
Kommunikation" mit dem Begriff ,,Ko-Konstruktion" (Pivit, 2008, S.11); (Hüning-
Meier et al., 2012, S.14) umfasst. Eine ko-konstruierte Bedeutungszuordnung
bedarf bzgl. ihrer klientenspezifischen Richtigkeit immer einer Rückversicherung
vonseiten des Ko-Konstrukteurs, die je nach Zustand der Kognition und des
aktuell entwickelten Sprach-/Symbolverständnisses des Klienten über den Weg
der verbalen, symbol-systemischen oder/und JA-NEIN-Kodierungsform über
Körpersignale erfolgen kann (Hüning-Meier et al., 2012, S.14). Im Zusammenhang
der Ko-Konstruktion von Bedeutungsinhalten ist somit zu folgern, dass ein
Hilfsmittel stärker die Selbständigkeit eines Klienten bewahrt, je weniger dieses
(z.B. bei ,,Komplexen Elektronischen") Ko-Konstruktion erfordert. Andererseits ist
bei kaum entwickelter Schrift-Sprache des Klienten Ko-Konstruktion notwendig,
um erst selbstständig interaktiv werden zu können. (Hüning-Meier et al., 2012, S.
10).
Die Wirksamkeit eines ,,individuellen Kommunikationssystems" ist im Sinne der
o.a. ,,Kommunikativen Kompetenz" abhängig vom Zusammenspiel der
wesentlichen
Komponenten
wie
,,Ausprägung der körpereigenen
Kommunikationsform", ,,bisherigen Erfahrungen mit Kommunikationshilfen", ,,Art
und Weise der Selektion und Ansteuerung" (zeitlich adäquate Bedienbarkeit ggf.
mit Handhabungshilfen der entsprechenden Instrumente im o.a. Zusammenhang
der Operativen Kompetenz) und vom aktuellen Entwicklungsstand des
13
Symbolverständnisses bzw. Wortschatzes (Linguistische Kompetenz) (Hüning-
Meier et al., 2012, S.3).
2.3.2. Schema ,,Nicht-Elektronischer Hilfsmittel" (LOW TECH)
Zu den Nicht-Elektronischen Hilfsmittel zählen in aufsteigender Folge nach
kognitiver Beanspruchung für Klienten geordnet: Reale Gegenstände,
Miniaturmodelle, Teile realer Gegenstände als Repräsentanten, Fotos von
Personen und grafische Symbole als Stellvertreter für einen Sinnzusammenhang
(Hüning-Meier et al., 2012, S.3 f.). Diese genannten Symbole können im Rahmen
einer begrenzten Bildsprache Anwendung finden und sind nicht hinreichend für
Darstellungen komplexerer Sinnzusammenhänge, die u.a. Adjektive, Adverbien,
Präpositionen erfordern. Diese o.a. für den jeweiligen Klienten zu
Symbolsammlungen zusammengestellten Zeichen sind deshalb strikt von den
Nicht-Elektronischen Kommunikationshilfsmitteln den ,,Symbolsystemen"
hinsichtlich Anspruch an Kognitions-, Organisation-, Aufmerksamkeit- und
Konzentrationsleistung
zu
unterscheiden.
Denn
im
Unterschied
zu
Symbolsammlungen müssen erst über Ko-Konstruktion bestimmte regelmäßig
wiederkehrende Symbolkombinationen zu einem klientenspezifischen Symbol-
/Sprachsystem aufgebaut werden, sodass u.U. auch komplexere nicht-bildliche
Kommunikation möglich ist. Hier bieten diverse Unternehmen unterschiedliche
Symbolsysteme (z.B. PCS, METACOM, DynaSyms etc.) an, die zu
durchorganisierten Kommunikationstafeln (Mappen) für Anwendung in jeweiligen
Lebensbereichen des Klienten (Schule / Beruf, Freizeit u.a.) nach
klientenspezifischen Themen-/Interessenbereichen zusammengestellt werden
(Hüning-Meier et al., 2012, S.5 f). Diese Kommunikationsmappen müssen zu dem
mit dem Lernfortschritt des Klienten angepasst werden und bei vorhandenen
Schrift-Sprachekenntnissen sogar mit Buchstaben, Wörtern, Alltagsfloskeln
erweitert werden (Hüning-Meier et al., 2012, S.5 f).
2.3.3. Schema ,,Elektronischer Hilfsmittel" (HIGH TECH)
Elektronische Hilfsmittel haben gegenüber Nicht-Elektronischen das wesentliche
Unterscheidungsmerkmal der elektronischen Sprachausgabe. Therapeutisch
ermöglicht diese Funktion dem Klienten, u.U. nicht mehr notwendigerweise auf ko-
konstruierende Gesprächspartner angewiesen sein zu müssen. Denn die
Sprachausgabe eines Gerätes ermöglicht eine Kommunikation mit Laien, die das
14
spezifische Symbolsystem des Klienten nicht kennen müssen. Die Gruppe der
potentiellen Anwender elektronischer Hilfen wird unterschieden in ,,präintentional,
intentional-präsymbolisch, verbal-symbolisch mit und ohne Einschränkungen"
(Garbe et al., 2012, S.2 f.). Die Einteilung zeigt, dass auch hier für adäquate
Geräteauswahl der Status der o.a. klientenspezifischen Teilkompetenzen der
,,Kommunikativen Kompetenz" berücksichtigt werden müssen.
Die Geräte können hinsichtlich des Merkmals Sprachausgabe eingeteilt werden.
Unterschieden werden bzgl. dieses Merkmals zwei Hauptgruppen: (1) Geräte mit
,,synthetischer Sprachausgabe" (,,Sprechende Schreibmaschinen (text to speech)";
,,Synthetische Sprachausgabe über vorgefertigter Vokabular-Strategie") und (2)
,,Geräte mit ,,natürlicher Sprachausgabe". In der zuletzt genannten Gruppe handelt
es sich quasi um Aufnahme- und Abspielgeräte mit mehreren Speicherplätzen, auf
denen individuelle Sprachmitteileilungen aufgenommen und abgespeichert
werden, die der Klient dann bei Bedarf über speziell mit Symbolen
gekennzeichneten Tasten ansteuern und abspielen kann. (Breuel, 2011, S.5 ff).
Neben Berücksichtigung der linguistischen und kognitiven Fähigkeiten bleibt wie
bei den nicht-elektronischen Hilfsmitteln die Forderung an die Betreuer, die
,,Kommunikative Kompetenz" regelmäßig zu evaluieren und Vokabularstrategien
entsprechend über Geräte-Updates anzupassen. In diesem Zusammenhang steht
auch eine Evaluation der o.a. Operativen Kompetenz vonseiten des Betreuers
hinsichtlich
zeitlich
adäquater
Ansteuerung/Bedienung
von
Wort-/
Symbolpräsentation (Vokabelstrategie) , die ebenfalls den Bedürfnissen des
Klienten entsprechen muss (Breuel, 2011, S.9 f.); (Garbe et al., 2012, S.5; S.11f.).
2.4. Besonderheiten der ICU aus Sicht der ,,Unterstützten Kommunikation"
Die o.a. möglichen Potentiale der ,,Unterstützten Kommunikation" im Rahmen der
Behindertenhilfe sind nur bedingt auf einer Intensivstation umsetzbar. Denn
wesentlicher Unterschied zwischen Menschen mit Behinderungen und
intensivpflichtigen Patienten ist, dass die erst genannte Gruppe relativ zur Zweiten
bzgl. ihrer lebensnotwendigen Körperfunktionen erheblich stabiler ist. So deutet
der ressourcenintensive Aufwand (Personal, Zeit, High-Tech) für Stabilisierung
von Vitalfunktionen im Intensivbereich (Diesener, 2010, S.14) auf einen anderen
therapeutischen Schwerpunkt hin als die Zielsetzungen in der Behindertenhilfe,
die doch eher als rehabilitativ zu bezeichnen sind. So wäre z.B. die Erstellung
15
eines o.a. klientenspezifischen ,,Symbolsystems" auf qualitativ hochwertigem
Niveau ein zusätzlicher zeitlicher Aufwand für den Intensivpflegenden, der nicht
realisierbar ist und zudem speziell ausgebildetes Fachpersonal erfordern würde.
Dennoch verharrt nicht jeder intensivpflichtige Patient im Status der ,,Instabilität".
So nennt Friesacher (2000, S.426 f.) sich gegenseitig bedingende Phasen eines
Intensivaufenthaltes wie vorakut, akut, postakut, stabil, rehabilitativ , die im
günstig anzunehmenden Fall eines Verlaufs für einen Patienten auf rehabilitative
Maßnahmen schon während des Intensivaufenthaltes hinauslaufen können. Es
scheint somit schon während der Intensivpflichtigkeit eine gewisse
Wechselwirkung zwischen Stabilisierung physiologischer Parameter und Zunahme
sensorischer, kognitiver Fähigkeiten des Patienten zu geben, die Interventionen
für Erhalt, Neuerwerb, Wiedererlangung ,,kommunikativer Kompetenz" im Rahmen
der Frührehabilitation ermöglichen können. Diesener (2010, S.15) spricht in
diesem Zusammenhang von einem ,,(...) Spagat zwischen (...) Notwendigkeiten
für die körperliche Integrität und den (Wieder)gebrauch elementarer kultureller
Fähigkeiten wie Kommunikation, Essen und Trinken, Bewegen, (...)." Andererseits
kann dieser Wechselwirkungsprozess mit Einfluss auf die ,,kommunikative
Kompetenz" u.U. von folgenden Faktoren ungünstig beeinflusst werden:
Auf Patientenseite sind zum einen zu nennen die Schwere und Ort der
traumatischen Ursache mit den damit verbundenen intensivmedizinischen
Handlungsnotwendigkeiten (u.a. Sedierung, Analgesie, invasive Beatmung,
künstliche Ernährung). Zum anderen gibt es auch patientenexterne Ursachen, die
sich u.a. auf die speziellen Eigenschaften einer Intensivstation mit ihrer
Geräuschkulisse, Betriebsamkeit, Störungen des Tag-Nacht-Rhythmus aber
auch auf Angst, und zu hoher Erwartungen an den Patienten durch ihre
Angehörigen zurückführen lassen. Diese Faktoren belasten den Patienten
zusätzlich,
dessen
für
Kommunikation
notwendige
Kognitions-
und
Aufmerksamkeitszeitspanne ohnehin beschränkt ist (Diesener, 2010, S.14 f.).
Aus Sicht der ,,Unterstützten Kommunikation" (Diesener, 2010, S.17 ff.) kann eine
Wirkung der o.a. ,,Negativ-Faktoren" im Sinne einer Förderung der
,,kommunikativen Kompetenz" vom Pflegenden nur dann minimiert werden, wenn
frühzeitig auf basaler Ebene zur Stabilisierung der ,,Körpereigenen
Kommunikation" durch Berühren erste sensorische Reize als interaktiver Akt mit
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Erstauflage
- Erscheinungsjahr
- 2017
- ISBN (Paperback)
- 9783959930697
- ISBN (PDF)
- 9783959935692
- Dateigröße
- 1 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg – Pflege & Management
- Erscheinungsdatum
- 2018 (Juni)
- Note
- 1,5
- Schlagworte
- Kommunikation Patient Pflege Kommunikationshilfe Pflegehelfer Krankenschwester Krankenpflege
- Produktsicherheit
- BACHELOR + MASTER Publishing