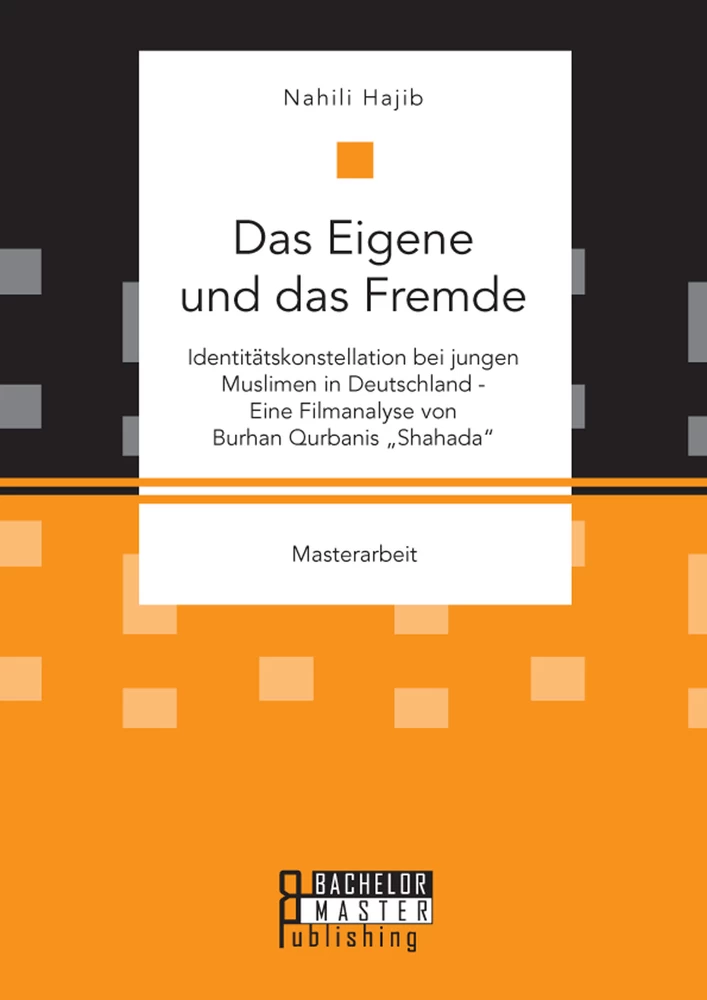Das Eigene und das Fremde. Identitätskonstellation bei jungen Muslimen in Deutschland - Eine Filmanalyse von Burhan Qurbanis "Shahada"
©2013
Masterarbeit
71 Seiten
Zusammenfassung
Die vorliegende Studie ist eine Filminterpretation und beschäftigt sich mit der Analyse und Interpretation des von dem deutsch-afghanischen Regisseur Burhan Qurbani gedrehten Films „Shahada“. Es geht um die Geschichten dreier Hauptfiguren: Sara, Ismail und Samir. Der Titel „Shahada“, das Glaubensbekenntnis, bezieht sich auf die erste der fünf Säulen des Islam. Der Kern dieser Masterarbeit ist zum einen die Identitätskonstellation bei den drei Hauptprotagonisten. Zum anderen wird beantwortet, wie die Charaktere mit dem entstehenden Bruch zwischen dem Eigenen und dem Fremden umgehen und wie sie als junge Muslime ihre Interkulturalität leben.
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
4
1.2. Einleitung
Die vorliegende Masterarbeit beschäftigt sich mit der Analyse und Interpretation des
von dem deutsch-afghanischen Regisseur Burhan Qurbani gedrehten Films
,,Shahada".
Dieser Film ist die Abschlussarbeit des Regisseurs an der Filmakademie Wüttenburg
und gehört zum Genre des Filmdramas. Er wurde im Jahr 2008 in Berlin gedreht und
mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet.
Der Titel ,,Shahada", das Glaubensbekenntnis, bezieht sich auf die erste der fünf
Säulen des Islam. Aber die Fragen, die sich vor dem ersten Sehen des Films stellen,
scheinen zu sein: Ist ,,Shahada" ein speziell deutscher Film über den Islam als
Religion? Wenn nein, welche Stellung hat das Wort Shahada in diesem
Zusammenhang? Wenn ja: In wieweit sind Religiosität und Spiritualität der
Hauptfiguren im Vergleich zu ihrem westlichen Alltagsleben dargestellt und definiert?
Was behalten sie als junge Muslime vom ihrem Eigenen in der Konfrontation mit dem
Fremden und wie wirkt das auf ihre Identitätskonstellation? Und was ist überhaupt
das Eigene in Europa geborener Muslime? Aus welchen Anteilen konstruiert sich ihre
Identität?
Neben ,,Shahada" kommen noch die vier anderen Säulen des Islams (das Gebet,
Almosengabe, das Fasten und die Pilgerfahrt) als Kapitelüberschriften vor. Diese
Struktur der Handlung könnte auch die oben genannte Fragestellung während des
ersten Ansehens legitimieren. Wenn man aber den Film sieht und wiedersieht und
gut versteht, stellt man fest, dass ,,Shahada" kein echter Film über die Grundlagen
des Islam ist, d. h. er vermittelt dem Zuschauer nicht bloß, was Islam ist und nicht ist.
Vielmehr hat der Regisseur Burahan Qurbani versucht zu zeigen, wie man als junger
Muslim in Deutschland seinen Glauben mit seinem Alltagsleben vereinbaren kann
und dass man gläubig und ohne Widersprüche und Identitätskrisen dort leben kann.
Der Alltag der Hauptfiguren Maryam (Maryam Zaree), Samir (Jeremias
Acheampong) und Ismail (Carlo Ljubek), ist zum einen durch Identitäts- und
Glaubenskrisen gekennzeichnet. Zum anderen kommt es bei ihnen, besonders bei
Maryam und Samir zu einem Bruch zwischen dem Eigenen und dem Fremden. Das
Ergebnis dafür lässt sich darin zeigen, dass alle drei Protagonisten in einer Art
Interkulturalität leben, ein Leben im Dazwischen. Um eine Zwischenlösung zu finden,
nimmt jede Hauptfigur ihre Religiosität als Hintergrund und versucht zugleich auf
5
unterschiedliche Art und Weise ein westliches Leben zu führen. Sie versuchen, sich
für einen richtigen Weg zu entscheiden und auf existenzielle Fragen, die der
Regisseur aufwirft, zu antworten: Wer bin ich? Wen liebe ich? Und woran glaube ich?
Dabei kommt das Alltagsleben der drei Hauptfiguren als drei Geschichten vor, die
parallel verlaufen und die gesamte Geschichte des Films bilden: Maryam, Tochter
eines Imams, versucht mit einer ungewollten Schwangerschaft zurechtzukommen.
Am Anfang der Handlung zeigt sie sich eher westlich als muslimisch. Samir, ein Kind
mit ausländischer Herkunft, durchlebt eine moralische und glaubensbedingte Krise
wegen seiner Homosexualität. Er muss sich dabei entscheiden, entweder seine
Homosexualität mit seinem Glauben in Einklang zu bringen oder sich dagegen zu
wehren. Da interessiert er sich nicht nur für seine Arbeit in einem Großmarkt,
sondern besucht als Koranschüler Vedats Moschee (Maryams Vater). Der dritte
Protagonist Ismail, ein deutscher Polizist mit türkischstämmiger Herkunft, leidet unter
einer alten und schweren Lebenskrise (er hat den Sohn seiner ehemaligen Freundin
Leyla (Marija Skaricic) bei einem Dienstunfall erschossen).
Wie man bemerkt, durchlebt jeder Protagonist Identitätskrisen. Der Regisseur hat
meines Erachtens versucht, diese Identitätskrisen und moralischen Probleme im
Rahmen des Dilemmas Islam und Westen darzustellen. Die Protagonisten befinden
sich nicht zuletzt zwischen Modernität und Tradition.
Die folgende Analyse bezieht sich einerseits auf die Identitätskonstellation bei den
drei Hauptprotagonisten. Andererseits wird darauf eingegangen, wie sie sich
gegenüber dem entstehenden Bruch zwischen dem Eigenen und dem Fremden
verhalten und wie sie als junge Muslime in Deutschland ihre Interkulturalität leben.
Diese Arbeit gliedert sich wie folgt: das erste Kapitel (1 bis 1.3.) gilt als allgemeine
Präsentation des Films und des Regisseurs. Dazu gehört auch die Begründung der
Auswahl des Films und des Themas.
Im zweiten Kapitel wird zuerst auf eine kurze Inhaltsangabe des Films ,,Shahada"
eingegangen. Danach wird die eigene Filmanalyse präsentiert. Dabei wird in erster
Linie eine kurze theoretische Darstellung der oben genannten Begriffe (Identität, das
Eigene und das Fremde und Interkulturalität) durchgeführt.
Danach wird gezeigt, wie diese Begriffe praktisch im Film angelegt sind und welche
Bedeutung diese Darstellung meines Erachtens hat. Diese Analyse betrifft auch die
Merkmale der Hauptfiguren und deren Mehrsprachigkeit in diesem Film.
6
Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit den folgenden Punkten:
.Bedeutung wichtiger
Aspekte des Islams im Film ,,Shahada", die Bedeutung der Moschee im Film
und Vorurteile
sowie Stereotypen im Film.
1.3. Zum Regisseur Burhan Qurbani
Burhan Qurbani, geboren 1980 in Erkelenz, ist der Sohn afghanischer Flüchtlinge.
Burhan Qurbanis Eltern mussten aus Afghanistan nach Deutschland fliehen und
erhielten dort politisches Asyl. Nach seinem Abitur 2000 in Stuttgart sammelte er
Erfahrungen am Theater, erst als dramaturgischer Assistent, später als Regie-
Assistent. 2002 trat er sein Studium der Spielfilm-Regie an der Filmakademie Baden-
Württemberg an. Burhan Qurbani ist eines der ersten Kinder, der bis heute
andauernden afghanischen Diaspora. Er ist mit zwei Kulturen aufgewachsen: der
islamischen und der deutschen. Darüber sagt er:
,,Muslimisch erzogen und auch noch gläubig sein, das ist angesichts
eines Lebens und einer Hochschullaufbahn in Deutschland nicht immer
einfach zu verbinden. Überspitz gesagt: Allah und TV Sakrale und das
Profane kamen für mich nicht zusammen."
1
Dieses Zitat zeigt deutlich die inneren Widersprüche des Regisseurs, die mit seinem
leben in Deutschland verknüpft sind. Er beschreibt diese Widersprüche wie folgt:
Wenn man einen Vergleich zwischen der Biographie von Burahan Qurbani und der
Hauptfiguren im Film macht, kann man feststellen, dass er sich mit ihnen
identifizieren lässt. Burhan Qurbani erklärt, dass er sich erst in den letzten Jahren
zum Islam bekannt hat, ohne diese Widersprüche auflösen zu können. Er sagt:
,,Erst in den letzten Jahren und mit Filmprojekten wie z.B die Serie dem
SerienPiloten < Vögel ohne Beine>, der von Türken in Deutschland
handelt, wurde ich wieder auf meine Ursprünge zurückgeworfen und
musste feststellen, dass sich die spirituelle Erziehung, die ich als Kind
und Jugendlicher genossen habe, nicht einfach so abschütteln lässt. So
1
Leif, Alexis: Die Himmelsleiter. <http://blog.derbraunemob.info/wpcontent/uploads/2008/07/
himmelsleiterpressemappe.pdf> [05.03.2013]
7
kann ich mich inzwischen zum Islam bekennen, ohne mich im Wider-
spruch auflösen."
2
Meines Erachtens kann man feststellen, wenn man Burhan Qurbanis Biographie
liest, dass sie sich im Großen und Ganzen in seinem Film ,,Shahada" widerspiegelt.
Er hat versucht, durch die Hauptprotagonisten seines Films seine eigenen
Widersprüche in Bezug auf die islamische und westliche Kultur aus der Sicht eines
Kindes, Jugendlichen und Erwachsenen, zu zeigen.
1.4. Burhan Qurbani über seinen Film
Im Folgenden geht es um einen Text von dem Regisseur des Films. Da erklärt er
zum einen seine Meinung zum Film. Zum anderen schildert er Passagen aus seinem
Leben in Afghanistan als Kind und in Deutschland als Erwachsener. Dabei wird
deutlich, dass seine Auswanderung von seinem Vaterland in die Aufnahme-
gesellschaft Deutschland einen großen Einfluss auf die Entwicklung seiner Identität
hatte. Der Film ,,Shahada" greift all diese Entwicklungen und Erfahrungen im Film
auf.
Zuerst spricht er über seine Kindheit und seinen Großvater, über die Trennung von
seinen Eltern und über die Kriegsjahre in Afghanistan. Da scheint es, dass ihm sein
Großvater als Vorbild galt:
,,Ein kleines Gebet auf den Weg. Es gibt da ein Bild aus meiner Kindheit;
eines, das geblieben ist:
Wir leben ich bin vielleicht zehn Jahre alt alleine mit meinem
Großvater. Meine Mutter arbeitet in einer anderen Stadt, weil es für eine
alleinerziehende Frau mit gebrochenem Deutsch auf dem Land schwer
ist, einen Job zu finden. Die Trennung meiner Eltern in der Diaspora war
ein Skandal und mein Großvater war aus Afghanistan gekommen, um
seiner gerade geschiedenen Tochter und ihren beiden kleinen Söhnen
zur Seite zu stehen. Die Kriegsjahre, der Verlust seines ältesten Sohnes,
die Zeit im Gefängnis, hatten meinen Großvater zu einem frommen Mann
2
Ebd.
8
gemacht. Und wie immer war er schon vor Sonnenaufgang aufgestanden,
um zu beten"
3
.
Danach erzählt Burhan Qurbani über sein Alltagsleben und erklärt, wie sein Groß-
vater die Rolle der Mutter übernommen und ihn den Islam gelehrt hat:
,,Dann wie jeden Tag weckt er uns Kinder für die Schule. Er schmiert
uns Brote. Er bugsiert uns aus der Haustür. Doch bevor wir uns auf den
Schulweg machen, gibt er uns noch ein paar Worte mit. Einen Satz auf
Arabisch, den wir immer wieder wiederholen sollen. Und wenn der sich
eingeprägt hat, kommt ein neuer dazu, solange bis sich die einzelnen
Fragmente zu einem Gebet zusammen fügen. So lernten wir über die
Wochen die ,,Fatiha", das islamische Vaterunser"
4
Danach stellt er fest, dass nach dem Tod seines Großvaters sein Bild vom Islam
durch ihn geprägt war, dennoch kam es nachher zu einem Widerspruch zwischen
seinem Glauben und seiner westlichen Kultur:
,,Der Beginn der Reise, dies sind die ersten Erinnerungen meiner
religiösen Erziehung. Mein Großvater lebt nicht mehr. Aber mein Bild vom
Islam ist immer noch von ihm geprägt. Seine liebevolle Art, seinen
Glauben zu vermitteln, ihn uns zu schenken, im Vorbeigehen. Und
dennoch kann ich aus eigener Erfahrung dem jüdischen Satiriker Ephraim
Kishon nur zustimmen, wenn er schreibt, dass nichts schwieriger sei als
gläubig und aufgeklärt zu sein. Muslimisch erzogen, und auch noch
gläubig sein, das ist angesichts eines Lebens in Deutschland nicht immer
einfach zu verbinden. Überspitzt gesagt: Allah und TV das Sakrale und
das Profane kamen für mich irgendwann nicht mehr zusammen"
5
.
3
3 Filmverleih(2010) :Eine bittersuess pictures Produktion in Kooperation mit dem ZDF/Das kleine
Fernsehspiel und der Filmakademie Baden-Wittenberg.
<http://www.3rosen.com/src/contpics/3R_ShahadaPH.pdf> [05.03.2013]
4
Ebd.
5
Ebd.
9
Diesen Widerspruch hatte er erst in den letzten Jahren überwinden können. Die drei
Geschichten von den Protagonisten im Film basieren auch auf diesen
Widersprüchen. Für den Regisseur ist ,,Shahada" ein Film, in dem er diese
Widersprüche seiner beiden Kulturen filmisch zu verbinden versucht.
Danach stellt Burhan Qurbani fest, dass er erst in den letzten Jahren seine spirituelle
Erziehung, die er als Kind und Jugendlicher genossen hat, nicht einfach so
abschütteln kann. Auf diese Weise kann er sich inzwischen zum Islam bekennen,
ohne sich im Widerspruch aufzulösen. Laut ihm ist sein Film ,,Shahada" ein Versuch,
die Widersprüche der islamischen und der deutschen Kultur, in denen er
aufgewachsen ist, filmisch zu verbinden.
Laut ihm ist ,,Shahada" auch kein Film über den Islam, sondern ein Film von
Menschen. Dabei stellt er fest, dass die Religiosität der Protagonisten ihre
Geschichten besonders macht und ihre Entscheidungen beeinflusst.
Ziel des Films ,,Shahada" dem Regisseur nach, ist es nicht, den Zuschauer
didaktisch an die Hand zu nehmen und ihm zu erzählen: Islam, das geht so oder so,
vielmehr geht es ihm darum, Geschichten von Menschen zu erzählen, die eine
bestimmte Religionszugehörigkeit verbindet, im Vorbeigehen auch ihre Religion und
ihre Kultur mit zu erzählen.
Darüber hinaus schildert er die Konflikte, Krisen und die Widersprüche, mit denen
diese Menschen in der deutschen Gesellschaft zu kämpfen haben. Daraus lässt sich
folgern, dass ,,Shahada" ein Film über Menschen in ihren Krisen, in extremen
Situationen ist. Diese Geschichten beschreibt er wie folgt:
Eine Vater-Tochter-Geschichte, eine Geschichte von Schuld und Sühne, eine
Geschichte vom Wert des eigenen Lebens, eine Geschichte vom Erwachen der
Sexualität. Es geht um Geschichten, die jeder Zuschauer für sich entdecken kann.
Dabei stellt sich Burhan Qurbani die Frage, was das Umfeld, die Sozialisation und
Religion, von den Hauptfiguren zum Besten wie zum Schlechtesten mit ihnen macht.
Nach ihm beeinflusst die Religiosität der Figuren ihr Handeln und ihre Ent-
scheidungen, was er die Entscheidung nach einem Weg nennt
6
6
Ebd.
10
2.
Das zweite Kapitel: Analyse des Films
2.1. Inhaltsangabe des Films ,,Shahada"
Wie schon angedeutet, erzählt der Film ,,Shahada" drei Geschichten von drei jungen
Muslimen in Deutschland. Diese Geschichten sind miteinander verknüpft und stellen
das Alltagsleben der Hauptfiguren dar, die weder ein ganz muslimisch geprägtes
noch ein ganz westliches Leben führen. Die Orte der Begegnung dieser Geschichten
der Hauptfiguren sind die Moschee, die Diskothek, die Arbeitsorte und die Wohnung.
Im Folgenden werden die drei Geschichten kurz dargestellt und im zweiten Kapitel
werden sie bezüglich der Begrifflichkeiten Identität, das Eigene und das Fremde und
Interkulturalität und der Hauptmerkmale der Protagonisten interpretiert.
Am Anfang führt der Film den Zuschauer in eine Diskothek, wo Maryam und ihre
Freundin zusammen tanzen und Bier trinken. Es geht um ein junges Mädchen,
dessen Vater (Vedat) Imam in einer Moschee ist. Sie sieht wie ein lebenslustiges und
westlich orientiertes Mädchen aus, das gut integriert ist und gerne mit ihrer Freundin
ausgeht. Oft entstehen Missverständnisse zwischen dem Vater und seiner Tochter,
die zu Auseinandersetzungen und Konflikten führen. Der Grund dafür liegt darin,
dass sie ein freies und ganz westliches Alltagsleben führt. Wegen dieser schwierigen
Beziehung informiert Maryam ihrem Vater nicht, dass sie von ihrem ehemaligen
Freund ungewollt schwanger ist. Danach versucht Maryam eine Abtreibung
durchzuführen, die erfolgreich war, aber die Blutung hört nicht auf. Infolgedessen
beginnt sie sich nach und nach für den Islam zu interessieren und nimmt an dem
Koranunterricht in Vedats Moschee mit anderen jungen Frauen teil. Ihr Interesse für
den Islam hat sie aber allein zu einer strengen Religiosität geführt, was noch andere
Konflikte sowohl mit ihrem Vater als auch mit den anderen Moschee-Besuchern
verursacht hat. Durch eine starke Blutung wurde sie ins Krankenhaus gebracht.
Dadurch erfährt ihr Vater, dass sie ungewollt schwanger war, zeigt aber ihr
gegenüber seine Sorgen und Hilfsbereitschaft.
In der nächsten Episode geht es um die jüngere Hauptfigur Samir (Sami im Film), der
aus Nigeria kommt und mit seiner allleinerziehenden Mutter Amira (Yollette Thomas)
zusammen lebt. Im Gegensatz zu Maryam scheint er von Anfang an gläubig zu sein.
In seiner Freizeit besucht er zusammen mit seinem Freund Sinan den Koran-
unterricht an der Moschee von Maryams Vater Vedat. Beide arbeiten in einem
11
Großmarkt, wo auch ein Freund von Sinan, Daniel (Sergej Moya) arbeitet. Dabei
entwickelt sich eine Beziehung zwischen Daniel und Sami von Bekanntschaft und
Freundschaft zu einer homosexuellen Beziehung, da Daniel schwul ist. Beide
geraten in eine moralische Glaubenskrise: Samir kann als gläubiger Muslim seine
Homosexualität nicht überwinden. Daniel scheint verliebt in Sami zu sein und
verlangt von ihm das Selbe. Beide müssen sich entscheiden.
Die dritte Episode ist Ismail (Carlo Ljubek), ein deutscher Polizist mit türkischer
Herkunft. Er ist mit einer deutschen Frau Sarah (Anne Ratte-Polle) verheiratet und
hat ein Kind. Ismails Geschichte beginnt mit seinem Treffen mit Leyla. Da entdeckt
er, dass sie nicht nur keine Aufenthaltsgenehmigung hat, sondern auch illegal
arbeitet und trotzdem bestraft er sie nicht. Von der Handlung des Films lernen wir
aber, dass er vor drei Jahren einen gefährlichen Unfall verursacht hat, in dem sie ihr
Kind verloren hat. Nach diesem Treffen fühlen sich beide schuldig: Ismail kommt
nicht mehr mit diesem Unfall zurecht und versucht sich durch die Nähe mit Leyla zu
trösten. Layla lehnt diese Nähe ab und glaubt, dass der Unfall eine Strafe Gottes
war. Am Ende verlässt Ismail seine Frau Sarah und beginnt mit Leyla eine neue
Beziehung.
Nach dem Lesen der Geschichten von den drei Hauptfiguren ist festzustellen, dass
die Figuren eine Glaubenskrise durchleben. Schließlich müssen die Protagonisten
ihre moralischen Werte und Überzeugungen überdenken und den Weg einer
Neuorientierung und Redefinition derselben gehen. Ihre Entscheidungen und die
neue Orientierung finden nicht ohne eine Identitätskrise statt. Eine neue Konstruktion
des Eigenen und des Fremden scheint dabei notwendig zu sein, denn die
Unterscheidung zwischen dem Innen dem Eigenen und dem Fremden für alle
Protagonisten scheint schwer zu sein. Welche Entscheidungen müssen die
Hauptfiguren dann treffen? Warum müssen sie sich neu orientieren? Was hat das mit
ihrem Eigenen und ihrem Fremden zu tun? Welche Vor- und Nachteile hat diese
neue Orientierung auf ihre ganze Identität und auf ihr Leben? Daraufhin wird im
folgenden Kapitel analytisch eingegangen. Das Ziel dieses Vorgehens ist, die
Identitätskonstruktion und den Bruch zwischen dem Eigenen und dem Fremden bei
den Hauptprotagonisten zu erklären, d. h., wie sich die Identität der in Deutschland
geborenen Muslime konstruieren lässt und was ist eigentlich das Eigene und das
Fremde an ihnen?
12
Zuerst sollen aber die Begrifflichkeiten Identität, das Eigene und das Fremde und
Interkulturalität theoretisch im Zusammenhang mit dem Film erläutert werden. Das
Ziel dieses Schrittes ist, dem Leser einen Überblick zu geben, um die ganze Analyse
besser zu verstehen.
2.2. Erläuterung der Begriffe: Identität, das Eigene und das Fremde und
Interkulturalität
Einführend werden die Begrifflichkeiten Identität, das Eigene und das Fremde und
Interkulturalität theoretisch kurz skizziert und erläutert. Das Ziel hierbei ist, dem Leser
eine Basis zu schaffen, die folgende Analyse des ausgewählten Films besser
verstehen zu können. Nachher wird gezeigt, wie diese Begrifflichkeiten im Film
,,Shahada" angelegt sind.
2.2.1. Identitätskonzept
Bereits im oben genannten Seminar wurde festgestellt, dass es keine all-
gemeingültige Definition des Identitätskonzeptes gibt. Der Grund dafür liegt meiner
Meinung nach darin, der Begriff Identität aus philosophischem, psychologischem
oder linguistischem Blickwinkel betrachtet werden kann. Dazu gehört, dass jeder von
uns ein eigenes Bild und eine eigene Vorstellung von sich selbst und seiner Identität
hat. Da kann man nicht von einer einzigen Definition der Identität sprechen. In
diesem Zusammenhang und bezüglich des ausgewählten Films ,,Shahada" kann
man auch, meines Erachtens, nicht von einer einzigen und identischen Identität von
den drei Hauptfiguren sprechen. Im Folgenden werde ich nun kurz auf die
wichtigsten Definitionen dieses Konzeptes eingehen.
Laut George Herbert Mead
7
, leitet sich der Begriff Identität vom Lateinischen ,,Idem"
ab und bedeutet so viel wie der/ die/das Selbe, der/die/das Gleiche. Er sagt:
7
George Herbert Mead war ein US-amerikanischer Philosoph und Psychologe. Er studierte unter
anderem in Leipzig und Berlin und war von 1894 bis zu seinem Tode Professor für Philosophie und
Sozialpsychologie an der University of Chicago ( Wikipedia-Personensuche (Hrsg) o.J.: George
Herbert Mead. Wikipedia-Personensuche <http://de.wikipedia.org/wiki/George_Herbert_Mead>
[20.03.2013]
13
,,Hier soll aber von der Identität von Menschen die Rede sein. Und zwei
Menschen sind sich nie vollkommen gleich, auch wenn es bei Zwillingen
auf den ersten Blick so aussehen mag" (Herbert Mead, o.J a, S. 1).
8
G. H. Mead erläutert die Identität im Wandel der Zeit und in der persönlichen
Entwicklung und stellt fest, dass sich die Identität jedes Menschen im Laufe der Zeit
verändert. (vgl. Mead b, S. 1).
Diese Veränderung gilt nicht nur für den Körper, sondern ebenso für die Seele und
betrifft unsere Charakterzüge, Gewohnheiten, Meinungen, Begierden, Freuden und
Befürchtungen. All das bleibt, laut Mead, in jedem Einzelnen niemals gleich, sondern
das eine entsteht, das andere vergeht. Auf diese Weise verändert sich der Mensch
unablässig und ist doch immer dieselbe Person. Bezüglich dieser Veränderung stellt
G. H. Mead die Frage, ob das mit unserem Alter, unserem täglichen Leben und mit
unseren eigenen Erfahrungen und deren Auswirkungen verbunden ist. In Bezug auf
das Alter konstatiert er, dass sich das Selbstbild jedes Menschen weniger ändert, je
älter er wird. Dieses Selbstbild gewinnt man im Laufe der Zeit von sich selbst und hat
einen Effekt auf das Handeln des Einzelnen im täglichen Leben. Auf diese Weise
basiert unsere Identität auf den gemachten Erfahrungen, sowohl positiver als auch
negativer Art. Dabei ist aber darauf hinzuweisen, dass es nicht immer um die
eigenen Erfahrungen geht, sondern auch um Einflüsse von außen (vgl. Herbert Mead
c, S. 1f)
9
.
Die zweite wichtige Definition des Identitätskonzeptes, die meines Erachtens in
Zusammenhang mit der oben skizzierten Definition steht, ist von Stuart Hall
10
, der
sich laut Inga Selck mit den Eigenschaften kultureller Identität befasst habe. Er
beschreibe die Identität als prozesshafte Produktion, die nie ein Ende findet (vgl.
Selck 2007, S. 6). ,,die Identität, um mit den Worten von Hall zu sprechen, ist weder
so vollkommen transparent, noch so unproblematisch, wie wir denken'"
11
.
8
Herbert Mead, George (o.J): Der Begriff Identität. <http://www.pellionis.de/identity/downloads/
Identitaet.doc> [20.03.2013]
9
Ebd.
10
Stuart Hall ist ein in Jamaika britischer Soziologe, der maßgeblich an der Gründung des Center for
Comtemporary Cultural Studies 1964 an der Universität Birmingham beteiligt war und somit als
Mitbegründer der Denk- und Forschungsrichtung Cultural Studies bezeichnet werden kann (...) (vgl.
Selck, 2007, 6)
11
Selck, Inga ( 2007): Das Eigene und das Fremde- Identitätskonstruktionen von Migranten im
deutschen Film.
14
Laut Inga Selck nennt Hall zwei Wege, um kulturelle Identität zu verstehen:
,,Erstens ist die Summe der Gemeinsamkeiten der Mitglieder einer Kultur,
also der gemeinsamen Erfahrungen und der kulturellen Codes. Die
andere Deutung schließt darüber hinaus die Unterschiede und die
Wandlungsfähigkeiten mit ein"
12
.
2.2.2. Das Eigene und das Fremde
Laut der Literaturkritikerin Marina Münkler
13 14
bezeichnet das Wort ,,fremd" im
Lateinischen ,,Extraneus" und bedeutet das, was außerhalb des eigenen Hauses, des
eigenen Herrschaftsbereichs oder des eigenen Staates und ihm daher nicht
zugehörig ist.
Fremdheit kann, nach M. Münkler, einerseits sozio-politisch im Sinne von Nicht-
zugehörigkeit gefasst werden, andererseits kann sie lebensweltlich, wissens-
soziologisch oder epistemologisch im Sinne von Unvertrautheit definiert werden. (vgl.
Münkler, S. 2)
15
.
In seinem Buch ,,Interkulturelle Literaturwissenschaft" weist Michael Hofmann
16
auf
drei verschiedene Bedeutungen des Wortes ,,fremd" hin. Er konstatiert, dass das
deutsche Wort ,,fremd" ausgesprochen vieldeutig ist. Dieser Begriff wird in anderen
Sprachen mit verschiedenen Wörtern wiedergegeben. ( vgl. Hofmann, S. 14)
<http://www.filmportal.de/sites/default/files//EC909D0310ED4F08BBEA11B0E1200CAF_
Das_Eigene_und_da s_Fremde.pdf> 2 [0.03.2013]
12
Ebd., S. 6
13
Marina Münkler, geb. 1960 ist eine deutsche Literaturwissenschaftlerin. Nach dem Abitur studierte
sie vom
14
bis 1984 Germanistik, Philosophie und Theaterwissenschaften an der Johann Wolfgang
GoetheUniversität Frankfurt am Main. Sie beschäftigt sich unter mit Alterität und Interkulturalität,
legendarischem
Erzählen und mit der Gattungstheorie (Wikipedia-Personensuche:<http://de.wikipedia.org/wiki/Marina_
M%C3%BCnkler> [27.03.2013]
15
Münkler, Marina: Wie, wir ein Europäer waren,...'Fremdheitserfahrung in Vergangenheit und
Gegenwart.<http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=marina%20m%C3%BCnkler%20das%20fremd
e%3A% extraneus&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fweb.ev-
akademietutzing.de%2Fcms%2Fget_it.php%3FID%3D1062&ei=odBNUbyCE4KxPMuJgJAE&usg=AF
QjCNEu l9gFMWoZV_sNopHs68tqY6XlQ> [27.03.2013]
16
Michael Hofmann,geb. 1957, Professor für neuere deutsche Literaturwissenschaft an der Universität
Paderborn; Lehrtätigkeit in Nancy, Bonn, Lüttich, Herausgeber des Peter Weiß Jahrbuchs und des
Johnson Jahrbuchs, Forschungsschwerpunkte: Literatur der Aufklärung, weimarer Klassik,
interkulturelle Literaturwissenschaft (Hofmann, Mechael 2006: Interkulturelle Literaturwissenschaft:
eine Einführung. Paderborn: Wilhelm Fink Verlag, S. 5)
15
Die erste und ,,grundlegende Bedeutung" lässt sich laut ihm wie folgt erläutern:
,,Fremd ist, was außerhalb des eigenen Bereichs vorkommt. Hier ist also
ein typografischer Aspekt entscheidend, der auch in der Etymologie des
deutschen Wortes deutlich wird: ahd. ,,fremd" hatte die Bedeutung ,, fern".
Fremdheitserfahrungen haben also zu tun mit dem Auszug aus der
vertrauten Umgebung, mit Reise, Eroberung, Kolonialisierung, auch mit
Kriegszügen. Der ,,Fremde" in diesem Sinne ist der von weit her
Kommende, auf den in den wichtigen europäischen Sprachen die Wörter
,, externum", ,,peregrinum", ,,foreigner" und ,,étranger" verweisen
17
.
Da verbindet Hofmann die Fremdheit mit der Verwechslung aus der vertrauten Welt.
Die zweite Bedeutung des Wortes ,,Fremd" formuliert Hofmann wie folgt:
,,Fremd ist, was einem anderen gehört, wobei in diesem Verständnis auch
der Aspekt der Nationalität eine wichtige Rolle spielen kann. Im
Lateinischen und Englischen werden in diesem Zusammenhang die
Wörter ,,alienus" und ,,alien" gebraucht"
18
.
Charakteristisch für diese Bedeutung ist, dass Hofmann das Wort ,,Fremd" mit
Nationalität und Zugehörigkeit in Einklang bringt, d. h., was dem anderen gehört,
gehört mir nicht und umgekehrt.
Nach Hofmann ist aber die dritte Bedeutung des Konzeptes ,,Fremd" die wichtigste
im Hinblick auf die Analyse. Sie lässt sich nach ihm wie folgt erläutern:
,,Fremd ist, was von fremder Art ist und als fremdartig gilt. Hier erscheint
das Fremde als das Unvertraute, als das, was in seiner Erscheinung und
möglicherweise auch in seinem ,,Wesen" als grundsätzlich verschieden
von dem Subjekt betrachtet wird, von dem die Bestimmung ausgeht. Im
Französischen und Englischen wird diese Facette der Fremdheit in sehr
glücklicher Weise jeweils mit einem Wort ausgedrückt, das dem die erste
17
Hofmann, Mechael2006: Interkulturelle Literaturwissenschaft: eine Einführung. Paderborn: Wilhelm
Fink Verlag, S. 14
18
Ebd., S. 15
16
Bedeutungsvariante ausdrückenden ähnelt, aber eben nicht mit ihm
identisch ist: ,,étrange", ,,strange""
19
Wenn man diese Bedeutungen liest, stellt man die Frage, ob das Fremde das
Gegenteil des ,,Eigenen" ist. Daher kann man sagen, dass das Eigene bedeutet, alles
was dem Einzelnen gehört. Es sei denn, zu seiner Umgebung, zu seiner Nation.
In diesem Rahmen nennt Hofmann verschiedene Facetten des Fremden bzw. der
Erfahrung mit Fremdheit im Zusammenhang mit dem Eigenen.
Die ,,sicherlich einsichtigste" Facette der Erfahrung von Fremdheit, das Fremde als
das noch Unbekannte, begegnet uns laut Hofmann in dem Fremden als dem noch
Unbekannten, dem noch Bewussten. Da kann das Fremde vertraut werden und zur
Bereicherung des Eigenen beitragen (vgl. Hofmann 2006, S. 17). Eine andere Form
der Fremdheitserfahrung ist nach Hofmann ,,das Fremde als das Unbekannte
Drinnen". Diese Form bezieht sich auf die unbekannten Personen, die in einem
vertrauten Raum eines Menschen auftauchen. Ihre ,,Aufnahme" nach Hofmann
scheint ein kulturelles und soziales Problem zu sein (vgl. Hofmann 2006b, S. 18).
Das Fremde nach Hofmann könnte auch auf ,,das verdrängte Eigene" verweisen.
Dieser Form nach bezieht sich das Fremde auf eine ,,Entfremdungs-Erfahrung" der
Moderne und bedeutet ihm zufolge, dass der Mensch sich selbst fremd werden kann.
Da können die Menschen die Fremdheit der anderen akzeptieren (vgl. Hofmann,
2006 c, S. 18f).
,,Fremdheit, um mit den Worten von Senocak zu sprechen, begegnet uns
nicht nur in anderen, sie beginnt im eigenen Haus als Fremdheit meines
Selbst oder als Fremdheit unserer Selbst. Traditionell gesprochen handelt
es sich um eine intersubjektive Fremdheit im Gegensatz zur inter-
kulturellen Fremdheit (...)"
20
.
Neben diesen Formen der Fremdheitserfahrungen nennt Hofmann auch vier andere:
Fremdheitsaspekte als Resonanzboden des Eigenen, Fremdheit als Gegenbild,
Fremdheit als Ergänzung und Fremdheit als Komplementarität.
19
Ebd., S. 19
20
Ebd., S. 19
17
Der Begriff "fremd" umfasst, meines Erachtens, alles, was nicht zu meinem
Kulturkreis und/oder zu meiner Nation gehört. Es könnte eine Person, ein Gefühl, ein
Ort oder eine Kulturkomponente sein. In diesem Sinne ist mir das Fremde
unbekannt. In diesem Zusammenhang stellt sich die folgende Frage: soll das Fremde
fremd bleiben oder kann vertraut werden? Einerseits kann das Fremde eine Funktion
der Ergänzung und der Entfaltung der Eigenheit haben. Es hängt nur davon ab,
inwieweit der Mensch in der Lage ist, das Fremde für sich entdecken und dadurch
sich über Selbständerungen anzueignen. Da ist die Bereitschaft des Menschen von
großer Bedeutung. Andererseits kann man nicht von einer Faszination mit dem
Fremden sprechen, weil das Fremde, also das Neue und das Ungewohnte als
bedrohlich scheint und kann zum Kulturschock führen.
2.2.3. Eigene Einstellung:
Im Folgenden geht es um meine eigene Einstellung zu den oben genannten
Begriffen Da stellen sich folgende Fragen:
Was ist meine Identität? Wer bin ich? Worauf bezieht sich dieses ,,Ich"? und nicht
zuletzt was ist der/das/die Andere für mich?
Zuerst und nach der Suche der Definition von Identität habe ich sehr viele
Erläuterungen von einigen Wissenschaftlern gefunden. Ich stelle fest, dass dieser
Begriff sehr vieldeutig ist. Viele Definitionen scheinen mir sehr subjektiv als objektiv
zu sein.
Für mich bezieht sich meine Identität auf die Entwicklung meiner Persönlichkeit. Sie
ist ein langer Prozess, der unser Leben im Allgemeinen beeinflusst. Dieser Prozess
dauert von meiner Geburt bis zu meinem Tod. Schon als ungeborene Kinder werden
wir von den Launen und der Gesundheit unserer Mütter beeinflusst und auch auf sie
Einfluss nehmen. Mein Identitätsprozess bzw. die Entwicklung meiner Persönlichkeit
wird dann durch mehrere Personen, Umgebungen und anderen Dingen bestimmt.
Es geht um Dinge, die ich schon vorher wusste und/oder deren ich mir nicht bewusst
war. Damit ich nicht nur theoretisch spreche, möchte ich eine kurze Passage aus
meinem Leben schildern, die meiner Meinung nach die Entwicklung meiner Identität
darstellt:
18
Ich war 13 Jahre alt als ich aus meinem Elternhaus und meinem Dorf in die Stadt
Fes umgezogen bin. Ich wohnte bei meiner Großmutter und meinem älteren Bruder.
Es war die Notwendigkeit um weiterlernen zu können, denn auf dem Dorf gab es
keine Möglichkeit sich weiter zu bilden. Mein Umzug an sich war eine Entscheidung,
die mein bisheriges Leben geprägt hat.
Mein Leben in der Stadt war in den ersten Monaten was die Schule und auch die
Umgebung betrifft eine große Umstellung. Das Chaos in der Stadt war mit dem stillen
Dorfleben nicht zu vergleichen. Die Lehrer und die Mitschüler beeinflussten mich
positiv wie negativ. Aus psychischer Sicht gesehen hatte ich Gefühle wie Ent-
fremdung und Angst aber auch Neugier. Auch diese Gefühle waren von großer
Bedeutung.
Es bestätigt sich die Tatsache, dass unsere Umgebung einen großen Einfluss auf die
Entwicklung unserer Identität hat.
Auch andere Faktoren, die in Bezug auf den Prozess der Identitätsentwicklung des
Menschen von großer Bedeutung sind, sind die Familie und die Freunde.
Ich musste mich als erstes an meine Großmutter gewöhnen, die die Rolle der Mutter
übernahm. Ihre Hilfsbereitschaft und Unterstützung war für mich von großer
Bedeutung. Die Sorge meiner Großmutter um mich hat mir jedoch Einschränkungen
gesetzt die sich auf meine Freiheit und Freizeitbeschäftigungen ausgewirkt haben.
Die Beziehung zu meinem älteren Bruder hat sich kontinuierlich entwickelt. Ich habe
am Anfang viel Wert auf seine Meinung gelegt und so sah ich ihn als mein Vorbild
anstatt des Vaters.
Daraus lässt sich konstatieren, dass sowohl die Erziehung im Elternhaus als auch in
der Schule auf uns psychisch, beruflich und privat Einfluss hat. Im Bezug auf die
Freunde lag die Schwierigkeit darin, neue Freunde zu finden, die zur selben
Umgebung oder in dieselbe Klasse gehören.
Meines Erachtens sind die Schwierigkeiten und die Entscheidungen für den Weg der
Kern des Problems im Bezug auf die Identitätsentwicklung des Menschen. Wenn der
auserwählte Weg zum Erfolg, Entfaltung und Entwicklung des Ichs führt, kann man
von einer positiven Entwicklung des eigenen Ich sprechen. Diese positive
Entwicklung verstehe ich als Bereicherung meines eigenen Ich. Sind aber die
Misserfolge, die Demütigungen und der Bruch zwischen dem Eigenen und dem
Fremden das Ergebnis jeder Entwicklung, dann spricht man von einer negativen
Entwicklung. In diesem Fall könnte die Identitätsentwicklung auf der einen Seite zu
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Erstauflage
- Erscheinungsjahr
- 2013
- ISBN (Paperback)
- 9783959930673
- ISBN (PDF)
- 9783959935678
- Dateigröße
- 706 KB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Université Mohammed V Rabat – Interkulturelle Germanistik
- Erscheinungsdatum
- 2018 (Juni)
- Note
- 2,0
- Schlagworte
- Islam Interkulturalität Kulturalität Filminterpretation Burhan Qurbani Muslime Identität
- Produktsicherheit
- BACHELOR + MASTER Publishing