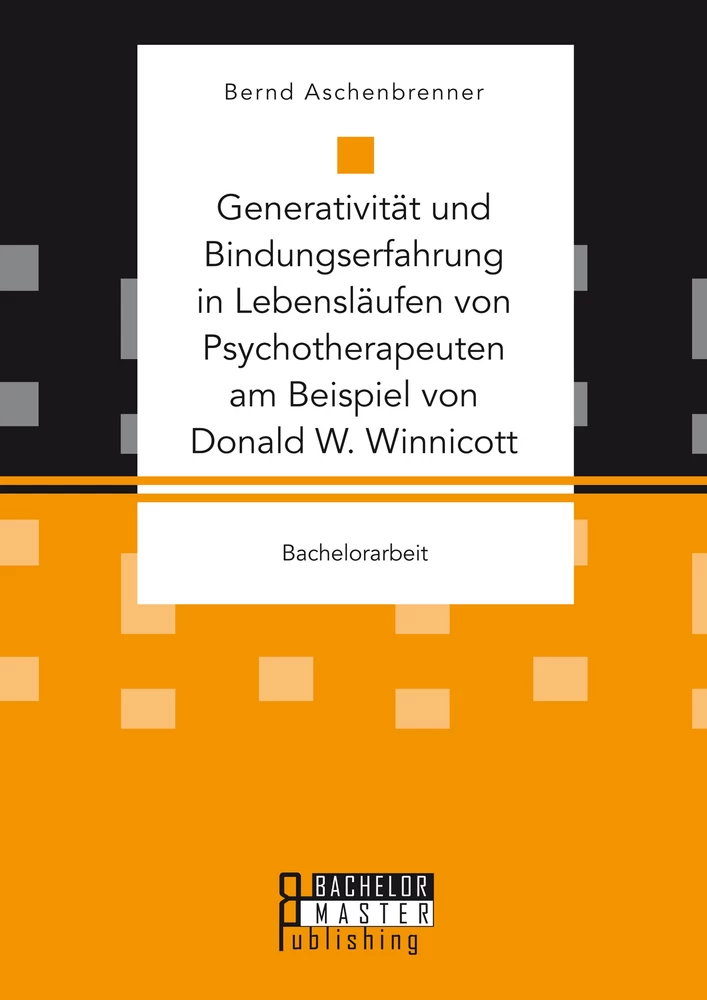Generativität und Bindungserfahrung in Lebensläufen von Psychotherapeuten am Beispiel von Donald W. Winnicott
©2018
Bachelorarbeit
55 Seiten
Zusammenfassung
Künstlern wird oft eine psychische Prägung durch frühe Kindheitserlebnisse und anschließende kreative Verarbeitung nachgesagt. Bei Wissenschaftlern sieht eine fundierte Auseinandersetzung mit Biographie und theoretischem Werk meist anders aus. Gerade bei psychotherapeutisch tätigen Ärzten, Pädagogen, Psychologen und weiteren verwandten Fachgruppen ergibt sich eine forschungsrelevante Verbindung, da sich diese Wissenschaftler sowohl theoretisch als auch praktisch direkt mit der psychischen Entwicklung über den Lebenslauf hinweg beschäftigen.
Da es in dieser Untersuchung nicht allein um die reine Verarbeitung von Bindungsmustern in der frühen Kindheit gehen soll, wird im psychotherapeutischen Feld die reflektierte Form eines generativen Bandes erörtert, das von beispielhaften Forschern theoretisch verarbeitet wurde, um prospektive Theoreme der Erziehung, Therapie und Bildung der nächsten Generation weiterzugeben. Hierbei werden sowohl Fragestellungen der Biographie- und Lebenslaufforschung miteinbezogen, als auch bindungstheoretische Erkenntnisse zum Begriff der Generativität im Lebenszyklus, zur Adoleszenz, wie zu zeitgenössischer Kreativitätsforschung.
Paradigmatisches Beispiel für die Fusion dieser Entwicklungen ist der Lebenslauf und das Werk des Kinderarztes und Psychoanalytikers Donald W. Winnicott, von dem ein biographisches Fragment aus dem Nachlass in Bezug auf die Sinndimensionen von Generativität und früher Bindungserfahrung nach Ulrich Oevermanns Methode der Objektiven Hermeneutik analysiert wird.
Da es in dieser Untersuchung nicht allein um die reine Verarbeitung von Bindungsmustern in der frühen Kindheit gehen soll, wird im psychotherapeutischen Feld die reflektierte Form eines generativen Bandes erörtert, das von beispielhaften Forschern theoretisch verarbeitet wurde, um prospektive Theoreme der Erziehung, Therapie und Bildung der nächsten Generation weiterzugeben. Hierbei werden sowohl Fragestellungen der Biographie- und Lebenslaufforschung miteinbezogen, als auch bindungstheoretische Erkenntnisse zum Begriff der Generativität im Lebenszyklus, zur Adoleszenz, wie zu zeitgenössischer Kreativitätsforschung.
Paradigmatisches Beispiel für die Fusion dieser Entwicklungen ist der Lebenslauf und das Werk des Kinderarztes und Psychoanalytikers Donald W. Winnicott, von dem ein biographisches Fragment aus dem Nachlass in Bezug auf die Sinndimensionen von Generativität und früher Bindungserfahrung nach Ulrich Oevermanns Methode der Objektiven Hermeneutik analysiert wird.
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
9
Rekonstruktion latenter Sinndimensionen in der Biographie zeigen des Spannungsfeld in
Hinblick auf die Theorie. Zentral ist, dass die Untersuchung der Latenz dieser Erzählungen
vom Subjektiven zum Objektiven hin wechseln und Muster verdeutlichen, die generalisierbar
sind.
10
2. Theorie: Biographie, Bindungserfahrung und Generativität
Im nun ausgeführten Theorieteil wird die gewählte Form der qualitativen Biographiefor-
schung mit den Definitionen zur Bindungstheorie, zur Generativität und zur Kreativität gelegt.
Dies steht in Beziehung mit verschiedenen Forschungsrichtungen, die grundlegend für die
Auswertung anhand der Objektiven Hermeneutik notwendig sind.
2.1 Forschungsstand qualitative Biographie- und
Lebenslaufforschung
Auch wenn der Fokus auf der Biographieforschung mit Mitteln der objektiven Hermeneutik
liegen wird, muss im Folgenden der Forschungsstand aufgearbeitet werden. Das weite Feld
der Biographieforschung geht insgesamt vom ,geschriebenen Leben` aus (griech.: bios =
Leben, graphein = schreiben) (vgl. Böhm 2005, S. 102). Die Herangehensweise stellt in
Abgrenzung zu rein daten- und faktenverarbeitendem Vorgehen die interpretative und
deutungsbasierte Interpretation und Auswertung eines Lebenslaufs in den Forschungsfokus
(vgl. ebd., S. 102-103). Der Grundsätzliche Untersuchungsgegenstand in der Biographiefor-
schung liegt einerseits in der individuell zu verstehenden Lebensgeschichte (die im Rahmen
subjekttheoretischer und psychologischer Fragestellungen ausgewertet wird) und anderer-
seits in der Untersuchung verschiedener Lebensverläufe, die typisiert und auf objektivierbare
Ereignisse des Lebens mehr im soziologischen Forschungsfeld angesiedelt sind (vgl. ebd.,
S. 103). Hier konzentriert sich die Biographieforschung allerdings auf individuelle Lebensge-
schichten, welche nicht quantitativ, sondern mit qualitativen Methoden ausgewertet werden,
in diesem Fall bildungswissenschaftlich-hermeneutisch (vgl. ebd.).
Unterschiede in der Biographie- und Lebenslaufforschung, aber auch Gemeinsamkeiten,
lassen sich viele finden. Ein Standardwerk zur Biographieforschung bietet beispielsweise
Fuchs-Heinritz, bei dem die Datengrundlage die Lebensgeschichte ist, die mit unterschiedli-
chen Erhebungsmethoden untersucht wird (vgl. 2000, S. 9). Dort geht es weniger um Inter-
viewauswertungen oder ähnliches, sondern es werden geschichtliche, narrative, erzählende
und autobiographische Dokumente oder Zeugnisse ebenfalls mit verschiedenen Methoden
ausgewertet (vgl. ebd., S. 10-11). Dabei geht Fuchs-Heinritz auf die Probleme der biographi-
schen Forschung zwischen subjektiver und objektiver Perspektive ein (vgl. ebd., S. 141ff),
sowie der Frage nach der qualitativen und quantitativen Forschung (ebd. S. 145ff), die
zwischen dem Einzelfall und verallgemeinerndem Vorgehen entscheidet, um allgemein
generalisierbare Muster herzustellen (vgl. ebd. S. 149). Die objektive Hermeneutik steht auch
11
hier im Mittelpunkt einer anschlussfähigen und allgemeinen Interpretationsmethodik der
Sozialwissenschaft (vgl. ebd., S. 159).
Dieses Vorgehen unterscheidet sich von anderen Richtungen, wie die von Alheit, der sich
zum Beispiel von der rein soziologischen Perspektive nähert und bei dem das Wiederer-
scheinen alltäglichen Verhaltens in der Biographie quantitativ nachweisbar geschieht, was
sich in beruflicher, familiärer oder politisch-religiös-ethnischen Zusammenhängen zeigt (als
Beispiel wird der Lehrer aus landwirtschaftlicher Familie gegeben, der noch immer den
bäuerlichen Habitus verkörpert) (vgl. 2005, S. 29). Hier werden eher Fragen im Rahmen
eines sozialen Aufstiegs erörtert, die generationale Veränderungen im beruflichen Rollenver-
halten haben oder im sozialen Abstieg, nicht aber im Grundhabitus (vgl. ebd., S. 29). Insge-
samt zeigt Alheit, dass die Mentalität sich in intergenerationalen Settings eher träge verhält
zwischen verschiedenen generalisierten und qualitativ auswertbaren Typen (vgl. ebd., S. 41).
Alheit versteht Autobiographie demnach allgemeiner und als ursprünglich verbunden mit
einer traditionellen Bildungshistorie, in welcher sich die Wichtigkeit von biographischen
Selbstbeschreibungen für die Zukunft herausstellt (vgl. ebd., S. 79).
Miethe und Roth weisen dementsprechend ebenfalls soziologisch motiviert auf die Wichtig-
keit der Einbeziehung der Bewegungsforschung (z.B. soziale Bewegungen) als einflussreich
auf die Biographie hin (vgl. 2005, S. 103). Mannheim betont beim Generationendiskurs den
generationell-kulturellen Zusammenhang, dass immer wieder neue Subjekte die kulturellen
Objektivationen übernehmen, alte Subjekte abgehen und jeder dieser Akteure nur an einem
bestimmten historischen Zeitabschnitt teilnimmt, sowie durch die kulturelle Übertragung und
die Kontinuität des Wechsels der Generationen an sich Gemeinsamkeiten und Unterschiede
in den Biographien entstehen (vgl. 1978, S. 43). Rosenthal legt anschlussfähig an die hier
getätigte Untersuchung den Fokus auf die Verschränkung individueller, kollektiver, histori-
scher und familiärer Zusammenhänge, die miteinander in Beziehung gesetzt werden müs-
sen, um den Einzelfall zu rekonstruieren (vgl. 2005, S. 61).
Köttig plädiert dem hinzufügend für ein methodenübergreifendes Vorgehen bei der Erhe-
bung, um Biographien differenziert und divers in Hinblick auf Gemeinsames und Unter-
schiedliches zu rekonstruieren, was sie als sogenannte Triangulation bezeichnet (vgl. 2005,
S. 81). Eine weitere Differenzierung dahingehend zeigt sich in der Divergenz zwischen
Subjektivität und Diskurs, die sich über die Theorien von Foucault ergibt, um Biographie-
Rekonstruktionen ausreichend herzustellen (vgl. Schäfer/Völter 2005, S. 181). Bruder stellt
ein so verstandenes autobiographisches Erzählen dem anschließend in einen Machtdiskurs,
in dem der Adressat und die Version einer biographischen Erzählung in Frage gestellt wird,
was auf Zusammenhänge postmoderner Fragmentierung und Inszenierung hinweist (vgl.
2003, S. 9). Bei den so motivierten Diskursforschungen ist jede sogenannte Wahrheit einer
12
Biographie, ob vom Individuum oder vom Historiographen erzählt, immer eingebunden in
einen weitläufigen Diskurs zwischen Subjekt und den jeweilig herrschenden Machtverhält-
nissen, denen man entweder zustimmen oder die man ablehnen kann (vgl. ebd., S. 30). Der
Begriff der Identität wird dabei in ein komplexes Konstruktionsverhältnis gestellt, das schwer
zu widerlegen, aber auch schwer zu belegen ist (vgl. Jaeggi 2003, S. 52).
Kohli geht hierbei strukturierter vor und unterteilt den Lebenslauf und die Biographie dreiteilig
in ein ganzheitliches Blickfeld ohne Abschnitte, eine differenzierte und prozessuale Historizi-
tät, sowie eine methodisch-theoretisch eher ent-objektifizierende, mehr subjektive Lesart der
einzelnen Fälle (vgl. 1978, S. 9). Hierbei betont er die gesamte Spanne des Lebenslaufs
entgegen einzelner Lebensabschnitte oder Stationen (vgl. ebd., S. 12-13). Im Sinne solcher
Lesarten wird gerade auf die Wichtigkeit der Transdisziplinarität der Methoden als Grund-
konstituente der qualitativen Forschung Wert gelegt (Bohnsack/Marotzki 1998, S. 7). Biogra-
phische Forschung steht damit wieder mehr in einer kulturanalytischen und textinterpretati-
ven Perspektive (vgl. ebd., S. 8-9). Auch Schäffer weist darauf hin, dass sich transgenerative
Übertragungen gerade bei gemeinsamer Mediennutzung und der sich generativ vermitteln-
den Medienkompetenz bemerkbar machen, was auch in pädagogischen Konzepten wirksam
wird (vgl. 1998, S. 45). Die Verbindung von erzählenden Elementen mit Lerneffekten ist
gerade sozial eng verankert, was wissenschaftlich adäquat mit pädagogisch-biographischen
Forschungen herausgearbeitet werden kann (vgl. Ecarius 1998, S. 148).
Die hier vorgenommene Untersuchung der Kindheit aus biographisch-textlicher und theoreti-
scher Perspektive ist deswegen für das Forschungsvorhaben so zentral, da hier Kinder
schon als erlebende Subjekte der eigenen Biographie betrachtet werden, die in einer zeitlich
endlichen Rahmung eines speziellen Biographieabschnitts liegt und individuell ausdifferen-
ziert werden muss (vgl. Behnken/Zinnecker 1998, S. 156). In diesem Sinn wird der Fokus auf
eine so zu verstehende Kindheit gelegt, die als eigener Lebensabschnitt betrachtet wird, als
vorausgehender Abschnitt zur eigenen Biographie und als grundlegende Fundierung und
Prägung des kommenden Lebens (vgl. ebd., S. 159). Der Lebensabschnitt der Kindheit wird
damit zu einer Blaupause für die kognitiven Leistungen, die Fundierung der Persönlichkeit,
sowie für die soziale und emotionale Entwicklung (vgl. ebd., S. 160). Behnken und Zinnecker
stellen diese Forschungsfragen direkt in eine psychoanalytische Traditionsbildung, wo die
frühe Kindheit als Grundmuster für spätere Entwicklungen angesehen wird, sowohl in ihrer
pathologischen, als auch in ihrer entwicklungstheoretischen und nicht-pathologischen
Perspektive, welche direkt mit Hypothesenbildungen der Bindungstheorie von Bowlby oder
den Forschungen von Ainsworth in Zusammenhang gebracht werden (vgl. ebd.). Aus dieser
Perspektive sind die Abhängigkeiten zwischen den Generationen also einerseits durch
13
Biographien, andererseits durch Bindungsverläufe gekennzeichnet, die sich lebenslang
fortbilden, aber auch stagnieren können (vgl. Kade/Seitter 1998, S. 178).
Bezieht man sich in dem Sinne weiter auf eine familiengeschichtliche Perspektive, werden
solche Biographien untersuch- wie analysierbar und offenbaren in Rekonstruktionen der
Familiendynamik ihren latenten Sinn (vgl. Hildenbrand 1998, S. 222). Bohnsack und Nohl
weisen als zukünftige Forschungsfokussierung deshalb auf die Wichtigkeit der Betrachtung
und Untersuchung von Bildung und Ausbildung hin, was sich wiederum soziologisch moti-
viert mit biographischen Forschungen zu Typenbildungen erweitern lässt (vgl. 1998, S. 279-
280). Eine solche transdisziplinäre Perspektive des Zusammenhangs zwischen Biographie
und Lernen wird dahingehend wichtig, da sich über die Narration und das Erzählen biogra-
phische Entwicklungsmöglichkeiten folgern lassen (vgl. Ecarius 1999, S. 102-103).
Passend hierzu konzentriert Boothe vom intersubjektiven Standpunkt aus, dass das Ziel der
Autobiographie immer auf ein Gegenüber gerichtet ist und damit von Grund auf in einem
generativen Verhältnis steht (vgl. 2003, S. 55-56). Dieser Standpunkt setzt allerdings nicht
nur zwangsweise auf harte Fakten der Biographie, sondern arbeitet dabei auch im Sinne
Freuds das latent Biographische heraus (vgl. ebd., S. 60-61). Hierbei muss man sich aller-
dings auf eine mehr symbolisch zu verstehende Untersuchungsebene begeben (vgl. ebd., S.
65). Hat man sich darauf geeinigt, kann man anschließend den Biographiebegriff selbstrefle-
xiv erweitern und nicht nur das Leben betrachten, sondern mit Scheffer die biographischen
Tendenzen untersuchen, die auch bei Wissenschaftlern gelten und sich in den Theorien der
jeweiligen Wissenschaft ebenfalls auf emotionale und kreative Art und Weise niederschlagen
(vgl. 2003, S. 89-90).
Doch das gilt nicht grundlegend. So plädiert Rudlof in diesem Feld für eine sich zurückneh-
mende Biographisierung, die weniger Wert auf eine letztgültige Wahrheit legt, als vielmehr
das dynamische Verhältnis der Biographie in den Blick nimmt, das zwangsweise subjektiv
und sozial bestimmt ist (vgl. 2003, S. 135). Gerade in Verbindung mit Forschungswerk und
Biographie empfiehlt sich so ein Vorgehen, um nicht die wissenschaftlichen Standards mit
biographischen Deutungen zu untergraben. Billmann-Mahecha zeigt sehr differenziert, wie
ein adäquates Vorgehen in dieser Gestalt gelingen kann und betont, dass gerade in der
Wissenschaftsgeschichte die Untersuchung des biographischen Anteils der Forscher im
Werk und ihren Theorien sozialgeschichtlich, historisch und lebensweltlich einbezogen
werden kann und muss, um wissenschaftliche Theorien zu analysieren und ihre Entstehung
zu verstehen und zu untersuchen (vgl. 2003, S. 272-273). Dabei fokussiert sie die methodi-
sche Herangehensweise auf eine auktoriale Intention im Text und die Aussage des Autors,
eine textuelle Funktion, die sich aus dem Text selbst durch methodische Forschung ergibt,
14
sowie die intentionale Lesart des Forschers, der sich mit seinen eigenen Fragestellungen an
den Text herannähert (vgl. ebd., S. 261).
Aus diesem Grund wird hier ebenfalls als differenzierte Methode die Objektive Hermeneutik
gewählt, da die latenten Sinndimensionen mit ihr am besten herausgearbeitet werden
können, gerade weil es immer eine grundsätzlich fiktive Komponente von Biographien gibt
und die biographische Komponente des fiktionalen Erzählens insgesamt einbezogen werden
muss (vgl. Rath 2003, S. 316). Timmermann weist so nach, dass sich auf der latenten Ebene
zum Beispiel biographische Traumata dergestalt weitervererben und in der generativen
Folge von den Großeltern bis hin zu den Enkeln in zirkulärer Folge fortpflanzen (vgl. 2011, S.
267). Hierbei wurde ebenfalls erforscht, dass generative Übertragungen mit emotionalen
Umständen in Verbindung stehen (vgl. ebd., S. 267-268). Methodisch setzt Timmermann
dabei auf eine biographische Rekonstruktion, welche sich zwar mit Interviews als Datenma-
terial bediente, aber auf Grundlage dessen eine aus der Objektiven Hermeneutik kommende
sequentielle Analyse der strukturellen Inhalte zwischen Vergangenheit und Gegenwart als
passend erachtete (vgl. ebd., S. 269-270).
Auch Wohlrab-Sahr konzentriert sich unter anderem auf eine Verwendung der Objektiven
Hermeneutik anhand von biographisch angelegten Interviewauswertungen, um sich auf
spezielle herauszuarbeitende Probleme und latente Themen zu beziehen und vor allem
diese herauszuarbeiten, obwohl sie nicht direkt kommuniziert werden (vgl. 2005, S. 140-
142). Marotzki verweist auf weitergehende tiefenstrukturelle Modelle der Objektiven Herme-
neutik und psychoanalytischer Textinterpretationsverfahren, welche beide in kollektiven
Forschungsergebnissen die latenten Sinndimensionen von Biographien herausarbeiten (vgl.
1999, S. 122-123). Diesem Weg wird die hier angelegte Untersuchung ebenfalls folgen.
Der spezielle Fokus liegt im Blick auf die prägende Lebensphase der Kindheit, da ange-
nommen wird, dass sich spätere Theoriebildungen bei den Wissenschaftlern hierdurch
untersuchen lassen. Wie Grunert und Krüger hinweisen, hat eine bildungswissenschaftlich
geprägte Biographieforschung in erster Linie damit zu tun, dass autobiographische Daten
dahingehend untersucht und ausgewertet werden, um die Prägung kindlicher Erfahrungen
auf die bildungsgeschichtliche Entwicklung Erwachsener zu zeigen (vgl. 1999, S. 228). Folgt
man diesem grundsätzlich generativen Verhältnis, muss man allerdings auch miteinbezie-
hen, dass Prägungen in der Schule ebenfalls hierzu gehören, die von pädagogischer Seite
(ob didaktisch oder methodisch) unternommen werden und oft eine folgenreiche biographi-
sche Entwicklung bedingen (vgl. Reh/Schelle 1999, S. 387). Cloer verweist in diesem Sinn
insgesamt auf generative Folgeerscheinungen im familialen Prozess (Sprache, ästhetische
Bildung, etc.), die von der älteren auf die jüngere Generation nicht unbedingt bewusst, so
aber doch in einem untersuchbaren Gefälle weitergegeben werden und eher autobiogra-
15
phisch zu folgern sind, als rein bildungstheoretisch (vgl. 2005, S. 156). Dieser Form der
dynamischen Biographik wird hier mit den Ausführungen von Erikson und King in Kapitel 2.3
zur näher definierten Generativität gefolgt.
Dabei ist zusätzlich der Stellenwert von intergenerativer Bildungsweitergabe im familiären
Kontext einzubeziehen, welcher nicht immer glückt und sich auch in anderen Kontexten, als
in den von der älteren Generation ursprünglich gedachten, fortsetzen kann (vgl. Büchner
2005, S. 178). In Bezug auf Wilhelm Dilthey und die ursprüngliche Hermeneutik erscheint
eine pädagogisch geprägte Biographieforschung mit Blick auf das Subjekt jedoch immer in
einen solchen Prozess eingebunden, der sich nicht nur auf objektive Ergebnisse zentrieren
kann, sondern als ganzheitliches Gebilde zwischen Bildung, Erziehung und Lernfähigkeit in
Betracht gezogen werden muss (vgl. Son 1997, S. 198-199). Biographisch geprägtes
Datenmaterial (Autobiographie, Lebensläufe, Interviews, etc.) liefert für die Pädagogik
deshalb sinnvoll auswertbare Forschungsquellen (vgl. ebd., S. 205), da das Gedächtnis und
damit einhergehend das Bewusstsein in seiner autobiographischen Funktion ein wesentli-
cher Bestandteil des psychologischen Selbstverständnisses von Identität und Subjektivität ist
(vgl. Pohl 2007, S. 12). Dabei steht ein solcher autobiographischer Speicher zwar in einem
dynamischen und somit veränderlichen Verhältnis, bleibt allerdings auch anfällig für Trauma-
ta und andere Beeinträchtigungen (vgl. ebd., S. 12).
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Biographieforschung ein weites Feld ist, das sich
trotz allem in einer gemeinsamen Struktur bewegt, die man einerseits quantitativ und eher
soziologisch auswerten kann, andererseits mehr bildungswissenschaftlich-psychologisch.
Die hier verwendete qualitative Methode wird im verwendeten Fall die Objektive Hermeneutik
sein. Die Zusammenhänge einer so angewandten qualitativen Biographieforschung werden
im Folgenden mit Generativität und frühbiographischer Bindungserfahrung eingebettet.
2.2 Frühe biographische Bindungserfahrungen anhand der
Bindungs-, Objektbeziehungs- und Mentalisierungstheorie
Wie biographische Erfahrungen mit Bindungspersonen in der Entwicklung theoretisch
betrachtet werden können, soll im folgenden Teil geklärt werden. Ein geeigneter Rahmen für
die hier zu untersuchenden Forscherlebensläufe ist die Bindungstheorie von John Bowlby.
Diese wird anhand der aktualisierten Darstellungen von Peter Fonagy betrachtet, da dieser
sowohl die ursprünglichen Grundlagen bei Bowlby, als auch das auf zeitgenössischem
Forschungsstand stehende Konzept der Mentalisierung miteinander verbindet (vgl. Taubner
2015, S. 166). Die bildungswissenschaftliche Relevanz ergibt sich aus dem großen Einfluss
16
der Mentalisierung im akademischen Feld, welche in der aktuellen psychodynamischen
Forschung von nachhaltigem Einfluss ist (vgl. ebd.).
Fonagy belegt im Sinne der Bindungstheorie den zentralen Einfluss von Beziehungsprä-
gungen in der frühen Kindheit hinsichtlich der psychischen Strukturbildung, womit die
Bindungseffekte in Bezug auf eine bestimmte Bindungsperson eine nachweisbare Auswir-
kung auf die Sozialisation erhalten (vgl. 2009, S. 39-40). Fonagy bettet dies in psychoana-
lytische Forschungen ein, indem er die Objektbeziehungstheorie verwendet, bei der
umfassende Fragestellungen der Entwicklung miteinbezogen werden (vgl. S. 90). Die
Ursprünge der Objektbeziehungstheorie liegen bei ihrem wichtigsten Vertreter W. R. D.
Fairbairn, der sie als komplexe Wechselbeziehung zwischen Säugling und Mutter definiert,
die mit der Suche und Trennung nach einem versorgenden und sorgenden Objekt verbun-
den sind (vgl. 2007, S. 275).
Da diese Wechselbeziehung von Mutter und Kind nicht immer ausreichend funktioniert,
konnte in näheren Untersuchungen in der Kleinkind- und Säuglingsforschung nachgewiesen
werden, dass Kinder, die bei depressiven Müttern aufwachsen, in den meisten Fällen eine
ungenügende Beziehungsfähigkeit entwickeln, da von diesen Müttern aufgrund ihrer Erkran-
kung die Affekte des Säuglings nicht ausreichend erwidert und gespiegelt werden (vgl.
Fonagy 2009, S. 128). Aufgrund dieser Erkenntnisse betonte Daniel N. Stern grundlegend
die ganzheitliche Beobachtung von Mutter und Kind auf einer zusammenhängenden Ebene,
da in diesem geschlossenen System die Mängel der frühen Entwicklung entspringen (vgl.
1995, S. 203). Das hat allerdings weniger mit einer personenzentrierten Ursachenforschung
zu tun, sondern betrifft vielmehr das Verständnis der zusammenhängenden Beziehungsein-
heit von Mutter und Säugling, die man in einem dynamischen Austauschverhältnis verstehen
muss (vgl. Stern 1995, S. 3, vgl. Fonagy 2009, S. 142).
Die Bestätigung dieser Forschungsergebnisse durch die Bindungstheorie führte zum Beleg,
dass die Funktion des gesamten psychischen Bewusstseinssystems nur sichergestellt sein
kann, wenn ein Kleinkind eine ausreichend gute Beziehungsrepräsentation erfährt (vgl.
Fonagy 2009, S. 129). Von Seiten der psychoanalytischen Forschung heißt dies, dass die
grundlegende Leistung einer emotionalen Beziehungsarbeit erst die überlebensnotwendigen
Bewusstseinsstrukturen im Gedächtnis neu verankern kann (vgl. Fonagy 2009, S. 140). Über
die Methodik der psychotherapeutischen Behandlung kann in diesem Sinn der Weg eines
mentalen Korrektivs gewährleistet werden, um bindungstheoretisch gesprochen und Bowlby
folgend eine notwendige ,sichere Basis` zu schaffen (vgl. Fonagy 2009, S. 142, S. 156, S.
80), im englischen Original ,,secure base" (Bowlby 1980, S. 182) genannt.
17
Diese Beziehungsdynamik erfuhr eine Weiterentwicklung durch neuere wissenschaftliche
Forschungsfelder und wurde erfolgreich und anschlussfähig mit der Begrifflichkeit der
Mentalisierung erweitert und weitergehend untersucht (vgl. Fonagy et al. 2004, S. 9). Die
wissenschaftliche Verwurzelung der Mentalisierung liegt sowohl in der Psychoanalyse, in der
Theory-of-Mind (ToM) (vgl. Taubner 2015, S. 15), wie auch in der Bindungstheorie (vgl.
Fonagy 2009, S. 178, S. 201). Die daraus erwachsene akademische Akzeptanz und breite
Rezeption lieferte die Entwicklungswissenschaft, durch welche die Mentalisierung die
Anschlussfähigkeit an empirische Forschungsmethoden erfahren konnte (vgl. Taubner 2015,
S. 166). Auch eine Beeinflussung der psychotherapeutischen Praxis fand durch das Konzept
der Mentalisierung nachhaltig statt (vgl. Taubner 2015, S. 165-166).
Mentalisierung wird kurz gesagt als kognitive und soziale Fähigkeit verstanden, wenn man
in der Lage ist, sich die eigenen mentalen Gefühle in einem anderen vorzustellen (vgl.
Taubner 2015, S. 15). Wenn ein Kind also lernt zu verstehen, welche eigenen Gefühle es
fühlt, dann kann sich bei ihm die Vorstellung und Fähigkeit entwickeln, wie ein Gegenüber
sich fühlt und das Kind kann das eigene Verhalten im Verhalten des Anderen interpretieren
und einschätzen (vgl. Taubner 2015, S. 15-16). Deshalb ist Mentalisierung eines der
ausschlaggebenden Kriterien jeglicher Realitätseinschätzung, Affektregulation und Selbst-
strukturierung (vgl. ebd., S. 16).
Eine so verstandene Form der Mentalisierung entwickelt sich zu einer sogenannten ,,Symbol-
funktion" (Fonagy 2009, S. 175), die es dem Kind ermöglicht auf verschiedenes Verhalten
emotional und sozial passend zu reagieren, um Emotionen wie Ärger, Freude oder Mitgefühl
(etc.) zu steuern und ein homogenes Verständnis seines eigenen psychischen Handelns
auszubilden (vgl. Fonagy 2009, S. 175). All diese Fähigkeiten werden als ,,innere Arbeitsmo-
delle (oder Beziehungsmuster)" (Fonagy et al. 2004, S. 370) verstanden, die sich allerdings
nur entwickeln können, wenn eine ausreichende Bezugsperson zur Verfügung steht, die das
Verhalten und die Wünsche des Kindes adäquat versteht und spiegeln kann (vgl. Fonagy
2009, S. 176).
Durch die Untrennbarkeit von Mentalisierungsfähigkeit und Bindungserfahrung zeigte sich
die zwangsweise Prägung der Schemata bei den Kindern, deren Verinnerlichung erst über
ihre primären Bezugs-, Bindungs- und Erziehungspersonen möglich wird (vgl. Fonagy 2009,
S. 109). Ist die Bindung zu diesen Bezugspersonen allerdings unsicher, inkohärent oder
diffus, folgen in den meisten Fällen Formen aggressiven Agierens und andere Verhaltensauf-
fälligkeiten (vgl. ebd.). Diese können sich auch schon bei einseitiger Mentalisierungsfähigkeit
entwickeln und Syndrome wie beispielsweise Hyperaktivität fördern, bei der das Kind die
notwendigen inneren Bedürfnisse nach Außen hin abreagiert (vgl. ebd., S. 110). Dies konnte
bei Untersuchungen von Heimkindern belegt werden (vgl. ebd., S. 55). Auf der Seite der
18
Bindungstheorie finden diese Mängel ihren Ursprung in einer nicht ausreichend ausgebilde-
ten Kompetenz der Affektregulation, die durch mangelhaft entwickelte Objektrepräsentatio-
nen entstanden ist (vgl. Taubner 2015, S. 15).
Der Begriff der Affektregulation wird von Allan N. Schore als psychobiologische Form der
Selbstorganisation definiert, die ausreichende Formen der Bindung erst garantiert und zu
produzieren in der Lage ist (vgl. 2009, S. 62). Die rechte Hirnhemisphäre ist nachweislich
von ausschlaggebender Bedeutung hierfür, weil auf dieser Hirnseite Emotionen verarbeitet
werden (vgl. ebd.). Bei einer unzureichenden Entwicklung und Ausbildung der rechten
Hirnhemisphäre, gibt es eine starke Beeinträchtigung der Mentalisierungsfähigkeit, die
dadurch fast unmöglich wird (vgl. ebd., S. 74). Gerade der Vollzug und die adäquate Verar-
beitung bestimmender und starker Affekte wie Zorn, Trauer, Freude, Lust, Hoffnungslosigkeit
oder Hoffnung (etc.) wird dann nahezu unmöglich (vgl. ebd., S. 74-75). Die Untermauerung
seiner Thesen leistet Schore damit, dass der hauptsächliche Organisationsmechanismus auf
der neuronalen Ebene nur mit einer guten Affektregulation funktioniert (vgl. ebd., S. 163). Die
Bindungstheorie versteht er deshalb als paradigmatische und wissenschaftlich fundierte
Theorie einer Vereinigung von Biologie und Psychoanalyse (vgl. ebd., S. 243).
Fasst man das zusammen, so zeigt sich, dass beim Säugling die Beziehungsfähigkeit
ursprünglich aus seiner neuronalen Organisation erwächst und resultiert (vgl. Schore 2009,
S. 290). Ein funktionales Bindungsverhalten ist deshalb auch für die Entwicklung des limbi-
schen Systems von ausschlaggebender Bedeutung (vgl. ebd., S. 311). Eine Neubesetzung
dieser fehlenden Beziehungserfahrungen kann nachfolgend erst in einer praktischen Be-
handlung mit psychotherapeutischen Methoden erfolgen, wo versucht wird diese nicht
entwickelten oder gestörten Strukturen zu reorganisieren (vgl. ebd., S. 317). Auf der theoreti-
schen Ebene dieser aktuellen Form des Bindungsverständnisses verdeutlicht sich damit die
Wichtigkeit einer ausreichend guten Bindungserfahrung, die durch die frühe Kindheit geprägt
wird und deshalb entwicklungsentscheidend für das spätere Erwachsenenleben und vor
allem die eigene Biographie wird. Festzuhalten für die hier vorgenommene Hypothese bleibt
damit, dass ausreichend gute Bindungen in der frühen Kindheit von entscheidender Bedeu-
tung für die Entwicklung und das Erwachsenenleben sind. Gerade wenn die Affekte des
Säuglings bei einer depressiven Mutter beispielsweise nicht adäquat erwidert werden,
prägen diese Erfahrungen die Entwicklung und die Biographie, was anhand des Beispiels
später verdeutlicht wird. Insgesamt sollte hier also gezeigt werden, dass über bindungstheo-
retische Erkenntnisse die Biographie nachhaltig geprägt wird, was auch für Forscher gilt.
19
2.3 Generativität und Möglichkeitsräume
Die Verbindung solcher missglückter Bindungserfahrungen zum Forscherlebenslauf wird nun
aufgezeigt. Zunächst ist wichtig, dass unzureichende Bindungserfahrungen in der Biographie
ihre weitreichende Prägung hinterlassen. Aus diesem Grund muss in Hinblick auf die reflek-
tierte Theorieentwicklung von Forschern im pädagogischen Feld der Begriff der Generativität
und seine Bedeutung für die Biographieforschung herausgearbeitet werden. Da es nicht
darum geht, dass sich solche Erfahrungen immer pathologisch entwickeln müssen, wird
außerdem gezeigt, dass sie trotzdem Einfluss auf die Biographie nehmen und bei Forschern
ein zusätzliches Agens in ihrer wissenschaftlichen Motivationsbildung sein können. Es zeigt
sich nämlich später am Beispiel, dass diese frühen Bindungserfahrungen bei Forschern ihre
theoretische Reflexion erfahren, die sowohl bewusst, als auch unbewusst bearbeitet wird.
Diese Reflexionsfähigkeit aufgrund solcher Bindungserfahrungen kann vielmehr noch, so die
These, im wissenschaftlichen Feld der psychologisch-pädagogischen Forschung inhärent als
generationale Möglichkeit verstanden werden, die eigenen Erfahrungen im Rahmen des
wissenschaftlichen Standards zu untersuchen und zu bearbeiten, um sie wissenschaftlich
weiterzugeben.
Was aber bedeutet eine solche Form der Generativität, die über die reine Weitergabe von
Normen und Werten hinausgeht? Zunächst wird das mit den Forschungen von Erik H.
Erikson untersucht. Für eine Begriffsdefinition der Generativität eignet sich Eriksons Theorie
besonders, da dieser mit seinen unterschiedlichen Phasen des Lebenszyklus ein Entwick-
lungsmodell geschaffen hat, bei dem gerade die Phase der Generativität sehr wichtig ist, da
sie als Gelenkstelle von ihm betont wird (vgl. 1973, S. 51). Erikson verdeutlicht, dass das
Subjekt zunächst ganz allgemein durch generative Erfahrungen in Bezug auf seine Grup-
penidentität eine Stärkung erfährt und diesen Zusammenschluss wiederum generativ über-
trägt (vgl. ebd.). Dies geschieht im Rahmen sozialer, subjektiver und historischer Organisie-
rung und Lebenswelt (vgl. ebd., S. 53). Dabei ist gerade die Beziehung des sogenannten
,Ur-Vertrauens` im Gegensatz zum misslungenen ,Ur-Misstrauen` verantwortlich für gelin-
gende und misslingende generativ sich fortführende Bindungserfahrungen (vgl. ebd., S. 63),
wie überhaupt das sehr subjektive Gefühl sich auf etwas oder jemanden verlassen zu
können (vgl. ebd., S. 74). Der Zusammenhang von Bindungstheorie und Auswirkungen auf
die Generativität wird hier also schon sehr deutlich.
Generativität steht bei Erikson aber auch eng mit dem Fortpflanzungswunsch aus Partner-
schaften in Beziehung und wird von ihm aus einem genetischen Ursprung verstanden, bei
dem sich das Bedürfnis und ein Verlangen nach generativen Zielen entwickelt (vgl. 1973, S.
117), was ebenfalls wieder mit bindungstheoretischen Positionen, wie den oben gezeigten,
20
zusammenhängt. Hierbei grenzt Erikson Generativität aber von reiner Elternschaft ab und
von solchen Begriffspaaren wie Kreativität oder bloßer Produktivität (vgl. ebd., S. 117).
Genauer erklärt Erikson Generativität mit einem eigenen Wissensdrang nach einer Generati-
onenerziehung wie -erzeugung, was insgesamt als Generationenschaffung oder -schöpfung
verstanden werden kann, die nicht nur in elterlicher Übertragung auf ein Kind stattfinden
muss, sondern weiter gefasst im Erzeugen allgemeinerer kreativ-erschaffender Potentiale
geschehen kann (vgl. ebd., S. 117). Diese Voraussetzungen können nun für das pädago-
gisch-psychologische Forschungsfeld, das sich mit der Entwicklung beschäftigt, angenom-
men werden. Erikson betont nämlich, dass dies eine universelle Struktur der Persönlich-
keitsentwicklung ist (vgl. ebd., S. 117-118).
Dabei ist es aber nicht ausreichend, dass jemand Kinder hat, sondern es kann Eltern durch-
aus zur Fähigkeit einer so verstandenen Generativität fehlen, was meist mit misslungenen
Kindheitserlebnissen zusammenhängt und nicht vorhandenem Selbstvertrauen wie Fremd-
vertrauen auf die nächste Generation (vgl. Erikson 1973, S. 118). In Eriksons Stufenplan der
Identitätsentwicklung im Lebenszyklus ist die 7. Stufe des Erwachsenenlebens direkt mit der
erfolgreichen Entwicklung von Generativität verbunden, die beim Nichtgelingen in Selbst-
absorption mündet (vgl. ebd., S. 150-151). Erikson stellt Generativität so in Zusammenhang
mit einem allgemeinen Gefühl für Verantwortung (vgl. ebd., S. 200). Schließlich definiert er
Generativität im Spannungsverhältnis zur Selbstabsorption auf einer Achse der beziehungs-
personalen Umwelt unter dem Oberbegriff des gemeinsamen Arbeitens (vgl. ebd., S. 214-
215). Auf einer Achse der sozialen Ordnung sieht er zeitaktuelle und traditionelle Tendenzen
und Moden der Erziehung, sowie auf einer psychosozial geprägten Achse Stichworte wie
Schaffenskraft oder Versorgung (vgl. ebd., S. 214-215).
Erikson bringt Generativität später noch einmal in Verbindung mit dem näher benannten
Gegensatzbegriff der Stagnation, wobei er auf einer psychosexuellen Phase die Prokreati-
vität anbringt, auf der Beziehungsebene die Gemeinschaft mit der Grundstärke der Fürsor-
ge, der Antipathie sowie der Ablehnung, auf der Ebene der sozialen Ordnung mit den
erziehungstheoretischen Moden, auf der ritualisierenden Bindungsebene mit dem Schöpfe-
rischen und letztlich auf der Ebene des Rituellen mit dem Autoritarismus (vgl. 1988, S. 36-
37). Erikson sieht Generativität so als wesentliche Kulturleistung des Menschen, der die
fürsorgende Ebene auf eine erziehungswissenschaftliche Ebene hebt und die Fürsorge
nicht nur für die eigenen Kinder, sondern als wichtiges Entwicklungsstadium der Mensch-
heit insgesamt betrachtet (vgl. ebd., S. 68-69). Generativität wird dann als ursprüngliche
und vor allem wissenschaftsinhärente Form von Kreativität und Produktivität verstanden,
um dem Generationenverhältnis zu dienen und dieses wertebasiert weiterzuentwickeln
(vgl. ebd., S. 68-69). Die Verbindung zum generationalen Agens eines Forscherlebenslaufs
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Erstausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2018
- ISBN (Paperback)
- 9783959930703
- ISBN (PDF)
- 9783959935708
- Dateigröße
- 1.1 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- FernUniversität Hagen – Bildungswissenschaften
- Erscheinungsdatum
- 2018 (Juli)
- Note
- 2,5
- Schlagworte
- Bindungstheorie Entwicklungspsychologie Psychotherapieforschung Biographieforschung Biografieforschung Kindheitsforschung Kindheit
- Produktsicherheit
- BACHELOR + MASTER Publishing