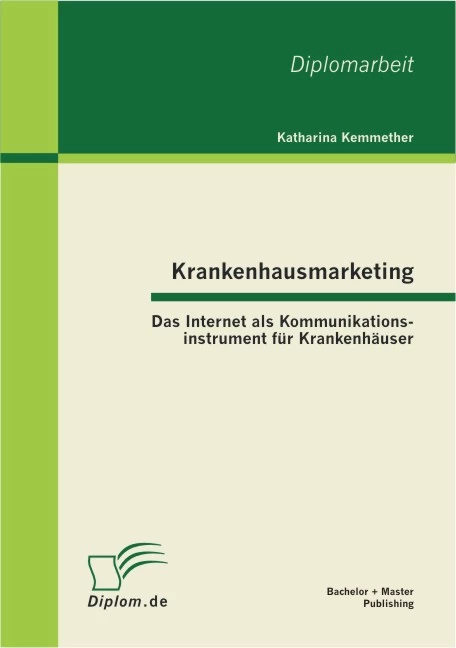Krankenhausmarketing: Das Internet als Kommunikationsinstrument für Krankenhäuser
Zusammenfassung
Es kommt zu einer Verweildauerverkürzung bei wachsenden Patientenzahlen und somit zu einer erforderlichen Anpassung von Organisationsprozessen. Diese Veränderungen beeinflussen auch die Marketing-Strategie eines Krankenhauses, da es zunehmend wichtiger wird, die richtigen Zielgruppen anzusprechen und diese über ein entsprechend abgestimmtes Angebot an das Unternehmen Krankenhaus zu binden.
Auch unter dem Aspekt eines drohenden Fachkräftemangels wird eine positive Darstellung des Unternehmens über das Internet immer wichtiger, damit potentielle Mitarbeiter auf das Krankenhaus aufmerksam gemacht und akquiriert werden können.
Somit zählt das Internet mittlerweile zu einer der wichtigsten Plattformen um das Leistungsangebot, den Service und herausragende Erfolge des Unternehmens zu kommunizieren. In der Praxis scheint das Medium Internet von Krankenhäusern jedoch vorrangig zur Darstellung der medizinischen Fachabteilungen zu dienen, ohne dass hierbei eine bestimmte Zielgruppe angesprochen wird.
Diese Studie analysiert 110 Internet-Auftritte bayerischer Krankenhäuser anhand des Kommunikationsmodells von Lasswell.
Das Ergebnis zeigt große Unterschiede in Gestaltungsweise, Aktualität und Inhalt.
Das Informationsangebot der Krankenhäuser im Internet scheint aber nicht nur deren Marketing-Verständnis widerzuspiegeln, sondern zeigt auch, dass diese Angebote als Indikator dafür gesehen werden können, welche Patienten von den jeweiligen Institutionen als bevorzugte Kundengruppen angesehen werden.
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
2.1.3 Marketing - Instrumente und Marketing - Mix
Unter Marketing-Instrumenten werden die konkreten „…Aktionsinstrumente [..] verstanden, mit denen am Markt agiert und auch reagiert werden kann, um gesetzte Ziele und daraus abgeleitete Strategien zu realisieren“ (BECKER 2005, 92).
In der Praxis verbreitet ist die Einteilung der Marketing-Instrumente in vier Instrumental-Bereiche (vgl. FRITZ/OELSNITZ 2006, 145). Diese »4Ps« bezeichnen hierbei die vier Gestaltungsmöglichkeiten »Product« (Produktpolitik), »Price« (Preispolitik), »Place« (Vertriebs- oder Distributionspolitik) und »Promotion« (Kommunikationspolitik) (vgl. MEFFERT/BRUHN 2003, 355; BRUHN 2004, 28; ESCH u.a. 2006, 35).
- Die Produktpolitik stellt hierbei den ersten Instrumentalbereich dar, worunter „…alle mit dem Produkt zusammenhängenden Maßnahmen [verstanden werden,] um […] bei den Käufern eine bessere Beurteilung zu erreichen“ (WEIS 2004, 115). Diese Maßnahmen sind „…nicht nur bei der Einführung neuer Produkte wichtig, sondern stellen Daueraufgaben des Marketing dar“ (KÜHN u.a. 2006, 185). Neben Produktinnovation, -verbesserung und -differenzierung zählen dabei auch Serviceleistungen, Verpackung, Namensgebung und die Planung des Sortiments zu den Entscheidungsbereichen der Produktpolitik (vgl. BRUHN 2004, 30).
- Als weiteres Marketing-Instrument zeigt sich die Preispolitik, auch als Konditionenpolitik oder Kontrahierungspolitik bezeichnet (vgl. PESCH 2005, 163), die „…alle Marketing-Maßnahmen [beinhaltet], die sich mit der Festlegung und Durchsetzung von Gegenleistungen befassen, die die Kunden für die Inanspruchnahme der Unternehmensleistungen zu entrichten haben“ (PESCH 2005, 163).
Eine Hauptaufgabe der Preispolitik ist die Festlegung der Preishöhe sowie die Gestaltung von Preisstrategien. Dies betrifft auch die über den Kaufvertrag hinausgehenden vertraglichen Bestandteile wie Rabatte, Bonussysteme, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen und Kreditkonditionen (vgl. SANDER 2004, 438; SCHEUCH 2007, 299).
Wesentliche Einflussfaktoren preispolitischer Entscheidungen sind neben den Herstellungskosten auch die jeweilige Produktnachfrage. Ferner beeinflussen die Preise anderer Produkte der gleichen Produktlinie die Preispolitik eines Unternehmens (vgl. KUSS 2006, 266).
- Im Rahmen der Distributionspolitik werden alle betrieblichen Aktivitäten zusammengefasst, die „…der räumlichen und zeitlichen Überbrückung der zwischen Anbieter und Endnachfrager eines Produktes liegenden Distanz dienen, um auf diese Weise einen Kauf der Produkte durch die Endnachfrager zu ermöglichen“ (SANDER 2004, 647). Das Unternehmen muss hierbei diese „…Produkte [beziehungsweise] [..] Leistungen zur richtigen Zeit im richtigen Zustand und in der erforderlichen Menge…“ (WEIS 2004, 381) zur Verfügung stellen. Die Aufgaben der Distributionspolitik liegen somit einerseits im Produktverkauf, also in der Aufnahme des Kundenkontaktes und dem Abschluss des Kaufvertrages, andererseits im eigentlichen Transfer des Produktes zum Nachfrager (vgl. FRITZ/OELSNITZ 2006, 204).
Innerhalb der Distributionspolitik können drei Basisinstrumente unterschieden werden. Diese sind die Gestaltung der Absatzwege durch den „…Aufbau und [..] [das] Management von Vertriebssystemen…“ (BRUHN 2004, 246), die Absatzorganisation und die Absatzlogistik (vgl. BECKER 2001, 527).
Bei der Gestaltung der Absatzwege ist dabei zwischen dem direkten Vertrieb, das heißt der Abgabe der Produkte an den Endabnehmer ohne fremde Absatzorgane (vgl. SCHNETTLER/WENDT 2006, 206) oder dem indirekten Vertrieb, also dem bewussten Einsatz unternehmensfremder, selbständiger Absatzorgane (vgl. BECKER 2001, 528) zu entscheiden. Die „…Frage der Auswahl, Steuerung und Motivation der mit dem persönlichen Verkauf zu betrauenden Personen“ (BRUHN 2004, 246) ist im Zuge der Absatzorganisation zu klären, wohingegen die „…Überbrückung von Raum und Zeit durch Transport, Lagerung und Auftragsabwicklung“ (BRUHN 2004, 246) im Rahmen der Absatzlogistik zu gestalten ist.
- Die Kommunikationspolitik als vierter Instrumentalbereich betrifft „…die planmäßige Gestaltung und Übermittlung von Informationen, die die Adressaten der Kommunikation im Bereich Wissen, Einstellungen, Erwartungen und Verhaltensweisen im Sinne der Unternehmensziele beeinflussen sollen“ (HOMBURG/ KROHMER 2006, 222). Hierfür stehen dem Unternehmen eine Vielzahl an Kommunikationsinstrumenten (s. Kapitel 2.2.2) zur Verfügung, die als Maßnahmenbündel versuchen „…Handelspartner, Endkunden und andere Gruppen der Öffentlichkeit auf direktem oder indirektem Wege über [..] Produkte und Marken zu informieren, von deren Vorteilhaftigkeit zu überzeugen oder einen Impuls zu deren Kauf zu geben“ (KOTLER u.a. 2007, 652).
Die beschriebenen Instrumentalbereiche werden im so genannten Marketing-Mix zusammengeführt (vgl. SANDER 2004, 349), der die „…Gesamtheit steuerbarer taktischer Werkzeuge [darstellt], die das Unternehmen kombiniert und einsetzt, um auf dem Zielmarkt bestimmte erwünschte Reaktionen hervorzurufen“ (KOTLER u.a. 2003, 191).
Die Gestaltung des Marketing-Mix hat hierbei drei Ansprüche zu erfüllen. Zunächst muß das Unternehmen den Anforderungen des Marktes und den Bedürfnissen der Zielgruppen gerecht werden. Zweitens haben die jeweiligen Instrumente „…eine im Zeitablauf konstante, harmonische, [das heißt] [...] keine Widersprüche aufweisende Ganzheit [zu] bilden…“ (KÜHN u.a. 2006, 141). Zum Dritten hat der für die einzelnen Instrumente aufgewendete Mitteleinsatz „…konzentriert, mit genügender Intensität und unter Beachtung klarer Prioritäten…“ (KÜHN u.a. 2006, 141) zu erfolgen.
2.1.4 Grundlagen des Customer Relationship Marketing (CRM)
Die Marketingaktivitäten verlagerten sich in den letzten Jahren verstärkt weg von der Produktorientierung in Richtung Kundenorientierung. Dies zieht „…eine Neuausrichtung des Marketing nach sich…“ (BRUHN 2001, 1). Das Blickfeld richtet sich hierbei zunehmend auf den „…Aufbau und die Entwicklung stabiler Beziehungen…“ (KUSS 2006, 21) zum Kunden. Mit der „…Einsicht, dass es in der Regel […] teurer ist, einen neuen Kunden zu finden statt einen bestehenden zu behalten…“ (BECKER 2001, 908), werden Fragen der Kundenbindung immer bedeutender. Das Customer Relationship Marketing (CRM) stellt hierbei einen Paradigmenwechsel im Marketingbereich dar, dessen Fokus im Verstehen von Kundenbedürfnissen und deren Qualitätsvorstellungen liegt (vgl. GUMMESSON 1997, 27).
Kernpunkt des Customer Relationship Marketing ist die stete Orientierung und Intensivierung der Beziehungen zu den Anspruchsgruppen des Unternehmens (vgl. BRUHN 2001, 10). Diese auch als »Stakeholder« bezeichneten Anspruchsgruppen, „…definieren sich dadurch, dass sie in irgendeiner Form in die Unternehmenstätigkeit einbezogen oder durch diese direkt oder indirekt betroffen sind“ (SCHMID/LYCZEK 2006, 67). Dabei richtet sich das Customer Relationship Marketing nicht nur auf die Kundengewinnung, sondern auch auf den Ausbau von Kundenbeziehungen, die Festigung der Kundenbindung und die Wiedergewinnung bereits verlorener Kunden (vgl. BRUHN 2006, 512). Zudem beinhaltet das CRM die Fokussierung auf den Nutzen der Beziehung für die jeweiligen Partner, wobei der Nutzen für das Unternehmen im Gewinn und der Kundennutzen in der Bedürfnisbefriedigung liegt (vgl. BRUHN 2001, 12).
Ein für das CRM bedeutender Ansatz stellt das Lebenszykluskonzept dar. Ein Objekt durchläuft hierbei während seiner begrenzten Lebensdauer verschiedene Phasen, welche von der Produkteinführung über eine Phase des Wachstums, der Reife und Sättigung bis zur Phase der Degeneration reicht (vgl. WÖHE 2000, 529; BRUHN 2004, 63). Dabei wird versucht für jede dieser Phasen „…Gesetzmäßigkeiten […] zu identifizieren, um daraus Schlussfolgerungen für die Marktbearbeitung ziehen zu können“ (MEFFERT/BRUHN 2003, 170).
Das Konzept des Lebenszyklus ist auch auf Kundenbeziehungen übertragbar, wobei hier zwischen Kundenbedarfs- und Kundenbeziehungslebenszyklus unterschieden werden kann (vgl. BRUHN 2001, 43). Der Kundenbedarfslebenszyklus betrachtet hier die Bedürfnisse eines Individuums in den verschiedenen Lebensphasen und versucht dabei Cross-Selling-Potentiale zu erschließen. Darunter versteht man den Versuch, „…den Kunden [durch konkrete Maßnahmen] zu einer Inanspruchnahme weiterer Leistungen des Unternehmens [zu] stimulieren“ (BRUHN 2002, 183). Zudem sind bestehende Produkte so zu differenzieren, dass spezifische Bedürfnisse des Kunden erfüllt werden (vgl. BRUHN 2001, 45).
Der Kundenbeziehungslebenszyklus dahingegen versucht „…die Intensität der Kundenbeziehung in Abhängigkeit von der Dauer der Beziehung zum Unternehmen…“ (MEFFERT/BRUHN 2003, 174) zu erklären. Dieser stellt hierbei ein „…Erklärungsmodell eines idealtypischen zeitlichen Verlaufs einer Kundenbeziehung dar“ (STAUSS 2006, 424), in dem die Kunden in den einzelnen Phasen „…eine unterschiedliche Stärke der Kundenbeziehung [empfinden] und [...] unterschiedliche Erwartungen…“ (MEFFERT/BRUHN 2003, 174) bezüglich der Ausgestaltung der Marketing-Instrumente haben. Für jede Phase muß dabei das jeweilige Kundenpotential erkannt und optimal ausgeschöpft werden (vgl. WIMMER/GÖB 2006, 402).
Dies gilt auch für die Gewinnung neuer Kunden, da dies für das Unternehmen einen kostenträchtigen Faktor darstellt. Durch „…ein in das CRM eingebundenes Interessentenmanagement…“ (HAAS 2006, 466) wird daher versucht, „…bei potentiellen Neukunden das Interesse an dem Unternehmen zu wecken…“ (MICHALSKI 2006, 585), um in der Folge den Kaufprozess erfolgreich mit einem Verkauf abzuschließen (vgl. HAAS 2006, 446). Zudem ist ein umfassendes Kundeninformationsmanagement zu implementieren, da nur mittels umfangreicher Informationen über die Kunden langfristige und auch gewinnbringende Kundenbeziehungen aufgebaut werden können (vgl. WIMMER/GÖB 2006, 404). Da die Beeinflussung der Kundenzufriedenheit eine zunehmende Erfolgsdeterminante für die Unternehmen darstellt (vgl. TERLUTTER 2006, 273), werden bei der Steuerung der Kundenbeziehungen vermehrt verhaltenswissenschaftliche Erkenntnisse herangezogen (vgl. TERLUTTER 2006, 271). Ein wichtiger Indikator für die Zufriedenheit stellt hierbei das Beschwerdeverhalten der Kunden dar (vgl. PEPELS 2001, 719). Somit sind „…Beschwerden als auch die Art und Weise ihrer Behandlung und Lösung […] ein wesentlicher Bestandteil…“ (TÖPFER 2006, 543) des CRM. Des Weiteren ist die Kündigung durch ein effizientes Präventionsmanagement zu verhindern (vgl. MICHALSKI 2006, 586). Mögliche Strategien sind hierbei neben der Gestaltung von Anreizen zur Aufrechterhaltung der Kundenbeziehung, auch der direkte Dialog und der Aufbau von Austrittsbarrieren, etwa durch Kündigungsgebühren (vgl. MICHALSKI 2006, 599). Die letzte Säule des CRM stellt schließlich die Implementierung eines Rückgewinnungsmanagements dar, um Kunden zu halten beziehungsweise verlorene Kunden zurückzugewinnen (vgl. SCHÖLER 2006, 609).
2.1.5 Besonderheiten des Dienstleistungsmarketing
Dienstleistungen werden in das System der Wirtschaftsgüter eingeordnet und bezeichnen hierbei „…jede einem anderen angebotene Tätigkeit oder Leistung, die im Wesentlichen immaterieller Natur ist und keine direkten Besitz- oder Eigentumsveränderungen mit sich bringt“ (KOTLER u.a. 2007, 547). Im Sektor der Dienstleistungen sind dabei einige Besonderheiten zu berücksichtigen.
So ist es für den Anbieter einer Dienstleistung wesentlich, die eigene Leistungsfähigkeit zu dokumentieren (vgl. BRUHN 2004, 35), das heißt „…Signale zu senden, die den relevanten Anspruchsgruppen glaubwürdig vermitteln, dass die Organisation über die zur Problemlösung notwendigen Kompetenzen verfügt“ (BRUHN 2005a, 385). Dazu zählt vor allem die kommunikative Darstellung der Leistungspotentiale (etwa Fähigkeiten, Ausstattung und Organisationskapazität) nach außen (vgl. MEFFERT/BRUHN 2003, 62).
Zudem ist bei der Erstellung der Dienstleistung ein externer Faktor zu integrieren. Das bedeutet, dass in die Dienstleistung entweder ein Objekt (beispielsweise Auto bei der Reparatur) oder ein Subjekt (oftmals der Dienstleistungsempfänger selbst) mit eingebunden werden muß (vgl. MEFFERT 2000, 1160). Dies stellt für den Anbieter einer Dienstleistung einen Fremdfaktor dar, „…der maßgeblich Art, Dauer und vor allem Ergebnis des Dienstleistungsprozesses beeinflusst“ (ROSE 2002, 8). Durch die Unsicherheit bei der Einschätzung der Qualität seitens der Kunden entsteht dabei ein wahrgenommenes Kaufrisiko, das „…für Kunden bei vielen Dienstleistungen größer ist als bei Sachgütern“ (HOMBURG/KROHMER 2006a, 976). Da Dienstleistungen zudem nur in geringem Umfang zu automatisieren sind, „…hängt die Qualität einer Dienstleistung [daher auch] stark von Qualifikation, Schulung und Motivation der Mitarbeiter ab“ (SCHNETTLER/WENDT 2006, 19).
Eine Dienstleistung kann durch das Merkmal der Immaterialität nur in dem Moment in Anspruch genommen werden, „…in dem sie produziert wird, das heißt, dass das Leistungsergebnis nicht vorproduziert werden kann“ (MEFFERT/BRUHN 2003, 64). Das bedeutet, dass eine Dienstleistung nicht gelagert werden kann. Zudem ist eine Dienstleistung nichttransportfähig, das heißt „Produktion und Konsumtion der Dienstleistung erfolgen simultan (Uno-actu-Prinzip)…“ (MEFFERT 2000, 1161).
Aufgrund der besonderen Merkmale einer Dienstleistung sind bei der Ausgestaltung der Marketing-Instrumente verschieden Gesichtspunkte zu beachten.
So sind bei der Gestaltung der Produktpolitik zunächst marken- und programmpolitische Entscheidungen „…über die Art der angebotenen Leistungen…“ (BIEBERSTEIN 2006, 188) zu treffen. Diese betreffen zum einen die Ebene der Kernleistungen, wobei der Kundennutzen den Ausgangspunkt für die Festlegung des Leistungsangebotes darstellt, zum anderen die Ebene der Zusatzleistungen, die die angestrebte Einzigartigkeit des Angebotes ergänzen soll (MEFFERT/BRUHN 2003, 361). Zudem zählen neben der Beschwerde- und Servicepolitik auch das Angebot von Garantieleistungen zu den Aufgabenbereichen der Produktpolitik (vgl. BIEBER-STEIN 2006, 190).
Im Rahmen der Preispolitik zeigt sich neben der Schwierigkeit, einheitliche Preise festzulegen, ein hoher Anteil der Fixkosten, das heißt, der Kosten, die durch die „…Herstellung der Betriebsbereitschaft…“ (WÖHE 2000, 389) entstehen, um die Leistungsfähigkeit aufrecht zu erhalten (vgl. MEFFERT/BRUHN 2003, 517). Auch eventuelle Selbstbeteiligungen der Nachfrager einer Dienstleistung sind bei der Preisgestaltung zu berücksichtigen (etwa Fönen durch den Kunden beim Friseur), wobei der Preis einer Dienstleistung zugleich auch ein Ersatzkriterium zur Qualitätsbeurteilung darstellt (vgl. MEFFERT/BRUHN 2003, 518). Da die eigentliche Qualität der Dienstleistung erst nach der Inanspruchnahme für den Kunden feststeht, ist auch die Ermittlung der jeweiligen Preisbereitschaft erschwert (vgl. MEFFERT/ BRUHN 2003, 519).
Innerhalb der Distributionspolitik sind Entscheidungen über Art und Ausgestaltung der Absatzwege und –organe nötig. Der Dienstleister muss hier festlegen, ob die Dienstleistung an einer zentralen Stelle oder aber in Filialen an unterschiedlichen Orten angeboten werden soll (vgl. MEFFERT/BRUHN 2003, 556). Zudem können Dienstleistungen beim Anbieter, also standortgebunden (etwa Hotel), oder am Ort des Nachfragers, also standortungebunden (beispielsweise Hausbesuch), erfolgen (vgl. BIEBERSTEIN 2006, 279). Auch Entscheidungen zum Transport sind zu treffen, wobei die Faktoren Transportmittel, Transportzeit, Transportsicherheit und Transportkosten zu berücksichtigen sind (vgl. MEFFERT/BRUHN 2003, 576). Lagerhaltungsentscheidungen fallen im Dienstleistungssektor lediglich für materielle Leistungselemente im Zusammenhang mit der zu erbringenden Dienstleistung an, wie beispielsweise Vorräte eines Restaurants (vgl. MEFFERT/BRUHN 2003, 575).
Hauptaufgabe der Kommunikationspolitik stellt die Darstellung der Leistungsfähigkeit dar, welche durch die Verdeutlichung spezieller Kompetenzen erfolgen kann. Hierbei muss die Kommunikationspolitik dem Konsumenten die „…immaterielle Dienstleistung beziehungsweise das Dienstleistungspotential, -ergebnis oder den Dienstleistungsprozess…“ (MEFFERT/BRUHN 2003, 427) veranschaulichen.
2.2 Definition der Kommunikationspolitik als Marketing-Instrument
2.2.1 Begriffliche Grundlagen der Kommunikationspolitik
Unter Kommunikation „…kann der Austausch von Informationen zwischen einem Sender und einem Empfänger verstanden werden“ (SANDER 2004, 522). Hierbei richtet „…ein Sender eine Kommunikationsbotschaft über einen Kommunikationskanal an einen Empfänger .., was dann eine bestimmte Kommunikationswirkung hervorruft“ (HOMBURG/KROHMER 2006, 222). Diese „…Botschaft [wird] vom Sender gestaltet (codiert) und vom Empfänger entschlüsselt und interpretiert (decodiert). Der Empfänger kann dann eine Rückmeldung (Feedback) an den Sender geben“ (HOMBURG/KROHMER 2006a, 763).
Das „…Grundmodell der Kommunikation lässt sich mit der von dem Kommunikationsforscher .. [LASSWELL] geprägten Formel beschreiben: Wer sagt was über welchen Weg zu wem mit welcher Wirkung “ (KLOSS 2007, 11).
Überträgt man dieses Paradigma der Kommunikation auf das Unternehmen, sind mittels folgender Strukturierung Entscheidungen bei der Gestaltung kommunikativer Prozesse möglich:
- Wer (Unternehmung, Kommunikationstreibender)
- sagt was (jeweils gesendete Kommunikationsbotschaft)
- über welchen Weg (Kommunikationsträger, Medien)
- zu wem (Zielgruppe, Empfänger der Kommunikation)
- mit welcher Wirkung (Erfolg der kommunikativen Maßnahme) (vgl. MEFFERT 2000, 685; KLOSS 2007, 11)
Die Marketing-Kommunikation erfüllt hierbei mehrere Funktionen. So werden nicht nur gezielt Informationen übermittelt, es kommt auch zu einer Beeinflussung des Konsumenten, da „…die Kommunikation eine Vielzahl (innerer und äußerer) Verhaltensreaktionen im Sinne der Kommunikationsziele steuert“ (BRUHN 2005, 22). Diese Kommunikationsaktivitäten „…können darüber hinaus auch bezwecken, dass der Kunde nach seiner Entscheidung nochmals eine Bestätigung für die Richtigkeit seiner Wahl erhält, um gegebenenfalls auftretenden Zweifeln […] entgegenzuwirken“ (VERGOSSEN 2004, 21). Zudem kann sich das Unternehmen gegenüber der Konkurrenz profilieren und damit Wettbewerbsvorteile erzielen (vgl. BRUHN 2005, 23). Auch eine Beeinflussung des Wertesystems einer Gesellschaft ist über die Marketing-Kommunikation möglich und kann einen „…Beitrag zu einem aufgeklärtem Konsumentenverhalten“ (VERGOSSEN 2004, 21) leisten.
„Um sicherzustellen, dass im Rahmen der Kommunikationspolitik zielführende Entscheidungen getroffen werden, sollte die Kommunikationspolitik systematisch im Rahmen eines Planungsprozesses gestaltet werden“ (HOMBURG/KROHMER 2006a, 765), der nach umfassender Situations- und Zielgruppenanalyse die Bestimmung der Kommunikationsziele umfasst.
Die nachfolgend zu bestimmende Kommunikationsstrategie legt „…umfassende, verbindliche Verhaltenspläne für Kommunikationsinstrumente…“ (BRUHN 2005, 212) fest, die sich in unterschiedlichen Strategietypen konkretisieren. Dazu zählt die Bekanntmachungsstrategie (etwa Einführungs- oder Erinnerungswerbung), die Informationsstrategie (Aufklärung über neue Serviceleistungen, besondere Aktionen), die Imageprofilierungsstrategie (beispielsweise Imagewerbung zu besonderen Umweltschutzaktivitäten), die Konkurrenzabgrenzungsstrategie (Hervorheben konkurrenzunterscheidender Merkmale), die Zielgruppenerschließungsstrategie (etwa gezielte Ansprache von Studenten), die Kontaktanbahnungsstrategie (Gewinnung der Unterstützung durch die Öffentlichkeit) und die Beziehungspflegestrategie (Aufbau und Pflege von Kontakten) (vgl. BRUHN 2004, 212; BRUHN 2005, 215).
Zudem sind der finanzielle Aufwand zur Umsetzung der Kommunikationsstrategie zu bestimmen (vgl. SANDER 2003, 535) und Maßnahmenpläne für die einzelnen Kommunikationsinstrumente zu entwickeln. Die Erfolgskontrolle bezüglich der zu erreichenden Kommunikationsziele schließt den Planungsprozess ab und zieht gegebenenfalls eine Zielanpassung nach sich (vgl. SANDER 2004, 537).
2.2.2 Instrumente der Kommunikationspolitik
Um kommunikationspolitische Ziele zu erreichen, steht dem „…Unternehmen ein breites Spektrum möglicher Aktivitäten zur Verfügung“ (VERGOSSEN 2004, 141). Da die Betriebe oftmals vor dem Problem stehen, alle kommunikativen Maßnahmen systematisch und in vollem Umfang zu erfassen, werden diese Maßnahmen „…nach ihrer Ähnlichkeit gedanklich…“ (BRUHN 2005, 328) zu Kommunikationsinstrumenten zusammengefasst.
Die Werbung zählt hierbei neben Public Relations (PR), auch als Pressearbeit oder Öffentlichkeitsarbeit bezeichnet, zu den klassischen Instrumenten der Kommunikationspolitik (vgl. SANDER 2004, 537).
Dabei kann Werbung als „…versuchte Verhaltensbeeinflussung mittels besonderer Kommunikationsmittel…“ (KROEBER-RIEL/ESCH 2004, 35) aufgefasst werden, die „…über Streumedien, wie […] [etwa] Zeitungen, Zeitschriften, Anschlagstellen, Fernsehen, Hörfunk und Kino…“ (ESCH u.a. 2006, 269) verbreitet wird. Die Werbung soll hierbei „…zu einer Veränderung des Informationsstandes [führen] und langfristig…“ (ROGGE 2004, 20) wirken.
Im Rahmen der Public Relations besteht die Hauptaufgabe darin, „…über das Unternehmen zu informieren und auf diese Weise Vertrauensgrundlagen zwischen Unternehmen und Öffentlichkeit aufzubauen“ (BECKER 2001, 600). Zielgruppen der Public Relations sind hierbei externe Anspruchsgruppen wie Kapitalgeber, Lieferanten, Konkurrenten, Kunden, Staat und Gesellschaft, sowie interne Kundengruppen wie Eigentümer, Management und Mitarbeiter (vgl. BECKER 2001, 601).
Da „…bei den neueren Formen der Kommunikation…“ (BRUHN 2005, 328) die zweifelsfreie Einordnung nicht immer möglich ist, sind „…aus Gründen der Zweckmäßigkeit…“ (BRUHN 2005, 328) weitere Kommunikationsinstrumente zu unterscheiden. Dazu zählen die Verkaufsförderung, das Direktmarketing und das Sponsoring. Zudem sind Messen und Ausstellungen, das Event Marketing und die Multimediakommunikation abgrenzbar (vgl. BRUHN 2004, 204).
- Die Verkaufsförderung befasst sich hierbei mit der Gestaltung zusätzlicher Anreize, um die Kommunikations- und Vertriebsziele eines Unternehmens zu erreichen (vgl. BRUHN 2005, 343). „Hierzu zählen […] [unter anderem] besondere Verkaufs- oder Probierstände im Einzelhandel, Lotterien, Preisausschreiben…“ (FRITZ/ OELSNITZ 2006, 241) oder firmeneigene Schulungs- und Beratungszentren. Im Gegensatz zur langfristig konzipierten Werbung ist die Zielsetzung der Verkaufsförderung kurzfristig angelegt und soll zu schnell spürbaren Reaktionen führen (vgl. ROGGE 2004, 20).
- Im Rahmen des Direktmarketing sind alle marktbezogenen Aktivitäten angesiedelt, „…um Zielgruppen in Einzelansprache gezielt zu erreichen. Hierbei kommen typischerweise Medien wie Werbebriefe, Werbepostkarten, Postsendungen, Faxe oder auch Emails zur Anwendung“ (HOMBURG/ KROHMER 2006a, 822). Ziel des Direktmarketing ist es, „…einen direkten Kontakt zum Adressaten herzustellen und einen unmittelbaren Dialog zu initiieren…“ (BRUHN 2005, 364). Der Vorteil des Direktmarketing liegt in der Reduktion von Streuverlusten, da hier nur gezielt die Zielgruppen angesprochen werden, für die die Werbebotschaft von Relevanz ist (vgl. KLOSS 2007, 512).
- Mittels Sponsoring werden „…Personen, Organisationen oder Veranstaltungen im sportlichen, kulturellen, sozialen, ökologischen oder auch rein unterhaltungsorientierten Bereich…“ (VERGOSSEN 2004, 282) gefördert, um Kommunikationsziele zu erreichen. Hierbei findet in der Regel die Erbringung von Geld-, Sach- oder Dienstleitungen durch den Sponsor statt (vgl. KLOSS 2007, 463). Die Gegenleistung für den Sponsor „…besteht in der Öffentlichkeitswirkung […] durch die Medienpräsenz der Gesponserten…“ (SCHEUCH 2007, 349), wie beispielsweise durch Autogrammstunden oder Aufführungen.
- Bei der Unternehmenspräsentation im Rahmen von Messen und Ausstellungen können sich die Nachfrager direkt und im persönlichen Kontakt beim jeweiligen Anbieter über angebotene Leistungen informieren (vgl. BRUHN 2005, 410). Hierbei können zugleich Verkäufe vorbereitet und abgeschlossen werden (vgl. WEIS 2004, 404).
- Das Event Marketing wiederum stellt eine „…Anpassung des Marketing an einen freizeit- und erlebnisorientierten Lebensstil von großen Teilen der Bevölkerung…“ (KLOSS 2007, 556) dar. Hierbei werden firmen- oder produktbezogene Ereignisse erlebnisorientiert inszeniert und zur Unternehmenskommunikation genutzt (vgl. FRITZ/OELSNITZ 2006, 255). Mit der Teilnahme an diesen »Events« wird den Angesprochenen das Gefühl vermittelt, an etwas Besonderem teilzunehmen, wodurch ein persönlicher Kontakt in zwangloser Atmosphäre ermöglicht wird (vgl. HOMBURG/KROHMER 2006, 253). Hierzu zählen beispielsweise ein »Tag der offenen Tür«, Aktionen für Kinder, Talkshows mit Prominenten oder Bühnenauftritte bekannter Stars (vgl. MEFFERT 2000, 740).
- Die Kommunikationsform Multimedia, auch »neue Medien« genannt, umschreibt die Zusammenführung von Computertechnologie, Telekommunikation und Rundfunk und deren gemeinsame Nutzung in einem Endgerät. Die Vorteile des interaktiven Kundenkontakts in Form papierloser Kommunikation, wie beispielsweise im Internet, eröffnen dem Marketing neue Möglichkeiten (vgl. KLOSS 2007, 535). Hierbei kommen Offline-Anwendungen in Form transportabler Datenträger, wie CD-Rom mit Produktinformationen, sowie Online-Anwendungen, wie beispielsweise Werbung im Internet, zum Einsatz (vgl. MEFFERT 2000, 749).
2.2.3 Modelle des Konsumentenverhaltens
Um die Bedürfnisse oder Wünsche der Kunden und die jeweiligen Marketing-Maßnahmen bestmöglich auf einander abzustimmen „…sind fundierte Kenntnisse zum Kundenverhalten erforderlich“ (ESCH u.a. 2006, 39). Das Marketing kann dabei auf zahlreiche, in dieser Arbeit nur beispielhaft aufgeführte, verhaltenswissenschaftliche Erklärungsmodelle zugreifen, um bei potentiellen Kunden ablaufende Prozesse bei der Kaufentscheidung zu verstehen und die Wirkung der Marketing-Instrumente einzuordnen (vgl. BIEBERSTEIN 2006, 85).
Das Konsumentenverhalten, als das Verhalten der Verbraucher materieller und immaterieller Güter (vgl. KROEBER-RIEL/WEINBERG 2003, 3) ist hierbei wissenschaftlich als Konsumentenforschung in die Verhaltenswissenschaft einzuordnen, die Wissenschaften vereint, die sich mit menschlichem Verhalten befassen, wie etwa die Psychologie, Soziologie oder Sozialpsychologie (vgl. KROEBER-RIEL/WEINBERG 2003, 8).
Hierbei steht eine Vielzahl von Erklärungsansätzen zur Verfügung, mittels derer das Kaufverhalten und eventuelle Marktreaktionen beschrieben oder eingeschätzt werden können (vgl. MEFFERT 2000, 98). Die Kenntnis dieses Bereiches stellt neben dem allgemeinem Marketingwissen eine Grundlage erfolgreicher Marktkommunikation dar (vgl. UNGER/FUCHS 1999, 449).
Ein Erklärungsmodell, um das Konsumentenverhalten zu beschreiben, ist das »Black-Box-Modell«, bei dem der Kunde bestimmte Impulse oder Stimuli, die „…durch Marketingaktivitäten oder durch sonstige Personen und/oder Institutionen…“ (BIEBERSTEIN 2006, 86) auf ihn einwirken, verarbeitet. Auf diesen Impuls reagiert der Konsument dann mit einem bestimmten Output oder Response. Dieses Modell wird oftmals auch als Stimulus-Response-Modell (S-R-Modell) beschrieben (vgl. PESCH 2005, 55). Hierbei stellen die „…Psyche und der Entscheidungsprozess des Käufers…“ (WEIS 2004, 74) eine »Black Box« dar, welche weder beobachtbar noch fassbar ist.
Ein Kritikpunkt an diesem Modell ist daher die Unterstellung, dass das Verhalten von ausgesendeten Reizen abhängt und allein die Kenntnis des Reizes dieses Verhalten erklär- und vorhersehbar macht (vgl. FELSER 2001, 15). „Davon kann aber nicht ausgegangen werden“ (BRUHN 2005, 43). Der Stimulus stellt nur einen Einflussfaktor dar, wohingegen das Verhalten von einer Vielzahl weiterer Determinanten abhängig ist (vgl. FELSER 2001,15; BRUHN 2005, 43).
„Will man die Vorgänge im Organismus (Psyche) des Käufers erklären…“ (WEIS 2004, 75), so kann man das S-R-Modell zum Stimulus-Organismus-Response-Modell (S-O-R-Modell) erweitern. Hier werden zusätzliche, die Reizverarbeitung beeinflussende Faktoren wie „…Motive, Einstellungen [und] kognitive Faktoren…“ (BIEBERSTEIN 2006, 86) mit eingeschlossen, welche die Werbewirkung und mögliche Kaufentscheidung positiv oder negativ beeinflussen (vgl. MEFFERT 2000, 99).
Das Marketing kann sich auch Motive der Kunden beim Produktkauf zunutze machen. Ein Motiv entsteht dabei aus einem Bedürfnis heraus, das so stark ist, dass es die Person zu einer Handlung veranlasst (vgl. KOTLER u.a. 2007, 284). Diese Motive werden als innere Spannungs- bzw. Mangelzustände mit konkreter Zielorientierung erlebt (vgl. FRITZ/OELSNITZ 2006, 62).
Ein Beispiel für eine so genannte Motivationstheorie, stellt beispielsweise die Dissonanztheorie von FESTINGER dar. Diese „…geht davon aus, dass Individuen ein dauerhaftes Gleichgewicht ihres kognitiven Systems anstreben“ (BRUHN 2001, 29). Dissonanzen entstehen hierbei durch inkonsistentes Wissen nach dem Kauf, bei dem man nicht nur die Nachteile der ausgewählten Alternative hinnimmt, sondern auch auf die Vorteile der nicht gekauften Alternative verzichtet. Je ähnlicher sich die Wahlmöglichkeiten sind, desto größer der Konflikt (vgl. KROEBER-RIEL/ WEINBERG 2003, 185). Der Konsument reduziert daher diese Dissonanzen etwa durch selektive Wahrnehmung bestätigender Informationen oder einer nachträglichen Aufwertung der gewählten oder Abwertung der abgelehnten Alternative (vgl. PEPELS 2001, 255). Die Aufgabe des Marketing liegt nun in der Verringerung dieser Dissonanzen.
Hier zeigt sich auch die Problematik dieser Theorie, da sich die hiermit im Zusammenhang stehenden psychischen Prozesse kaum steuern oder gar kontrollieren lassen (vgl. KROEBER-RIEL/WEINBERG 2003, 186).
Weitere Modelle zur Erfassung kommunikativer Prozesse bauen „…auf den grundsätzlichen Stufen der Kommunikationswirkung (Wahrnehmung, Verarbeitung und Verhalten) auf und spezifizieren dieses Grundschema in unterschiedlicher Weise“ (MEFFERT 2000, 696).
Das in diesem Zusammenhang wohl bekannteste Modell ist die AIDA-Regel. „Sie ergibt sich als Aufeinanderfolge von Aufmerksamkeit (a ttention), Interesse (i nterest), Wunsch (d esire) und Handlung (a ction). Das Modell geht davon aus, dass der Verbraucher, der sich für ein Produkt interessiert, sich Produktwissen aneignet, daraufhin positive oder negative Einstellungen zu dem Produkt entwickelt und es dann entsprechend kauft oder nicht“ (KLOSS 2007, 81). Zu kritisieren ist bei diesem Modell jedoch, dass die Komplexität kommunikativer Prozesse nicht mittels eines einheitlichen Wirkungsmodells erklärbar ist. Vielmehr bestimmen eine Vielzahl an Determinanten die Wirkung kommunikativer Maßnahmen, wie etwa die Zahl der Wiederholungen der Kommunikationsbotschaft oder deren Gestaltung (vgl. ESCH u.a. 2006, 255). Auch die „…unterstellte Grundvoraussetzung von Werbewirkung, nämlich die Aufmerksamkeit…“ (FELSER 2001, 16) wird selten erfüllt und ist bei vielen Wirkmechanismen auch nicht Vorraussetzung (vgl. FELSER 2001, 16).
2.3 Grundbegriffe des Internet und des Internet-Marketing
2.3.1 Grundlagen des Internet und des World Wide Web
Das Internet begann 1969 an der University of California Los Angeles mit seinem Vorläufer, dem ARPANet (Advanced Research Project Agency Network) (vgl. DÖRING 2003, 2). Dieses erste Netzwerk sollte zunächst die Funktionsfähigkeit der „…militärischen Kommando- und Kontrollstruktur…“ (RUNKEHL u.a. 1998, 9) im Angriffsfall erhalten und Fragen der Raketenabwehr bearbeiten (vgl. RUNKEHL u.a. 1998, 9), wandelte sich dann jedoch in ein Forschungsprojekt, um Materialressourcen und Wissenspotentiale effizienter nutzen zu können (vgl. RUNKEHL u.a. 1998, 10). Die Schwierigkeiten bei der Kommunikation zwischen den einzelnen Großrechnern wurden damals mit der Entwicklung von Protokollen für die Datenübertragung (vgl. LÜTHY u.a. 1998, 40) gelöst. Die Verbindung verschiedener „…Netzwerke im Sinne eines ersten Internet…“ (FRITZ 2000, 26) gelang erstmals 1977.
Das »Internet-Protocol« (IP) regelt hierbei die richtige Adressierung der Datenpakete (vgl. DÖRING 2003, 3), wohingegen das »Transmission-Control-Protocol« (TCP) die Informationen in kleine Einheiten aufteilt und die einzelnen Pakete so nummeriert, dass „…der Empfang bestätigt werden kann und die Daten aus den Einzelstücken wieder rekonstruiert werden können“ (KROL 1995, 30).
Diese Protokolle bilden die Basis für zahlreiche im Internet angebotene Dienste. Dazu zählen beispielsweise Newsgroups (Diskussionsgruppen mit automatischer netzweiter Verteilung der Nachrichten), E-Mail (Elektronische Post und Datenaustausch auf Textbasis) oder das World Wide Web (Informationsdienst auf der Basis miteinander verknüpfter Dokumente) (vgl. MEFFERT 2000, 754; SAARO 1999, 101).
Das World Wide Web (WWW) ist ein riesiges verteiltes System, „…das aus Millionen von Clients und Servern besteht, die auf verknüpfte Dokumente zugreifen“ (TANENBAUM/STEEN 2003, 723). Die Server verwalten die als Dateien gespeicherten Dokumente und nehmen „…Anforderungen von auf anderen Computern ausgeführten Programmen…“ (COULOURIS u.a. 2002, 25) entgegen. Diese Programme werden als Clients bezeichnet. Deren Aufgabe ist es, „…die vom Server empfangenen Daten entsprechend aufzubereiten […] und dem Anwender zu präsentieren“ (SCHRADER 2003, 34). Die Kommunikation der Clients mit den Webservern erfolgt über ein spezielles Programm, dem Browser (etwa »Microsoft Internet Explorer« oder »Netscape Navigator«) (vgl. PATURI 2002, 18). Dieser ist für die korrekte Darstellung des Dokumentes verantwortlich (vgl. TANENBAUM/ STEEN 2003, 724).
Eine WWW-Seite bezeichnet hierbei „…ein elektronisches Dokument, das Texte, Grafiken, Fotos, Animationen, Audio- und Videosequenzen integriert…“ (DÖRING 2003, 73). Hierbei dient der Begriff Internet-Inhalt „…als Oberbegriff für die […] über das Internet bereitgestellten digitalen Produkte und Dienstleistungen“ (WIRTZ 2006, 566), die zudem über Links (Verweise) mit anderen Dokumenten verknüpft sein können. Die hier angebotenen, zusammenhängenden Internet-Seiten werden als Web-Seite, Website, Internet-Präsenz oder auch Online-Auftritt bezeichnet. Teils findet sich auch der Begriff Homepage, worunter „…im engeren Sinne [jedoch] nur die Startseite einer Website…“ (DÖRING 2003, 73) verstanden wird.
Die Formatierung und Darstellung der Web-Seiten erfolgt mit der Seitenbeschreibungssprache »HTML«, der »HyperText Markup Language« (vgl. SAARO 1999, 121). Die Web-Seiten werden dann mit dem Netzprotokoll »http« (hypertext transfer protocol) im Netz verschickt, das sozusagen die Sprache darstellt, „…in der sich Client und Server im WWW unterhalten“ (FRITZ 2000, 37). Jede dieser Seiten „…ist durch eine eindeutige Adresse…“ (SCHRADER 2003, 40) gekennzeichnet, die auch als »Uniform Resource Locator« (URL) bezeichnet wird. Unter dieser Adresse ist diese Web-Seite, von der man zudem auf jede gewünschte andere Internet-Seite weiterwechseln kann, von überall aus der Welt aufrufbar (vgl. SAARO 1999, 120).
2.3.2 Besonderheiten des Marketing im Internet
In der Praxis zeigt sich, das viele Unternehmen neben der Platzierung von Anzeigen auf unternehmensfremden Web-Seiten einen eigenen Internet-Auftritt anbieten, mit dem „…sie mit Konsumenten in Kontakt treten und über sich und ihre Produkte und Marken informieren“ (ESCH u.a. 2006, 281). Hierbei hat das Internet „…sowohl Verbrauchern wie auch Herstellern neue Möglichkeiten eröffnet“ (KOTLER u.a. 2002, 12), da es „…nicht mehr wie viele der klassischen Kommunikationsmedien auf einen oder wenige Kommunikationsmodi beschränkt ist“ (WERNER/STEPHAN 1998, 2).
Für das Marketing ergeben sich im Rahmen der Online-Kommunikation, die in den Bereich »Multimedia« eingeordnet werden kann (vgl. BRUHN 2004, 238), einige Besonderheiten.
So handelt es sich beim Internet um ein interaktives Medium, bei dem der Konsument selbst aktiv wird und „…den Inhalt in Echtzeit auswählen, abrufen, weiterverfolgen, ignorieren…“ (MEFFERT/ BRUHN 2003, 500) und auch verändern kann. Dies bedeutet eine „…Abkehr vom einseitig durch den Anbieter gesteuerten Push-Marketing und die Wende…“ (FRITZ 2000, 85) zum vom Nachfrager bestimmten Pull-Marketing, bei dem via Mausklick interessierende Inhalte selektiert werden können (vgl. FRITZ 2000, 85).
Zudem zeichnet sich das Internet durch Hypermedialiät aus, bei der verschiedene Mediengattungen verknüpft werden können (vgl. MEFFERT 2000, 759), wie Animation, Bild, Text und Sprache. Aufgrund der Multifunktionalität dieses Mediums werden „…eine personenbezogene Individualkommunikation […], eine Ansprache einer eingegrenzten Zielgruppe […] [sowie] eine Bereitstellung von Informationen für alle Nutzer…“ (BRUHN 2004, 240) ermöglicht.
Da das Internet zudem global und jederzeit verfügbar ist, stellt es „…eine offene Kommunikationsplattform dar, über die weltweit potentiell jedes Unternehmen und jeder Konsument mit der entsprechenden Technik kommunizieren kann“ (MEFFERT 2000, 762). Auch im Rahmen der Corporate Identity Politik kann das Unternehmen im Internet als Ganzes präsentiert werden (vgl. BECKER 2001, 639).
2.3.3 Grundsätze der benutzerfreundlichen Gestaltung der Internetpräsenz
Trotz überwältigender Auswahlmöglichkeiten und großer Leichtigkeit, mit der man sich im Internet bewegen kann, zeigt der Betrachter einer Internet-Seite viel Ungeduld und bricht den Besuch der Internet-Seite schnell ab, wenn seine Wünsche nicht befriedigt werden oder er die Web-Seite nicht sofort bedienen kann (vgl. NIELSEN 2001, 10). Für die Akzeptanz eines Internet-Auftrittes spielt dabei die hier beispielhaft beschriebene, benutzerfreundliche Gestaltung eine wesentliche Rolle (vgl. HÄRTER 2006, 95).
Um den Besucher bei der Orientierung im Internet zu unterstützen, sollten die wichtigsten Funktionsbereiche vor der Erstellung der Web-Seite festgelegt und konstant für jede Seite beibehalten werden. Zu diesen zählen beispielsweise „…die Titelzeile, das Hauptmenü, eine Neben-Navigation, der eigentliche Text- bzw. Inhalts-Bereich, Werbeflächen oder Bereiche für zentrale Serviceangebote…“ (HÖRNER 2006, 97). Auch die gewählten Farben sollten auf Inhalt und Zielgruppe abgestimmt (vgl. HÖRNER 2006, 98) und einheitlich für die gesamte Online-Präsenz, etwa Balken und Hintergründe, verwendet werden. Die Informationsübermittlung kann hierbei auch mittels bestimmter Bilder (beispielsweise Zimmerausstattung) oder Logos (zum Beispiel ein Einkaufswagen als Symbol für den Warenkorb) gegenüber langen Textpassagen beschleunigt werden (vgl. HÖRNER 2006, 100).
Die kommunikativen Angebote, wie Termininformationen, Presseberichte, Gästebuch oder Neuigkeiten, sind regelmäßig zu überarbeiten (vgl. HÄRTER 2006, 45), wobei auch auf die korrekte Rechtschreibung geachtet werden sollte, da sich Fehler negativ auf die Seriosität eines Unternehmens auswirken können (vgl. PUSCHER 2001, 45). Um die einzelnen Internet-Seiten nicht mit Informationen zu überlasten, sind weniger wichtige Botschaften auf zusätzlichen Seiten (Links) auszulagern (vgl. NIELSEN 2001, 15). Diese »Links« „…verbinden Seiten miteinander und ermöglichen es den Benutzern, schnell zu neuen und spannenden Plätzen im Web zu gelangen“ (NIELSEN 2001, 51).
Für eine bestmögliche Orientierung auf der Web-Seite sorgen zudem Menüleisten, die Navigationsstruktur, Suchwege-Design oder Hilfefunktionen (vgl. HÖRNER 2006, 96). Auf der Internet-Seite kann hierbei ein Hauptmenü als zentraler Orientierungspunkt platziert werden, der dem Benutzer sagt, „…wohin er bei einem Klick auf den jeweiligen Menüpunkt gelangt“ (HÖRNER 2006, 76). Dieses Menü kann aus Gründen der Übersichtlichkeit durch die Platzierung einer Neben-Navigation (vgl. HÖRNER 2006, 80), wie etwa ein zusätzliches Menü oder SiteMaps entlastet werden.
Zusätzlich können Suchmaschinen zur Stichwortsuche angeboten (vgl. VOGT 2000, 166) oder die Seiten barrierefrei gestaltet werden, beispielsweise durch verschiedene Schriftgrößen für Menschen mit Sehbehinderungen (vgl. NIELSEN 2001, 303).
2.4 Definition des Marketing im Krankenhaus
2.4.1 Besonderheiten des Krankenhausmarktes
Der Krankenhaussektor wird seit einigen Jahren von wesentlichen Veränderungen beeinflusst. Dazu zählen der Anstieg der über 65-jährigen Patienten, die Zunahme der Fallzahlen bei zugleich reduzierter Verweildauer und die Reduktion der Bettenkapazität im Krankenhausbereich, mit der Folge einer deutlichen Leistungsintensivierung (vgl. SCHMIDT/RIEHLE 2001, 6). Der steigende „…Wettbewerbsdruck und begrenzte Budgets zwingen die Krankenhäuser, sich auf der Leistungsseite stärker zu positionieren und dabei ein Optimum an Wirtschaftlichkeit…“ (MEYER 2001, 52) zu realisieren. Dabei stehen die Krankenhäuser vor der Aufgabe „…eine durchschnittliche Leistung mit unterdurchschnittlichen Kosten zu erbringen, um dadurch überdurchschnittlich zu wirtschaften, […] [das heißt] in die Gewinnzone zu gelangen“ (DÜLLINGS 2003, 12).
Im Gesundheitswesen geht es wie auch in anderen Wirtschaftsbereichen „…um die Produktion, die Konsumption [!] und den Austausch von Gütern“ (HAJEN u.a. 2004, 47). Diese Austauschprozesse finden auf Märkten statt, wobei sich hier der Patient vom herkömmlichen Nachfrager unterscheidet. Die Nachfragerrolle ist eher passiv, Verhandlungen finden kaum statt. In der Regel kommt es durch die Vermittlung des Arztes zur Inanspruchnahme von Krankenhausleistungen, wobei der Arzt die Rolle des Sachwalters übernimmt (vgl. THIELE 2002a, 27). Diese Sachwalterbeziehung, auch als Principal-Agent-Beziehung bezeichnet, kommt durch ungenügende Informationen seitens der Nachfrager zustande. Diese kennen in der Regel weder Preis und Qualität der Produkte, noch können sie deren Nutzen bewerten. Aufgrund dieser Unsicherheit beauftragt daher der Patient als „…Auftraggeber (Principal) einen Agenten mit der Wahrnehmung bestimmter Aufgaben…“ (HAJEN u.a. 2004, 62). In dieser Beziehung besteht die Gefahr, „…dass der Agent sich nicht im Sinne des Principals verhält, sondern auch seine eigenen, abweichenden Interessen verfolgt…“ (HUNGENBERG 2006, 38). Der Patient selbst kann hierbei „…oftmals nur sein Vertrauen einbringen in der Hoffnung, dass der Arzt [als sein Agent] alles unternimmt, ihn zu heilen“ (BREYER u.a. 2003, 404).
Auch die Preisbildung findet im Gesundheitswesen nicht wie in der freien Wirtschaft durch Angebot und Nachfrage statt (vgl. HOMBURG/KROHMER 2006, 2), sondern die Preisfestlegung für die einzelnen Behandlungsformen erfolgt auf unterschiedlichen Entscheidungsebenen durch verschiedene Verhandlungspartner (vgl. THIELE 2002a, 27). Zudem führen bestehende Qualitätsunterschiede von Ärzten und Krankenhäusern nicht wie auf einem freien Markt zu unterschiedlichen Preisen (vgl. SCHUMACHER 2001, 38). Vielmehr erhalten alle Krankenhäuser aufgrund des diagnose-orientierten Fallpauschalensystems (DRG-System) für die gleiche Leistung die gleiche Vergütung (vgl. DÜLLINGS 2003, 12). Auch der Marktzutritt zum Krankenhaussektor ist reglementiert, da die Zulassung für den Krankenhausbetrieb über die Krankenhausplanung der Länder staatlich festgelegt wird (vgl. ROSENBROCK/GERLINGER 2004, 143).
Ein weiteres Merkmal der Marktstruktur des Gesundheitssektors besteht in einer Funktionstrennung auf Nachfragerseite. Die Patienten sind hierbei nicht die eigentlichen Konsumenten, sondern die Nachfrage nach Gesundheitsleistungen findet durch die Ärzte statt. Die Konsumenten bezahlen die wahrgenommen Leistungen zudem nicht selbst, sondern die Bezahlung erfolgt über die Krankenkassen (vgl. THIELE 2002a, 28).
Da es sich bei Krankenhausleistungen „…um ein öffentliches Gut…“ (SCHUMACHER 2001, 38) handelt, erhält jeder im Krankheitsfall bei freier Bettenkapazität die Option auf Versorgung (vgl. SCHUMACHER 2001, 38). Es besteht für Krankenhäuser damit eine Verpflichtung „…im Interesse des Gemeinwohls und der Befriedigung öffentlicher Bedürfnisse, die sich aus dem Gesetzes [..] [beziehungsweise] Versorgungsauftrag ergeben...“ (DAMKOWSKI u.a. 2000, 286), die erforderlichen Dienstleistungen jederzeit bereit zu stellen. Hierfür sind „…Vorhalteleistungen wie etwa [..] [die] Bereitstellung von Krankenbetten, Diagnoseeinrichtungen, Behandlungsräumen unabhängig von ihrer Nachfrage […] oder […] [die ständige] Besetzung der Notaufnahme mit medizinischem Bereitschafts-personal unabhängig von der Anzahl der tatsächlich auftretenden Notfälle…“ (MAYER 2005, 35) zu erbringen. Diese Kapazitätsvorhaltung würde es am normalen Markt nicht geben, da sie mit erheblichen Kosten verbunden ist und hierfür kaum Zahler zu finden wären. Daher ist es eine Aufgabe des Staates, einerseits die Finanzierung über Zwangsabgaben (Steuern) sicherzustellen und andererseits die notwendigen Kapazitäten über die Planung von Krankenhäusern bereitzustellen (vgl. SCHUMACHER 2001, 38).
[...]
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Erstausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2008
- ISBN (Paperback)
- 9783863412869
- ISBN (PDF)
- 9783863417864
- Dateigröße
- 408 KB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Hamburger Fern-Hochschule
- Erscheinungsdatum
- 2015 (Februar)
- Note
- 1,5
- Schlagworte
- Websitegestaltung Krankenhausmarkt Dienstleistungsmarketing Konsumentenverhalten Zielgruppenkommunikation Internetpräsenz Bayern
- Produktsicherheit
- BACHELOR + MASTER Publishing