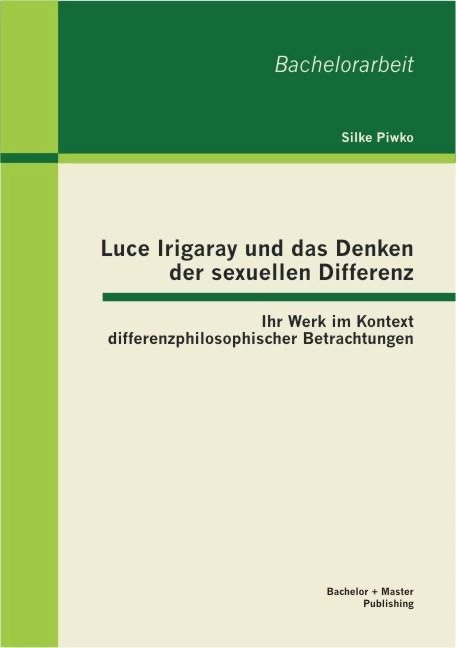Luce Irigaray und das Denken der sexuellen Differenz: Ihr Werk im Kontext differenzphilosophischer Betrachtungen
Zusammenfassung
Die Autorin stellt, basierend auf einer kurzen Zusammenfassung der differenzphilosophischen Entwicklung in der abendländischen Philosophiegeschichte, den Beitrag der Philosophin Luce Irigaray für die Konstruktion eines neuen geschlechtsspezifischen Sprechens, Denkens und Handelns zur Entwicklung einer „weiblichen“ Philosophie dar und gibt einen Einblick in das Verhältnis ihres Werkes zum gegenwärtigen feministischen Diskurs und zu politisch-praktischen Diskussionen und Forschungen.
Bei Irigaray tritt ein neues Differenzdenken aus den identitätslastigen Reflexionen traditioneller Philosophien heraus. Nach ihrer Ansicht eröffnet die Suche nach einem anderen Differenzbegriff vor allem im praktischen Denkrahmen die Möglichkeit, konkrete Schritte in Richtung neuer Fragestellungen gehen zu können.
Die Schwierigkeit der traditionellen philosophischen Debatte im Kontext „weiblicher“ Problemzusammenhänge besteht in einer vorwiegend männlichen Prägung philosophischer Denkweisen, Methoden und Begriffsbestimmungen.
In einer vorgenommenen Neubewertung des Begriffs der sexuellen Differenz versucht Irigaray, eine Perspektive zu eröffnen, die akzeptiert, dass der Mensch zwei ist. In der Weiterführung ist es ihr Anliegen, eine weibliche Sprache als Gegenentwurf auszumachen, welche die tatsächliche geschlechtliche Identität für Frauen zulässt. Die praktische Seite ihres Differenzdenkens spiegelt sich einer Politik der Differenz wider, die es erlaubt, konstruktive Angebote für eine friedliche Revolution zu machen.
Dadurch wird Irigarays Beitrag der sexuellen Differenz in einem feministischen Diskurs verortet, welcher es beansprucht, auf die Unterrepräsentation von Frauen hinzuweisen und so die feministischen Theoriebildung durch innovative Impulse für eine Weiterentwicklung, entsprechend den aktuell ökonomischen, politischen, rechtlichen und sozialen Strukturen der Gesellschaft zu beeinflussen.
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
2. Die Konstruktion von Differenz in philosophischer Betrachtung
2.1. Die Differenz - der Unterschied
„Was ich Differenz nenne, […] ist eine Auflösung der Beziehung zum Anderen, zum Heterogenen, ohne Hoffnung und ohne Wunsch nach Totalisierung.“ (Derrida 1987)
Entwicklungen in der Philosophie finden dort statt, wo sich ein Wechsel von Perspektiven vollzieht, welcher uns damit konfrontiert, bis dahin vertraute Denkweisen in neue Zusammenhänge zu überführen und Grenzen zu erkennen. In diesem Kontext eine philosophische Begriffsbestimmung von Differenz zu versuchen, welche aufgrund historischer Voraussetzungen im westlichen Denken als ein (ausschließlicher) Gegenentwurf zum Begriff der Identität[1] verwendet wurde, ist das Anliegen dieses Kapitels.
Mit dem Ausdruck der Differenz verbunden sind sowohl die klassischen als auch epistemologische sowie ontologische Theorien, welche eng mit analytisch geprägten Fragestellungen in Bezug auf Identifikation, Konstitution sowie Identität verknüpft sind. In der Geschichte der Philosophie ist Differenz dabei in unterschiedlicher Weise von verschiedenen philosophischen Theorien und Problemzusammenhängen verwendet worden.
Die Darstellung und Erschließung des Problemhorizonts erfordert die Reflexion historischer Voraussetzungen, vor allem im Hinblick auf die Entwicklung der Philosophie als Teil des Fortschritts der Weltgeschichte, die zu einer Einheit des traditionellen westlichen Denkens führten. Westliche Philosophie als eine „[…] in sich zusammenhängende Einheit“ (Kimmerle 2001a: 10), hat ihren Anfang in der griechischen Antike. Sokrates, Platon und Aristoteles prägten mit ihren Theorien diesen Abschnitt der Geschichte philosophischen Denkens. Erst durch die bewusste Akzentuierung des Begriffes Freiheit als Freiheit des selbstbewussten Seins[2] war es möglich, die Lehre vom Sein und von den Ursprüngen der Welt zu entwickeln.
Bei Aristoteles besteht eine Differenz aus einem Unterschied: „Verschieden nennt man alles, was ein anderes ist, […] nur nicht der Zahl nach, sondern der Art oder der Gattung oder der Analogie nach. Ferner das, dessen Gattung ein anderes ist“ (Aristoteles: V, 9, 1018a) und etwas Gemeinsamen.
Von Bedeutung sind bei Aristoteles jedoch nur die Gattungs- und Artdifferenzen[3], alle anderen sind nebensächlich. Die maximale Differenz ist die Artdifferenz, da die Differenz der Gattung nur auf einer Entsprechung beruht. Die Repräsentation Aristotelischen Typs (vgl. Himmelreich 1999: 13) zeigt, dass der Prozess der Differenzierung, also Identität und Entsprechung, Gegensatz und Ähnlichkeit stagniert. Durch eine Spezifikation als „ einen Unterschied machen “ durch Verdichtung seiner höchsten Gattung und aller artbildenden Differenzen in einem Begriff kann Differenz als verschieden von einer eigentlichen, begrifflichen Differenz gedacht werden und wird so „[…] zum heimlichen Zentrum einer Tradition der Philosophie.“ (ebd.).
Die mittelalterliche Philosophie stand vor der Aufgabe, die in der Antike geschaffenen Voraussetzungen für das geschärfte Bewusstsein von einem realen Freiheitsbegriff auf das gesamte Volk auszudehnen, die Beschränktheit der antiken Vorstellungen im Denken also aufzuheben.
Beispielhaft kann hier Thomas von Aquin aufgeführt werden, er war und ist aufgrund seiner die Unterschiede umfassenden Integrationskraft und der Besonderheit seines Denkens einer der bedeutendsten Aristotelesrezeptionisten und Gelehrten der Philosophiegeschichte. Als ein Denker der Differenz (neben Duns Scotus und Ockham) und als Gegenentwurf zum dialektischen Einheitstypus[4] der mittelalterlichen Philosophie wie etwa im Denken Cusanus[5] verankert, setzt sich Thomas von Aquin vom Einheitsdenken des Mittelalters und einer „Philosophie im Dienste der Kirche“ (vgl. Kimmerle 2001a: 17) klar ab.
Die gedachte zweifache Differenz von Philosophie und Theologie sowie von Physik und Metaphysik sind ein grundlegendes Merkmal fortschrittlichen Denkens.
Die Frage nach einer theologisch-philosophischen Reflexion von Differenz ist insofern schwierig, da er versuchte, den Differenzbegriff über mehrere einzelne Auslegungen zu definieren. Die verschiedenen Darstellungen von Differenz bezeichnete Thomas von Aquin mit „ differentia secundum numerum “ (Unterschied zwischen stehendem und sitzenden Sokrates), „ differentia secundum speciem “ (Unterschied zwischen den Menschen Platon und Sokrates), „ differentia secundum genus “ (Unterschied zwischen einem Esel und einem Menschen), „ differentia secundum proportionem “ (Unterschied zwischen der Qualität und Quantität); in der grundlegenden Definition bestimmte er „ differentia “ so, dass zwei Gegebenheiten in einem Merkmal übereinstimmen und in einem weiteren verschieden sein müssen: „ […] Distinctio, was hier besagt: insofern ist ein Ding von einem anderen unterschieden, als das eine nicht das andere ist.“ (Thomas von Aquino 1985: 210).
Die Voraussetzung für die Zuschreibung von Differenz ist jedoch, dass Wesen, Dinge und Gegebenheiten, die vergleichend gegenüber gestellt werden, sowohl unterschiedliche Merkmale als auch ein gemeinsames Charakteristikum aufweisen müssen. Nicht von Differenz, sondern von Diversität hingegen spricht er, wenn sich analog gedachte Begriffe in allen Merkmalen unterscheiden. Der Universalienstreit des Mittelalters thematisierte einen Differenzbegriff, welcher in Korrespondenz mit der Auffassung nominalistischer Denkweisen („ via moderna “) und der dazu gegensätzlichen des Realismus („ via antiqua “) trat. Die Diskussion erstreckte sich dabei über Fragen der Begrifflichkeit von Arten- und Gattungsbegriffen im Gegensatz zu konkret benannten Individuen bzw. über Fragestellungen, welche die wirkliche Existenz von universalen Begriffen erörterten[6]. Die Position des Nominalismus vertrat dabei die Ansicht, dass alle allgemeinen Begriffe „nur“ Abstraktionen menschlicher Gedanken und Konstruktionen sind. Als Vertreter eines „ gemäßigten Realismus “ sah Thomas von Aquin die gemeinsame Natur der Individuen in keiner Einheit verschmolzen, sondern nur in einem begrifflichen Inhalt (ratio) konstruiert. Das Universale ist dabei in den einzelnen Dingen realisiert, obwohl es nicht selbst existiert. Er unterteilte hierbei die Universalien in solche, die sich in der göttlichen Vernunft manifestieren (ante rem), in jene, welche als Universales in den Einzeldingen selbst existieren (in re) und die, welche als Begriffe im menschlichen Verstand vorhanden sind (post rem).
Der Unterscheidung von Form: „ […] forma, die gestaltlich wirksame“ (Bernhart 1985: LXXVII) und Materie: „[…] materia, die den Stoff zu einem Ding hergebende Ursache“ (ebd.) maß er - ausgehend von den Auslegungen des Aristoteles - eine große Bedeutung bei. Die Formgebung einzelner Individuen bzw. einer Individuation einer Gattung beruht darauf, dass die Materie durch die Form bestimmt wird.
Die menschlichen Kulturunterschiede bilden nicht nebeneinander stehende Aspekte von Diversität. Vielmehr sind sie Differenzen im Sinne einzelner Unterschiede vor dem Hintergrund von etwas Gemeinsamen.
Die Erfassung der westlichen Philosophie als Einheit wird erst bei Hegel als Beschreibung des Verhältnisses von Weltgeschichte und Philosophiegeschichte als „[…] die notwendige innere Linie der Weltgeschichte“ (Kimmerle 2001a: 15) thematisiert. Das von Hegel entworfene Bild einer Philosophiegeschichte, welches die „[…] substantiellen, staatlich-gemeinschaftlichen und die subjektiven, die einzelne Person betreffenden Aspekte der Freiheit vollständig miteinander vermittelt.“ (ebd.: 17) und später von Nietzsche umgedeutet wurde, trug maßgeblich zur Entwicklung eines „modernen“ Differenzdenkens bei. Eine Geschichte der Philosophie, die ausgehend vom Prinzip der Vernunft, in Richtung einer vollkommenen Freiheit weist, ist das Ziel der Weltgeschichte[7], Ziel des Geistes, denn: „[…] die Philosophie aber lehrt uns, daß alle Eigenschaften des Geistes nur durch die Freiheit bestehen, alle nur Mittel für die Freiheit sind, alle nur diese suchen und hervorbringen.“ (Hegel 1995: 30).
Ein Geschichtsbild, welches ein „äußeres substantielles“ und “inneres subjektives“ (vgl. Kimmerle 2001a: 17) Bewusstsein von Freiheit in sich vereint, führt über die philosophischen Entwicklungen bei Descartes, Hobbes, Hume, Rousseau, Leibniz und Kant über Hegel schließlich zu Nietzsche, welcher eine nihilistische[8] Umdeutung des traditionellen Geschichtsbegriffes versucht vorzunehmen. Als Herausbildung dekadenter kultureller Entwicklungen, welche dem Verfallsprozess unterliegen, sieht er Werte verfallen und Moral verkommen: „[…] er entlarvt sie [die Moral] so als nachträgliche Rationalisierung triebhafter Bedürfnisse und als Überdeckung von Schwächen zu Lasten der Starken.“ (Sendlinger 2006: 240). Die Kritik am moralischen Verfall, vor allem auch der christlichen Werte, artikuliert Nietzsche im Sinnbild einer der sich aus der Herrenmoral entwickelnden Sklavenmoral, die als die Haltung der „ Elenden […], Armen, Ohnmächtigen, Niedrigen“ (Nietzsche 1990b: 24) die zuerst die Herrschenden und Glücklichen als böse bewerteten und sich selbst dann als deren Gegensatz ausmachten.
Im Kampf gegen die Metaphysik des Abendlandes richtet sich seine Kritik und Umdeutung insbesondere gegen die (angenommenen) wissenschaftlich unreflektierten Moralvorstellungen, die ein wirklich aufgeklärtes Denken bisher nicht zulassen, denn: „[…] wir haben eine Kritik der moralischen Werte nötig, […] und dazu tut eine Kenntnis der Bedingungen und Umstände not, aus denen sie gewachsen“ (ebd.: 9).
Wichtig in diesem Zusammenhang ist ihm die Frage nach dem Wert moralischer Systeme bzw. die Beschäftigung der Wissenschaften mit diesem Thema: „[…] a lle Wissenschaften haben nunmehr der Zukunfts-Aufgabe der Philosophen vorzuarbeiten: diese Aufgabe dahin verstanden, dass der Philosoph das Problem vom Werthe zu lösen hat, dass er die Rangordnung der Werthe zu bestimmen hat.“ (ebd.: 48).
Die Umkehrung der Geschichte der Philosophie scheint Nietzsche vor dem Hintergrund einer „ unerreichbaren wahren Welt “ notwendig, um die Umwertung der abendländischen Philosophie zu einer Periode der Lebensbejahung mit „Lachen, Spiel und Tanz“ (vgl. Kimmerle 2001a: 19) einzuleiten. Seine Abneigung gegen die westliche Philosophie und jegliche Art von philosophischen Systemen - „Ich mißtraue allen Systematikern und gehe ihnen aus dem Weg. Der Wille zum System ist ein Mangel an Rechtschaffenheit.“ (Nietzsche 1990c: 260) - zum einen und seine Umdeutung dieses Systems zum anderen, stellten sich richtungsweisend auf die Entwicklung eines neuen gedanklichen Moments im Differenzdenken heraus. An Nietzsches Interpretation vom Begriff der Wahrheit - die Abschaffung der Idee einer wahren Welt - wird deutlich, dass es einen neuen Stil des Philosophierens[9], ein neues Denken und Schreiben braucht, um Ansätze der Überschreitung zu befördern bzw. die Überwindung traditioneller Philosophie zu wagen.
Die Orientierung Adornos an der kritischen Beurteilung der traditionellen westlichen Philosophie Nietzsches zieht im Zusammenhang des Bemühens zur Überwindung der „alten“ Einheit eine Initiierung neuen Differenzdenkens nach sich.
Adorno vertritt hierbei die Position eines kritischen Hegelianismus, indem er Hegels Idee eines komplexen philosophischen Systems nicht mittragen kann und reflektiert „ […] auf den Preis, den jede begrifflich-systematische Philosophie zu entrichten hat, nämlich das Individuelle und Nichtidentische zuzurichten und zu verstümmeln, anstatt es wirklich zu begreifen. “ (Lang 2004: 4).
Die vereinheitlichende Ordnung westlicher Philosophie, in welcher „[…] das Besondere von einer höchsten Allgemeinheit oder Identität abgeleitet.“ (Kimmerle 2001a: 21) wird, ist nach Adorno keinesfalls in der Lage, Nicht-Identisches in diese allgemeine Ordnung einzugliedern. An dieser Stelle setzt seine Absicht, dem Identitätsdenken ein Konzept des Besonderen entgegenzusetzen, ein. Den Fortschrittsgedanken der Aufklärung sieht er durch den elementaren Zusammenhang von traditioneller Philosophie und dem kapitalistischen, totalen Herrschaftsdenken zunehmend gefährdet[10]: moralische Wertvorstellungen werden aufgelöst. Sein Konzept von „ Kunst als Protest und Utopie “ (vgl. ebd.: 22) nimmt er in die Pflicht, diesen „ totalen Beherrschungs- und Verblendungszusammenhang “ (ebd.) aufzuheben und dem zu begegnen, indem Kunst als über die gesellschaftliche Wirklichkeit hinausragende utopische Dimension selbst negativ-dialektisch[11] artikuliert und verstehbar wird. Kunst (als das Medium, Nicht-Identisches auszudrücken) wird autonom, indem sie die Versöhnung der nicht auflösbaren Antinomien[12] befördert sowie neben dem „Schönen“ auch und vor allem das „Hässliche“ in die Wirklichkeit aufzunehmen versucht.
Differenz radikaler zu denken, heißt, Differenz nicht nur vom ihr Zugrundeliegenden zu denken, sondern auch und vor allem „[…] von sich selbst her in ihrer Eigenart zu erfassen. “ (Kimmerle 2001b: 3); in diesem Kontext wagt Adorno durch die Idee des Besonderen als Identität des Nicht-Identischen die Annäherung an einen neuen Differenzbegriff. Ein neues Denken muss also in der Lage sein, in Fragmenten oder Modellen offene Bereiche für alles Besondere anzubieten.
Auch Heideggers Interpretation vom Begriff der Philosophiegeschichte ist eine nihilistische, da „[…] angenommene Werte und deren Begründung einer kritischen Nachfrage nicht standhalten. “ (Kimmerle 2001a: 74). Das Thema von Identität und Differenz wird bei Heidegger Gegenstand der Kontroverse mit Hegel; im Gegensatz zu Hegel ist für Heidegger das Motiv des Nachdenkens nun „die Differenz als Differenz" statt Identität.
Heidegger überführt Adornos Kritik an traditioneller Philosophie in die Kernfrage nach dem Sein. Seine Vorgehensweise richtet sich vor allem gegen die westliche Denkweise einer ausschließlichen Betrachtung des Seienden, ohne die Frage „[…] was es überhaupt bedeutet, dass sie sind“ (ebd.: 22) näher zu betrachten. Er grenzt - in Ablehnung der abendländischen Metaphysik - das Sein vom Seienden ab. Das bestimmte Seiende - das Bewusstsein, die Idee, die Substanz - wurde bis zu diesem Zeitpunkt an den Ort des Seins gesetzt.
Seine Kritik an der westlichen Philosophie stellt sich dar, indem Heidegger auf die „Seinsvergessenheit“[13] hinweist: das Sein selbst wurde ausgeblendet; die Frage nach dem „ist“ nicht gestellt. Systematische Philosophie subsumiert alles Seiende unter dem Prinzip vom ersten Ursprung (das Göttliche, die Idee, Gott…) - das Sein bleibt nicht gedacht.
Mit dem Gedanken einer „ontologischen Differenz“ stellt Heidegger eine neue Begrifflichkeit von Differenz heraus, welche man als Durchbruch im Differenzdenken bezeichnen kann. Ontologische Differenz[14] als die Abweichung des Seins vom Sein des Seienden bedeutet, dass das Sein als Da-Sein selbst in seinem Sinn verständlich wird; dabei entsteht das Da-Sein aus dem Sein. Da-Sein als Sein eines bestimmten Seienden sieht Heidegger im Menschen verwirklicht; in diesem Sinne zeigt er, „[…] dass allein vom Menschen aus ein Verständnis des Seins und damit der Sinn des Seins zu finden sein kann.“ (Sendlinger 2006: 138).
Identitätsdenken[15] westlicher Philosophie sieht die Differenz zwischen zwei verschiedenen Seienden immer als die Differenz zwischen zwei im Prinzip gleichen Dingen, da es in Wirklichkeit keine zwei identischen Dinge gibt- außer man fabriziert diese auf künstlichem Wege (vgl. Kimmerle 2001a: 79). Man darf also davon sprechen, dass die „Differenz dem Wesen der Identität entstammt. “ (vgl. ebd.).
Dem Begriff der Differenz kommt in diesem Zusammenhang auch die Bedeutung einer „Konstellation von Sein und Mensch“ zu, sichtbar gemacht im Konstrukt des „Ge-stells“[16], als „ […] Vorspiel dessen, was Ereignis heißt. “ (vgl. ebd.).
Überkommnis (das Ereignis überkommt das Seiende) und Austrag (das Vorspiel wird ausgetragen) stellen beide das gleiche Begebnis dar, aber von zwei verschieden Seiten aus: von der des Seins und der des entgegennehmenden Menschen. Beide Teile bilden zwar ein Ganzes, sind aber trotzdem unterschiedlich: „ Die Differenz von Sein und Seiendem ist als der Unter-schied von Überkommnis und Ankunft der entbergende Austrag beider “ (Heidegger 1999: 57).
Mittels einer „Destruktion der Metaphysik“ möchte Heidegger ein gänzlich neues Denkschema befördern: das Vergessene an die Oberfläche zu bringen, Nicht-Gedachtes zu denken, den Grund für die Vergessenheit zu finden und damit einen neuen Horizont im Denken zu öffnen. Dieses Anliegen setzt er um, indem er die Seinsfrage zum zentralen Thema seiner Arbeit macht. Heidegger destruiert die Geschichte der Philosophie als Geschichte der Seinsvergessenheit. Ziel der Destruktion soll es also sein, die „[…] verborgene Dimension des metaphysischen Denkens“ freizulegen und damit die „[…] Temporalität der ontologischen Grundbegriffe.“ (Kimmerle 2001a: 76). Ein Denkschema, welches die Sprache des Denkens und den Begriff von Identität neu überdenkt. Dabei soll der Gegensatz von Identität und Differenz nicht-dialektisch in einer Weise betrachtet werden, die es erlaubt, beide Begriffe in ein unbeanspruchtes Verhältnis zueinander zu setzen.
In Fortführung dieser theoretischen Grundlagen, d. h. die Vorbereitung eines neuen Differenzbegriffs, nehmen die Theorien moderner französischer Differenzdenker eine besondere Stellung ein, vor allem in Bezug auf die weitere Ausarbeitung und Vermessung eines neuen Denkgebiets der Philosophie.
So war die Bezugnahme des französischen Philosophen Deleuze auf Heideggers „Philosophie der ontologischen Differenz“ prägend für sein Denken. Er versuchte den Begriff der Differenz entsprechend der gesteigerten gesellschaftliche Reflektion abweichend und: „[…] jenseits der klassischen Kategorien von Identität, Ähnlichkeit, Analogie und Gegensatz.“ (Welsch 1997: 141) zu denken. Deleuze macht Differenz in seinem frühen Hauptwerk „ Differenz und Wiederholung“ zum Thema, dessen Kernaussage es ist, herauszustellen, dass traditionelle Philosophie keinen positiven Differenzbegriff zu entwickeln in der Lage ist. Sich der Bewegung des Denkens zu überlassen, um „[…] in die Dimension des Denkens eindringen [zu können], die sonst als Ungedachtes [ … ] scheint“ (Kimmerle 2001a: 28, vgl. Balke, Vogl 1996), bestimmte seine Art, philosophisch zu denken. In kritischer Anlehnung an die Dialektik Hegels wird deutlich, dass Deleuze in der Absicht, sich dieser entgegenzustellen, die komplexe „vertikale“ Wiederholung anstelle eines komplizierten Ablaufschemas von These, Antithese und Synthese in das Zentrum seiner Arbeit stellt. Es wiederholt sich nicht Dasselbe, sondern ein Anderes. Im Kontext einer Auseinandersetzung mit Differenz bzw. der Herausbildung eines neuen Differenzbegriffs, lässt sich feststellen, dass Deleuze den traditionellen Differenzbegriff nun anders erfassen will: Differenzen werden dabei nur noch auf andere Differenzen bezogen. Dazu führt er den Gedanken einer freien[17] und reinen Differenz ein, welche unbedingt mit dem Moment der Wiederholung korrespondieren muss. Gemeint ist hierbei nicht die begriffliche Differenz, „[…] sondern eine Differenz, die sich, indem sie begrifflich erfasst wird, dem Begriff auch entzieht.“ (Kimmerle 2001b: 6). Die neue, unbegriffliche Differenzbestimmung zeigt, dass der wirkliche Gegensatz „[…] nicht ein Maximum an Differenz, sondern ein Minimum an Wiederholung, eine auf zwei reduzierte Wiederholung“ (Deleuze 1992: 11f) ist, sowie vom Begriff der differentiellen und differenzierenden Wiederholung abgelöst werden kann. Die Weiterentwicklung des Differenzbegriffs sieht Deleuze in der Verwendung einer Rhizom-Metapher, welche sinnbildlich für ein ständig mit der Umwelt in wechselseitigem Tausch stehendem Wurzel-Trieb-System steht; es „[…] knüpft transversale Verbindungen zwischen divergenten Entwicklungslinien; […] es erzeugt unsystematische und unerwartete Differenzen.“ (Welsch 1997: 142).
Im Anschluss an die Neuinterpretation des Differenzbegriffs bei Deleuze geht Lyotard den Weg einer näheren Bestimmung über sprachlich vermittelte Instanzen. In seinem Werk „ Das postmoderne Wissen “ erkennt er das Scheitern der philosophischen Systeme der Moderne und spricht vom „Ende der Metaerzählungen“ oder einem „Nullpunkt des Sinns“. Die Annäherung an einen neuen Differenzbegriff sucht Lyotard über die Sprache, indem er feststellt, dass der Akt des Sprechens den Metaregeln als Regeln einer höheren Begründungsstufe (vgl. Kimmerle 2001a: 30) nicht mehr folgen kann. Die moderne Erzählung als Deutung der Welt, welche Lyotard den Begriff vom philosophischen System ersetzen lässt, basiert auf der Grundlage eines angenommenen zentralen Prinzips (wie etwa Gott) allgemeiner Aussagen, welche das Verschiedene, das Unterschiedliche ausschließen und damit das Besondere einebnen. Unser Sprechen ist ein spielerisches - einzelne Wörter folgen aufeinander. Daher bringt Lyotard in diesem Zusammenhang Sprachspiele[18] in die Diskussion, welche heterogene Erklärungsmodelle anbieten und somit keinen übergeordneten Metaregeln folgen können. Im daraus folgenden, nicht zu schlichtenden Widerstreit zwischen den Wörtern eines Satzes und den Sätzen eines Diskurses entsteht eine Spalte, welche Lyotard als „[…] eine irreduzible und insofern bleibende, fortdauernde Differenz“ (Kimmerle 2001a: 31) bezeichnet.
Den Begriff der Differenz zu denken, indem Lyotard Kritik an der „[…] Tendenz zum Terror gleichförmiger Handlungsimpulse“ (ebd.: 43) übt, wird nun möglich, indem er die Heterogenität sowie Vielgestaltigkeit sprachlicher Spiele[19] betont. Le différend - der Widerstreit - weist daraus resultierend darauf hin, dass „[…] eine universale Urteilsregel in bezug auf ungleichartige Diskursarten fehlt.“ (vgl. Lyotard: 1986: 188ff). Lyotard definiert den Begriff der Differenz also über eine Sprache, welche „[…] keiner Regel gehorchend und in sich widerstreitend interpretiert wird. “ (Kimmerle 2001b: 56).
Im Differenzdenken Deleuzes und Lyotards wird Differenz radikal gedacht in Hinsicht auf das Denken von Differenz als dem bloßem Gegenteil zum Identischen: Deleuze macht eine neue Art des begrifflichen Denkens zur Voraussetzung, Differenz neu zu erfassen.
Derrida hingegen gilt als „[…] Begründer der Praxis der Dekonstruktion, die zugleich eine Destruktion der abendländischen Metaphysik einläutet und in ihrer Zerlegung der abendländischen Denktradition etwas Neues schafft. “ (Moebius, Wetzel 2005: 25) und knüpft damit an Heideggers Konzept der „Destruktion der Metaphysik“ an.
Dieser Kontext eröffnet die Perspektive, aus der Dekonstruktion heraus und in ihr zu dekonstruieren. Destruktion als Zerstörung und Konstruktion als Aufbau sind beides Elemente der Dekonstruktion. Derrida definiert den Vorgang der Dekonstruktion nicht als Methode, sondern als praktische Durchführung bezogen auf den jeweiligen Gegenstand. Er weist verschiedene Bedeutungsebenen und Sinngehalte in Texten nach, welche vom Autor nicht intendiert sind. So dekonstruiert er einen Text, indem er mittels Auffinden von mehrdeutigen Schlüsselwörtern das Gefüge in neue Sinnebenen überführt und Ungeahntes, Vergessenes hervortreten lässt. Seine Untersuchungen erstrecken sich vor allem darauf, die in Texten unbemerkten Aussagen bzw. das Nicht-Gesagte aufzuspüren - er „[…] unterbricht damit den hermeneutischen Zirkel der ganzheitlichen Auslegung“ (ebd.: 26)[20] - und legt damit bislang nicht erörterte Dimensionen traditionellen Denkens frei.
Ausgangspunkt seiner Überlegungen zum Verhältnis von gesprochener Sprache und Schrift ist die Kritik über die vorrangige Stellung der „Instanz der Stimme“ (vgl. Kimmerle 2001a: 32) als die Repräsentation eines innerlich Bewussten bei Husserl[21]. Sprache und Schrift haben bei Derrida den gleichen Ursprung, wobei er einen neuartigen Schriftbegriff voraussetzt: Schrift gilt nun nicht mehr als ein Zeichensystem[22], sondern als eine lesbare Spur (oder Spuren von Spuren), deren kontingente, niemals vollständig rekonstruierbare Bedeutung im ständigen Wandel begriffen ist: „[…] Sprache ist der Zusammenhang von aufeinander verweisenden Spuren.“ (Kimmerle 2001b: 63). Hier setzt Derridas Kritik an der ethnozentristischen (und phonozentristischen) Betrachtungsweise westlicher Philosophie an, die die Rangordnung der Kulturen abhängig vom Vorhandensein einer durch Buchstaben vermittelten Schrift (im Gegensatz zu schriftlosen Kulturen) macht. Mit dem Urteil der Gleichrangigkeit von Schrift und Sprache führt Derrida die Rangordnung der Kulturen ad absurdum, indem er den Unterschied begleicht.
Im Bestreben, die Paradigmen westlicher Metaphysik zu überwinden, setzt er auf die Dekonstruktion metaphysischer Texte, das bedeutet, er wagt Überschreitungen, die „ […] nicht mehr metaphysisch und noch nicht nachmetaphysisch oder der bereits gelungene Ausdruck eines neuen Denkens sind.“ (Kimmerle 2001a: 34).
In Anlehnung an Heideggers Konstrukt der Seinsvergessenheit bestimmt Derrida den Differenzbegriff als das Hervorgehen der Differenz als ein nicht determiniertes Grundgeschehen, da er nicht von verschiedenen Ursprüngen, Diskursen oder Ordnungen ausgeht; er strebt danach, den Differenzbegriff so radikal und fundamental wie nur möglich zu fassen. Differenz ist in dem Sinne also kein Begriff, sondern ein Paradoxon, welches das Entstehen von Verschiedenheiten als das Allgemeinste begreift.
Bei dieser Begriffsbestimmung benutzt er[23] den Neologismus „différance“, welcher sich aus dem Wort „différence“ und der Endung „-ance“ zusammensetzt. Das neu geschriebene Wort bezeichnet Derrida als ein Bündel, das die Sinn-Fäden und Kraftlinien im Gewebe bzw. im Text zusammenführt und - mit der Option, „ andere hineinzuknüpfen“ (vgl. Derrida 2004: 111) - auch wieder Lücken schafft.
Von großer Bedeutung in diesem Kontext ist es, das Derrida mit der Verwendung des „a“ statt des „e“ auf ein Geschehen verweist; „[…] er unterläuft die in der abendländischen Ideengeschichte fundamentale Identität von gesprochenem und geschriebenem Zeichen und das Primat des gesprochenen Wortes.“ (Moebius, Wetzel 2005: 67)[24].
Die Tragweite der begrifflichen Inhalte von différance zeigt sich in der Analyse des Begriffs insofern, dass die zwei Bedeutungen des Verbs „différer“, das eine Aktivität ausdrückt (Zum einen bedeutet es als Partizip Präsens „aufschieben“, zum anderen „anders sein“.), Derridas Begriff von différance nahekommen. Die mehrdeutige différance steht dabei für „[…] die Tätigkeit des Aufschiebens zum Zustand des Andersseins.“ (Kimmerle 2001b: 69), also für den doppelten Gestus der Differenz, d. h. vor allem Zwischenräumlichkeit und Temporisation.
Auf welchen Zusammenhang Derrida an dieser Stelle verweisen möchte, ist seine Intention, différance als die Voraussetzung der Möglichkeit von Bedeutungen und Sinn zu kennzeichnen bzw. als dem Moment der Bewegung, welches Sprache als „das permanente Gleiten von Sinn“ (vgl. Moebius, Wetzel 2005: 71) konstituiert. Dabei ist zu beachten, dass die Bedeutung von Zeichen vom jeweiligen Kontext abhängig ist oder in einem anderen Zusammenhang etwas ganz anderes ausdrücken kann - der Sinn wird zerstreut. Derrida nennt diesen Vorgang dissemination, als den „[…] unendlichen Prozess der Zerstreuung und die theoretische Unmöglichkeit einer endgültigen Fixierung von Sinn.“ (ebd.: 72). Daraus folgt ein Offenhalten des Systems, welches dem Kommenden sowie dem Anderen Zuflucht gewähren kann; ein weiterer Denkansatz des späteren Derrida im politischen und ethischen Kontext, welcher das Verständnis von Gerechtigkeit und Demokratie mit dem Begriff der différance zusammenbringt.
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die verschiedenen philosophischen Arbeiten „[…] bei aller Unabhängigkeit voneinander um ein neues Denken der Differenz kreisten“ (Engelmann 2004: 13), welches in der Lage sein sollte, kulturelle, politische sowie philosophische Alternativen zu Formen des Totalitarismus bzw. zu den traditionellen Paradigmen metaphysischer Philosophie zu eröffnen. Gemeinsam sind den Differenzdenkern dabei die kritische Beurteilung westlicher Philosophie sowie eines auf Identitäten bezüglichen Differenzbegriffs. Als wirkliche Alternative[25] im Rahmen der Metaphysikkritik stellte sich heraus, dass diese Kritik immer Sprachkritik sein muss: Sprachkritik in Form der Auflösung des klassischen Diskurses und daraus folgend die Ausrichtung auf literarische Erörterungen als dem Versuch[26], philosophische Problemstellungen zu analysieren und zu lösen.
Einen neuen Begriff von Differenz denken bedeutet, „[…] nicht identifizieren, das Andere und Verschiedene nicht zurückführen auf das Selbe und das Gleichartige.“ (Kimmerle 2000: 17). Die Suche nach einem neuen bzw. anderen oder gemeinsam gedachten Differenzbegriff eröffnet vor allem im praktischen Denkrahmen die Möglichkeit, konkrete Schritte in Richtung neuer Fragestellungen, auch im aktuell-politischen Problemzusammenhang, gehen zu können.
Es ist an dieser Stelle nicht Aufgabe, dialektischem Denken in jeder Beziehung abzuschwören, sondern anzuerkennen, dass „[…] dialektische Verhältnisse im Denken der Differenz ihren begrenzten, aber berechtigten Ort haben.“ (Kimmerle 2001a: 13). Den Streit oder Widerspruch zwischen dialektischem und neuem Denken als eine Form von Differenz zu begreifen, muss Anliegen sein, um Ausgestaltungen des philosophischen Dialogs - wie etwa im Bestreben der Überwindung des Ethnozentrismus - auf den Weg zu bringen und die Voraussetzungen dafür zu schaffen, den Durchbruch zu einer auch interkulturell[27] verstandenen Philosophie zu befördern.
Einen erweiterten Zusammenhang des Differenzbegriffs zu denken, ist Auftrag der Philosophie im Sinne der „Erschließung eines neuen Gebiets“ (vgl. Kimmerle 2001c: 3), der Politik und praktischen Anwendung des neuen, befreienden Begriffs. Neu auch in dem Sinne, dass die bis dahin konservative Einstellung westlicher Philosophie abgelöst wird von einem erstmalig weiblich gedachten Differenzbegriff.
2.2. Der Mensch ist zwei oder das Denken sexueller Differenz als theoretischen Entwurf
„[…] wir müssen wohl oder übel erkennen, dass wir nur dann anders sehen, wenn die Geschlechterdifferenz im philosophischen Blick zur Geltung kommt.“ (Fraisse 1996: 139)
„Die Frau muss sich von der Welt trennen, die ihr als einzige auferlegt ist, eine Welt gründen, die ihr eigen ist, und die Mittel zur Koexistenz mit einer Welt definieren, die sich nicht auf die ihrige reduziert.“ (Irigaray 2008: 18)
Die thematische Auseinandersetzung mit dem Begriff der Geschlechterdifferenz wird seit den 1980-er Jahren als ein Effekt der 1968-er „Neuen Frauenbewegung“[28] immer mehr im Zentrum der feministischen Philosophie und Theoriebildung verortet. Unter dem Ausdruck „umbrella term“ prägte diese Art von Philosophie die gesamte folgende Ausdifferenzierung der Debatte um die Aufhebung der Benachteiligung der zum weiblichen Geschlecht Zugehörigen. Die anfängliche Theoriefeindlichkeit, welche sich in der Angst begründete, zur „ […] Festigung des Primats patriarchalischer Wissenschaftsvernunft“ (Bussmann 1998: 2) beizutragen, wich zunehmend einer theoretischen Beschäftigung mit dem Thema.[29] Die Situation trug dazu bei, in mehr als dreißig Jahren Standpunkte feministisch geprägter Philosophie zu etablieren und in den wissenschaftlichen Kontext einzubringen. Die Argumentation aktueller feministischer Philosophie ist eine auf der Grundlage des anderen, „weiblichen Blicks“ basierende, welche die Erkenntnis von parteilichen philosophischen Machtstrukturen (vgl. ebd.: 5) zum Anlass nimmt, Philosophie und Sprache der Begriffe aus weiblicher Perspektive heraus neu zu interpretieren sowie frauliche Sicht- und Denkweisen zu thematisieren. Feministischer Philosophie wird mit Irigarays Konzept des Weiblichen eine Vorstellung zur Seite gestellt, welches die Differenzen betont und für die Akzeptanz und Anerkennung geschlechtlicher Differenzen plädiert bzw. nach einer „[…] Funktionsweise, in der sich das Besondere des Weiblichen als Weibliches betätigen könnte“ (Meyer 1983: 123) sucht. Weibliches Denken versteht sich als ein Denken innerhalb weiblicher Begriffsstrukturen, deshalb kann Frau sich auf sich selbst als ein Anderes rückbesinnen, ohne- im Blickwinkel feministischer Philosophie verortet- sich „[…] innerhalb der alten Repräsentationen und Begriffe wiederum festschreiben“ (Bussmann 1998: 12) zu lassen.
Die eher politische Ausrichtung älterer feministischer Konzepte[30], basierend auf der Annahme eines asymmetrischen Geschlechts, zeigt sich in dem Wunsch nach der „[…] Abschaffung des Patriarchats durch Kritik und Auflösung seiner ideologischen Fundamente. “ (ebd.: 11) und im Kampf für gleiche Rechte und Pflichten beider Geschlechter. Dem Konzept vom androgynen Menschen (alle Geschlechter besitzen potentiell dieselben Fähigkeiten und Merkmale) spricht man dabei die Kompetenz zu, Gleichheit für alle Geschlechter zu vermitteln und somit patriarchale Machtstrukturen zu überwinden. Die Betonung dieses geschlechtsneutralen Ansatzes liegt auf der Ausschaltung jeglicher Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Damit und mit der Verneinung der weiblichen Natur wird Weiblichkeit negiert[31] und ihrer Möglichkeit zum Diskurs beraubt.
Dem Begriff der Geschlechtsneutralität wird nun der einer geschlechtsspezifischen Ausrichtung entgegengesetzt, der das Weibliche positiv akzentuiert sowie die „Determinante Natur“ (vgl. Meyer 1994: 141) impliziert.
Das Denken der Geschlechterdifferenz interpretiert sexuelle Differenz zum einen als Kategorie des geschlechtlichen Unterschieds, zum anderen als philosophisches Konzept, das die Analyse des Verhältnisses zwischen den Geschlechtern verfolgt und dabei das Ziel anstrebt, „[…] immanente Geschlechterkonstruktionen aufzudecken, die unter der Form universalistischer Begriffe Frauen zweitrangige Positionen zuschreiben.“ (Drygala 2005: 72). Die aktuelle Diskussion geht von der Beziehung der Geschlechter zueinander als einem „sprachlich differenzierten Prozess“ aus.
Ausgangspunkt diverser, Geschlechterdifferenz thematisierender Konzepte ist die Feststellung der dem Männlichen zugeschriebenen Subjektbedeutung in traditioneller Philosophie.
Traditionelle Philosophie definiert Denken generell aus männlicher Perspektive heraus, wobei „[…] die Ausgrenzung der Frau aus der Philosophie nicht auf die naive Annahme der Ungeschlechtlichkeit zurückzuführen, sondern Absicht sei.“ (Meyer 1994: 38). Obwohl allgemein Neutralität vermittelt wird: das Weibliche besitzt keine akzeptierte Stellung[32] im philosophischen Diskurs, denn es gibt nichts außerhalb des männlich Gedachten. Dieses Nicht-Existieren wird deutlich anhand einer fehlenden, weiblichen Sprache. So ist es nicht möglich, sich in der Fiktion einer Weiblichkeit zu erkennen, die traditionell in der Philosophiegeschichte vermittelt wird. Geschlechterdifferenz wurde im Rahmen patriarchal geprägter Philosophie nicht thematisiert, obwohl durchaus Ansätze eines Differenzdenkens, zum Beispiel im künstlerischen sowie mythischen Blickfeld[33], nachweisbar sind. Daraus folgend wurde mittels maskulinem Herrschaftsanspruch das Männliche dem Weiblichen übergeordnet und damit „[…] dem philosophischen Subjekt das Attribut des Eins-Seins [verliehen] und von seinem geschlechtlichen Körper befreit. “ (ebd.: 144).
Das philosophisch eigentlich neutrale Subjekt ist daher männlich besetzt, „[…] Maskulinität und Subjektivität sind bedeutungsgleiche Bezeichnungen “ (Schor 1992: 226), die Frau ist Nicht-Mann und existiert nur innerhalb eines männlich bestimmten Horizonts als Projektionsfläche seiner Gedanken und Sprache; die Identifikation der Frau mit sich selbst und ihrer Weiblichkeit liegt im Bereich des Unmöglichen.
An dieser Stelle setzt der Prozess des Umdenkens in der Philosophie ein. Mit verschiedenen Konzepten zur Bestimmung der Geschlechterdifferenz soll es möglich werden, die wissenschaftliche Diskussion fruchtbar für integrationsfördernde Konzeptionen zu machen und zugleich für die Entledigung den Diskurs behindernder Herrschaftsformen zu sorgen.
Dieser neu gedachte Differenzbegriff wird im Umfeld der französischen Philosophie verortet, wobei traditionelle Reflexionsformen und Wege im Denken verlassen werden, indem der Differenzbegriff eben nicht den Gegensatz „Identität und Differenz“ thematisiert, sondern als „Gestalt“ von Differenz - Verschiedenheit des Anderen, Macht der Diskurse oder sexuelle Differenz - gedacht wird.
Vor allem in postmodernen und poststrukturalistischen[34] Ansätzen drängen Themen wie Sprache, Sprachkritik oder Subjekt sowie die reziproke Wirkung von Gesellschaft und Macht an die Oberfläche. Besonders das Thema vom „Tod der Metaphysik“ wird in diesen Gedankengängen aufgegriffen, da traditionelle westliche Philosophie „[…] das Ziel hat die Welt zu beherrschen, indem sie ein absolutes System aufbaut, dem ein einheitliches […] Wesen zugeschrieben wird“ (Meyer 1994: 149), ebenso wie das Motiv vom „Tod des Subjekts“, welches feministisch gedacht den Subjektterminus vom universalen und insbesondere vom männlichen Anspruch befreien möchte. Den Schwerpunkt feministisch-postmodernen Denkens bildet die Sprachkritik. Hierbei kristallisiert sich mittels Analyse ein Sprachbegriff heraus, welcher die Herrschaftsverhältnisse im gesellschaftlichen sowie diskursiven, bedeutungsstiftenden Kontext widerspiegelt.
Zusammenfassend kann man feststellen, dass das weibliche Subjekt als zentrales Element feministischer Theorien im Blickfeld eines auf die Entmachtung des universalen männlichen Subjekts gerichteten Lösungsansatzes steht, der versucht, der Frau den Status eines reflektierenden Subjekts zuzuerkennen (vgl. ebd.: 155) und somit die Möglichkeit einer (neuen) sprachlichen Ausdrucksweise, die weibliches Selbstverständnis zum Ausdruck bringen kann.
Beispielhaft für die Vertreter der Theorien des Gleichheitsfeminismus steht Simone de Beauvoir- sie thematisiert im Kontext der philosophischen Auseinandersetzung erstmalig die gesellschaftliche Stellung der Frau, indem sie den Unterschied zwischen dem Mann als „[…] das Subjekt, er ist das Absolute“ (Beauvoir 1992: 12) und der Frau als „das Andere“, intellektuell vom Männlichen abhängige, reflektiert, welche als nicht-autonome Gestalt in totaler Abhängigkeit vom männlichen Denken oder in „marginaler Anwesenheit“ existiert. Sie schreibt nicht über Frauen an sich, sondern stellt die Frage „Was ist eine Frau?[35] “ und genau darin liegt der qualitative Bruch in der Kritik an traditioneller Philosophie. Ihre Erkenntnisse beziehen sich auf die Frau als relatives Wesen innerhalb des männlich gedachten und interpretierten Bedeutungshorizonts. Hierbei stellt Beauvoir in ihrem Buch „Le deuxiéme Sexe“ die Herrschaft des Männlichen als einer auf dem Verhältnis zwischen dem Mann als handelndem Subjekt und der Frau als nicht-handelndem Objekt beruhende Tatsache heraus. Damit ist es ihr möglich, einen Typus von Denken zu entwickeln, der es ermöglicht, dass Frauen sich selbst zu reflektieren in der Lage sind. Sie sieht das biologische Geschlecht der Frau als soziales Konstrukt aus einem Gemisch der jeweils herrschenden moralischen Vorstellungen und Gebräuchen einer Kultur: „ Man kommt nicht als Frau zur Welt, man wird es. “ (ebd.: 265), welches ihre Unterdrückung bedingt. Im biologischen Körper der Frau macht Beauvoir die Basis für die Unterdrückung durch den Mann aus, entscheidend ist dabei vor allem ihre Fähigkeit zur Reproduktion[36], in der sie „[…] Beispiele dafür, wie der Körper der Frau für sie selbst ein Hindernis darstellt.“ (Stoller 2010: 44) ausmacht. Hierin erblickt sie die Ursache der fehlenden Identität: durch Entfremdung des eigenen Körpers wird die Vermittlung einer eigenen Identität unmöglich.
Um eine Veränderung der Perspektiven im Hinblick auf das Verlangen des weiblichen Geschlechts nach Selbstbestimmung und Unabhängigkeit herbeizuführen, ist es notwendig, die Voraussetzungen zu hinterfragen, welche die Herrschaft des Männlichen begründen[37]. Der spätere feministische Diskurs sieht die „[…] Notwendigkeit einer erkenntnistheoretische Anerkennung des weiblichen Geschlechts“ (Drygala 2005: 12) nicht mehr als die primäre Vorbedingung für die Gestaltung einer unabhängigen Geschlechterbeziehung; vielmehr verlagert sich die Diskussion auf den Schwerpunkt einer „[…] strukturierenden Instanz, in der Weiblichkeit reflektierbar ist.“ (ebd.) Die Überwindung der Asymmetrie zwischen Mann und Frau als eine politische Kategorie war Beauvoirs nachdrückliche Forderung; der Gleichheitsfeminismus machte die Herausbildung einer Geschlechtersymmetrie zum Gegenstand seiner Beschäftigung mit der angenommenen ungleichen Behandlung der Geschlechter. In dieser Beziehung ist es wichtig zu betonen, dass Asymmetrie nicht den Unterschied zwischen den Geschlechtern an sich bezeichnet, sondern „[…] die Interpretation und Bewertung des Geschlechterunterschieds und die daraus folgenden politischen, ethischen und sozialen Konsequenzen.“ (Soiland 2010: 296).
In darauf folgenden Positionen brachte man moralische und erkenntnistheoretische Darlegungen zusammen (Anti-Essentialismus-Projekt) bzw. entgegnete der Herabsetzung des Weiblichen mit dekonstruktivistischen Konzepten. Der so forcierte Perspektivenwechsel leitete ein neues Denken über Weiblichkeit ein, welches das Konzept „gender“ als die Identität und Gleichheit der Geschlechter anstelle eines Begriffs setzte, der die Frau als Frau definierte - mit der Folge eines „Verirrens“ in weiteren Dualismen. Im strukturalistischen und vor allem auch postmodernen Denken wurde der Begriff der Geschlechtsidentität wieder offener gedacht. Judith Butlers diskurstheoretische Analyse der Identität der Geschlechter „[…] entlarvt die damit traditionell verbundenen Vorstellungen von Autonomie und Identität als Illusion “ (Drygala 2005: 13), indem sie die Identität der Geschlechter als eine von den Beteiligten aktiv konstruierte[38] sieht. Dem versucht sie mit der „Theorie der Performanz“ als „ Handlungsmodell permanenten Erzeugens von Effekten“ (ebd.: 13f) zu begegnen, welche die Identität der Geschlechter immer wieder neu performativ generieren soll. In kritischer Auseinandersetzung mit Butlers Konzept kristallisiert sich aber ein ständig veränderbarer Prozess heraus, der nicht in der Lage ist, das weibliche Geschlecht in seiner Besonderheit vollständig zu erfassen.
Der Begriff der sexuellen Differenz, bisher im philosophischen Denken nicht als solcher verortet, sondern im Verborgenen kreisend, wird bei Geneviéve Fraisse in den Focus ihres Denkens gerückt. Hierbei geht es nicht um die Darstellung von Geschlechtsunterschieden, sondern um das „[…] sich-gegenseitig-als-anderes-Geschlecht-Bestimmens. “ (ebd.: 16). Fraisses theoretische Ausarbeitung einer Differenz der Geschlechter[39] bezieht sich in diesem Kontext auf die sexuelle Differenz als eine leere, unbestimmbare Kategorie, die immer wieder neu ausgehandelt werden und um Inhalte ergänzt werden muss.[40] Geschlechtsdifferenz ist für Fraisse der „[…] Ausgangsort der Differenz […], mit der das Denken beginnt.“ (ebd.: 76). Mit dem Begriff der „Geschichtlichkeit der Geschlechterdifferenz“ zeigt Fraisse die Notwendigkeit einer offenen, nicht festgelegten geschichtlichen Darlegung, welche das Verhältnis der Geschlechter im geschichtlichen Wandel untersuchen kann. Möglich wird dadurch die Aufnahme von Frauen in den „[…] Status als historische Subjekte, als Akteurinnen der Realgeschichte sowie als denkende Individuen.“ (Fraisse 1996: 86).
Dem gender-Konzept wirft sie vor, die Unterschiede der Geschlechter nivellieren, das Bestreben danach, das Konflikthafte sexueller Verhältnisse verdecken zu wollen sowie die Relativierung des eigentlich sprachlich mehrdeutigen Geschlechtsbegriffs – die Bezeichnung benennt sowohl Allgemeines wie die menschliche Gattung als auch das Besondere wie das männliche und weibliche Geschlecht als einzelne oder voneinander verschiedene Geschlechter. Gerade aber in dieser Ambiguität sieht Fraisse das Potential der Auseinandersetzung mit Geschlechterdifferenz. Geschlechterdifferenz wird als Denkfigur gedacht, mit deren Hilfe eine Diskursanalyse ermöglicht wird, die den zu untersuchenden Problemkontext der geschlechtlichen Differenz auf seine Erscheinungsmerkmale hin erforschen kann. Hierbei zeichnet sich der Gedanke des „philosophems“ ab, das bedeutet, die Idee der geschlechtlichen Differenz wird erst zum Inhalt philosophischen Nachdenkens, wenn sie als epistemologische Form herausgestellt wird und somit den Entwurf einer Wirklichkeitsauffassung erlaubt, der sich als geschlechtsspezifisch herausstellt.[41]
Im Anschluss an Fraisses Theorie beansprucht Luce Irigarays geschlechtsspezifische Begrifflichkeit sexueller Differenz den Aspekt einer Mehrschichtigkeit, der den Bogen über erkenntnistheoretische, ontologische und ethische Fragestellungen spannt. Die Frau als „[…] die über Jahrhunderte aus der Philosophie des Identitätsdenkens Ausgegrenzte“ (Drygala 2005: 17) steht im Zentrum ihrer Theorie von Differenz als „irreduzibler Alterität“, indem sie den Begriff der sexuellen Differenz in der philosophischen Diskussion überhaupt erst verortet. Hiermit konstruiert Irigaray das zu entwickelnde Bild von einem Geschlechterverhältnis, welches sich durch die gegenseitige Anerkennung des Anderen auszeichnet und dadurch in der Lage ist, neue Ausblicke hinsichtlich weiblicher Subjektivität zu eröffnen sowie den Differenzbegriff in ein neues Denken in der Philosophie zu überführen. Diese Erkenntnis aber, sich selbst auch im anderen Geschlecht vorzufinden, wirft Probleme theoretischer Art auf, die zu Fehlinterpretationen führen können.[42] Die Aufgabe bleibt es in diesem Kontext, ein „[…] von Frauen getragener Prozeß der Lebens- und Arbeitszusammenhänge, das autonomere und zugleich kontinuierliche Sich-Einschreiben in die Repräsentationssysteme “ (Birkhan 1993: 10) zu verwirklichen.
Das Auslöschen bipolarer Gegensatzpaare ist dabei ein Weg, Formen weiblicher Erfahrung zu einem Symbolismus zu führen, der durch weibliche Vermittlung zum Sich-Bedeutung-Zuschreiben führt, „Damit das Weibliche im Diskurs der Wissenschaft und der Politik zu zirkulieren beginnen kann.“ (Fischer, Franco et al. 1993: 59). Die Erforschung der sexuellen Differenz ist zugleich die Untersuchung symbolischer Differenz bzw. der symbolischen Konstitution gesellschaftlicher Strukturen. Symbolische Formen als die „[…] gemeinsame Welt der Frauen […]“ (vgl. ebd.: 60) stellen sich als das dialektische, vertrauensvolle Verhältnis zur Autorität einer anderen Frau, im Sinne einer „[…] symbolischen Tauschwährung zwischen zwei Frauen.“ (ebd.: 61) dar. Das bedeutet, einer Frau einen Wert zuzuschreiben, ein „Mehr“ zu generieren[43], um so eine Differenz zu erzeugen, welche in der Lage ist, symbolisch zuzuweisen - also die Freiheit, in der Welt selbstbestimmt zu handeln, erwirkt.
Weiterhin sind zu schaffende weibliche, symbolische Strukturen die Voraussetzung „[…] für den Einklang zwischen dem Selbst und dem Außerhalb des Selbst“ (ebd.: 60), die ein unabhängiges Agieren der Frau und daraus folgend die Einschreibung der Geschlechtlichkeit in den sozialen Kontext ermöglicht und damit wahrnehmbar macht. Partizipation am gesellschaftlichen Leben ist das Ziel, um die Bestätigung und Akzeptanz des Weiblichen sichtbar zu manifestieren.
Die Philosophinnengruppe Diotima setzte sich seit Mitte der 1980-er Jahre mit dem Begriff der Geschlechterdifferenz und der Bedeutung für die Frau auseinander. Daraus entwickelte sich dieser Denkansatz des „affidamento“ - sich anvertrauen - als die Bedingung für die weibliche Freiheit (vgl. Birkhan 1993: 10) und die Möglichkeit, sich dem männlichen Prinzip der Vergesellschaftung zu entziehen. Hierbei kam dem Aspekt der Verschiedenheit von Frauen eine bedeutende Rolle hinsichtlich des Anders-Sein zu, da auf diese Weise positive Effekte hinsichtlich der Einschreibung symbolischer Strukturen in gesellschaftliche Zusammenhänge erzeugt werden konnten. Der Ansatz des affidamento gründet „[…] auf dem Prinzip der Ähnlichkeit und der Differenz zwischen Frauen und problematisiert deren Interaktion.“ (Meyer 1994: 160) und kann als eine Vorbedingung für die Umsetzung der geschlechtlichen Differenz angesehen werden, da es, beruhend auf der gegenseitigen Akzeptanz vielfältigster weiblicher Erscheinungsformen, zu Selbsterkenntnis und Selbstidentifikation führt.
In der feministischen Diskussion leiteten das Denken und die Abkehr vom Ideal der bisher propagierten Gleichheit von Mann und Frau und deren Umsetzung in politischen Programmen einen Umbruch im Nachdenken über das Bild weiblicher Freiheit und Gerechtigkeit ein. Die Distanzierung der Philosophinnengruppe zum Emanzipationsfeminismus macht sich am Begriff der Gleichheit fest und brachte ein Denken auf den Weg, die „[…] praktizierte Politik der Gleichberechtigung in Frage stellen, die sie als abstrakt und widersprüchlich wahrnehmen. Sie wollen die sexistische Unterdrückung aus der Position der weiblichen Freiheit heraus bekämpfen […].“ (ebd.: 165).
Das Denken von zwei Geschlechtern ist Voraussetzung für die Reflexion und Neubewertung des Begriffes sexueller Differenz.
Der Mensch ist zwei - diese Forderung bedeutet: den grundsätzlichen Anspruch auf Dominanz des einen (männlichen) Geschlechts zu verweigern und die Sprachlosigkeit der Frau aufzuheben. Das Denken der Geschlechterdifferenz formuliert mit dieser Hypothese den Anspruch auf Verortung und die Festschreibung zweier Geschlechter in der sozialen Wirklichkeit sowie im philosophischen Diskurs. Dem Einschreiben der ursprünglichen[44] Dualität der Geschlechter oder „der Mensch ist zwei“ in den philosophischen Diskurs kommt hierbei die Bedeutung zu, „[…] einem Vorhandenen Ausdruck zu verleihen, das nie müde geworden ist, sich dem Denken darzubieten.“ (Caverero 1993: 101).
„Frauen ist die Welt der symbolischen Repräsentation, die eine Spiegelung des Selbst und eine Identitätsfindung möglich macht, verschlossen.“ (Kroker 1994: 78), deshalb ist das Verlangen nach Gleichheit der Geschlechter nicht ausreichend, um Weiblichkeit auf kultureller, sexueller, sozialer und politischer Ebene einschreiben zu können. Vielmehr muss es Anliegen sein, die „doppelte Amnesie des Weiblichen“ aufzulösen und die Frau als ein „irreduzibles Anderes“ zu denken, um die praktische Seite des Denkens der sexuellen Differenz auf einen Weg zu bringen, der Identitätsfindung und -verortung möglich macht. Die kritische Beurteilung innerhalb feministischer Theoriebildung und im philosophischen Diskurs „[…] legitimiert sich über ständige Erneuerung ihrer selbst, und verhält sich als System weder starr noch geschlossen“ (ebd.: 80) - in diesem Zusammenhang kommt der ständigen Hinterfragung des Begriffsystems sexuelle Differenz ein bedeutender Stellenwert zu.
Feministischer Philosophie kann also mit einer Philosophie des Weiblichen ein Konzept gegenüber gestellt werden, welches die Differenzen betont und für die Akzeptanz und Anerkennung geschlechtlicher Differenzen plädiert bzw. nach einer „[…] Funktionsweise, in der sich das Besondere des Weiblichen als Weibliches betätigen könnte“ (Meyer 1983: 123) sucht. Weibliches Denken versteht sich als ein Denken innerhalb weiblicher Begriffsstrukturen, deshalb kann sie sich auf sich selbst als ein Anderes rückbesinnen, ohne sich im Blickwinkel feministischer Philosophie verortet, „[…] innerhalb der alten Repräsentationen und Begriffe wiederum festschreiben“ (Bussmann 1998: 12) zu lassen.
An dieser Stelle setzt das Bemühen ein, ein neues Denken zu konstituieren, welches die „[…] oppositionellen Denkschemata der westlichen Geschichte der Philosophie hinter sich lässt und Differenz in spezifischer, nicht von anderswoher ableitbarer Weise als Geschlechtsdifferenz erfasst.“ (Kimmerle 2001c: 4) und das Verhältnis der Geschlechter nicht als bloßen Unterschied denkt. Geschlechtliche Differenz zu denken, heißt Nachdenken über das Verhältnis zwischen den Geschlechtern - nicht über deren Identität. Philosophische Reflexion muss also die „ […] Notwendigkeit einer symbolischen Repräsentation des weiblichen Geschlechts als autonomes“ (Drygala 2005: 10) festschreiben, damit es möglich wird, das Weibliche im männlich beherrschten philosophischen Diskurs als eigenes Geschlecht zu etablieren.
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass das Projekt „sexuelle Differenz“ „ […] eine Revolution aller symbolischen Systeme, der Gesetze, der Sprache “ (Irigaray 1991b: 146) erforderlich macht. Vor allem einer Sprache, „[…] vermittelt durch das gemeinsame Netz von Bedeutungen, durch die bisher immer vom Diskurs ausgeschlossene Dritte, die nun zur Bürgin für die Möglichkeit des Wortes selbst wird, zur Voraussetzung für die Sagbarkeit der Geschlechterdifferenz in der Sprache.“ (Tommasi 1993: 125).
Kritisch hinterfragt werden muss allerdings der konkrete Bezug des Entwurfs der Geschlechterdifferenz im Kontext der Betrachtung der Lebensrealität von Frauen und ihren Problemen im Alltag; Ziel muss es bleiben, das „geschlechterübergreifende Aus-denken“ (Jauch 1990: 141) sexueller Differenz in der Alltäglichkeit des Handelns zu verankern.
Ein weiteres Problem stellt der feministische Diskurs selbst dar: verschiedene feministische Diskurse haben das Potential, zum „symbolischen Kapital“ zu mutieren und somit die Fähigkeit verloren „[…] zur Sicherung der feministischen Position gegenüber der männlich dominierten Öffentlichkeit“ (List 1996: 19) zu sorgen; sie dienen nunmehr der „[…] Positionsabgrenzung zwischen verschiedenen, gleichermaßen um Anerkennung bemühten feministischen Lagern“ (ebd.) und dem Anmelden von Machtansprüchen. Somit begibt sich feministische Theoriebildung in Gefahr, den Bezug „[…] zu politischen, kulturellen und existentiellen Anliegen zu verlieren, die die feministischen Denkbewegungen in Gang gesetzt haben “ (ebd.: 22) und Themen in den Vordergrund der Diskussion um Geschlechterdifferenz zu rücken, die sich ausschließlich mit der Stellung des Subjekts feministischer Theorie im politischen oder institutionellen Kontext beschäftigen, was zwangsläufig zu einem „Theoretischwerden“ feministischer Denkweisen und dem Verlust praxisbezogener Handlungsintentionen führen kann. Hier stellen differenztheoretische Überlegungen und ihre historisch-dialektische Einordnung in den feministischen Diskurs einen Versuch dar, Lösungsansätze aufzuzeigen und Perspektiven zu eröffnen.
[...]
[1] Der Begriff der Identität (lat. idem-der-/dasselbe) als uneingeschränkte Übereinstimmung in allen Hinsichten wird in der traditionellen Philosophie mit der Form A=A dargestellt.
[2] Die Organisation dieser neuen Freiheit zeigte sich in einzelnen griechischen Stadtstaaten wie Sparta und Athen. Diese Freiheit selbst war allerdings beschränkt, da die Sklaverei eine subjektive Freiheit nicht zuließ.
[3] „ Differentia specifica “ als dem Unterschied, welcher die Vertreter einer Art von denen der gesamten Gattung unterscheidet - der Mensch gehört zur Gattung der Lebewesen, unterscheidet sich aber durch sein Vermögen, zu denken, von den übrigen Arten. „ Differentia accidentalis “ dagegen stellt als Klassifikationskriterium den nicht wesentlichen Unterschied dar (Zum Beispiel: der Mensch ist auch ein Mensch, wenn er nur einem Arm hat). „ Differentia numerica “ steht für die Unterschiede zweier einer Art zugehöriger Individuen.
[4] Die Einheit von Theologie und Philosophie, die universelle Darstellung der gesamten Wirklichkeit sowie das untrennbare Gefüge von Teil und Ganzem sind die wichtigsten Merkmale dialektischer Denkweise im Mittelalter.
[5] Cusanus verfolgt den Gedanken der Koinzidenz als dem Zusammenfall aller Gegensätze zu einer Einheit unter der Auflösung aller Widersprüche zwischen scheinbar Unvereinbarem - diese Einheit ist Gott.
[6] Allgemeine Begriffe wie beispielsweise Mensch und Menschheit oder mathematische Entitäten wie Zahl, Relation werden als Universalien bezeichnet.
[7] Weltgeschichte wird von der Philosophie der Aufklärung als einheitliche Entwicklung begriffen: „ Die in der europäischen Kultur des 18. Jahrhunderts ihren Höhepunkt erreicht. Das führt bei Kant und Hegel zu ausführlichen Argumentationen, warum nicht-europäische Kulturen keine Geschichte und Philosophie hervorgebracht haben. Man kann darin eine theoretische Untermauerung des kolonialen Denkens […] erblicken.“ (Kimmerle 2001a: 43).
[8] „ Was bedeutet Nihilism? Dass die obersten Werthe sich entwerthen. “ (Colli, Montinari 1980: 350).
[9] Nietzsches neues Philosophieren setzt sich von traditionellen Stilen deutlich ab. Mit dem Vergleich der Wahrheit mit einer Frau zeigt Nietzsche, wie wichtig es ist, sich mit neuen Methoden der Wahrheit anzunähern: „daß [sic] der schauerliche Ernst, die linkische Zudringlichkeit, mit der sie [die Philosophen] bisher auf die Wahrheit zuzugehen pflegten, ungeschickte und unschickliche Mittel waren, um gerade ein Frauenzimmer für sich einzunehmen ?“ (Nietzsche 1990a: 531).
[10] Die 1944 fertig gestellte „Dialektik der Aufklärung“, zusammen mit Horkheimer verfasst, gilt als die bedeutendste Schrift der Kritischen Theorie mit dem zentralen Thema der „Selbstzerstörung der Aufklärung“.
[11] Das Konzept einer „Negativen Dialektik“ (erschienen 1966) sucht das System der Philosophie aufzuheben, da die „ […] Widersprüche des Denkens und der darin erfassten Wirklichkeit nicht mehr in einer alles umfassenden Synthese aufgelöst werden können. “ (Kimmerle 2001a: 48).
[12] Antinomien als Widersprüche in den theoretischen, praktischen und ästhetisch-teleologischen Bereichen des Vernunftbegriffs.
[13] Die Seinsvergessenheit stimmt seinsgeschichtlich mit dem „Wesen der Technik“, welche das „Geschick“ der Menschheit bestimmt, überein.
[14] Thematisiert im 1927 erschienen Werk „Sein und Zeit“, welches die philosophische Richtung der Fundamentalontologie begründete.
[15] Satz der Identität: A=A.
[16] Heidegger spricht vom Wesen der Technik als einem „Ge-stell“ - das bestellte Seiende wird vom Menschen sozusagen missbraucht, um alles als von ihm hergestellt zu zeichnen.
[17] Eine freie Differenz, die sich weder Identität, Analogie, dem Gegensatz und der Ähnlichkeit unterordnen lässt, ist negationslos.
[18] In Bezug auf die „Sprachspiele“ des älteren Wittgenstein, der sprachliche Spiele als eine Äußerung versteht, die innerhalb eines gewissen Zusammenhangs auftreten - also die verschiedenen Arten der Zeichen-, Wort- und Satzanwendung: „ Ich werde auch das Ganze: der Sprache und der Tätigkeiten, mit denen sie verwoben ist, das Sprachspiel nennen.“ (Wittgenstein 2003: §7).
[19] Dabei folgt das Bilden von Sätzen unterschiedlich gearteten Regeln (Erkennen, Beschreiben, Fragen etc.), die auch untereinander nicht gleich sind. Problematisch ist hierbei, dass das Gesagte sich nicht „ineinander“ übersetzen lässt (Dissoziation der Regelsysteme). Im „Sprechen nach Auschwitz“ zeigt sich das Scheitern der Kommunikation.
[20] Als Lehre von der Interpretation schwer zu verstehender Texte oder anderer künstlerischer Werke ist die Hermeneutik im westlichen Verständnis eine Methodologie, welche alles Verständnis auf die Sprache bezieht.
[21] Im Gegensatz dazu die Missachtung der Schrift bei Rousseau.
[22] Im strukturalistischen Denken bzw. bei de Saussure wird Schrift als ein Zeichensystem gedacht: das Zeichen setzt sich aus dem Lautbild und dem es zu Bezeichnenden zusammen. Dieses wurde von später von Lacan neu interpretiert, nach dem es keine vorgegebene Zuordnung von Signifikant und Signifikat gibt.
[23] Erstmals 1968 in seinem Vortrag vor der „Société française“ de philosophie thematisiert.
[24] Das „a“ wird nicht gehört, nur gelesen: “Das a der différance ist also nicht vernehmbar, es bleibt stumm, verschwiegen und diskret, wie ein Grabmal.“ (Derrida 2004: 112).
[25] „ Denn die Metaphysikkritik der französischen Differenzphilosophie wusste, wie schon Adorno, dass auch das emanzipatorische Projekt der Moderne metaphysisch strukturiert war.“ (Engelmann 2004: 14.).
[26] Neben dem Versuch, Philosophie zu verwissenschaftlichen, z. B. als analytische Sprachphilosophie.
[27] Kimmerle führt hier die Dialoge zwischen afrikanischen und westlichen Philosophien ins Feld, um zu zeigen, dass ein interkulturelles Philosophieren voraussetzt, „ […] dass Menschen sich wesentlich sowohl mit und durch vorsprachliche körperliche Signale als auch mit und durch die Sprache miteinander verständigen.“ (Kimmerle 2001a: 46).
[28] Die zentralen Themen dieser feministischen Bewegung waren u. a. die Gleichstellung und Gleichberechtigung der Frau, die Identität der Geschlechter vor dem Hintergrund der Dekonstruktion sowie die Auseinandersetzung mit der sexuellen und reproduktiven Selbstbestimmung.
[29] Aufgrund dieser zunehmenden Hinwendung zur theoretischen Bearbeitung des Themas konnte das Forschungsgebiet „Philosophische Frauenforschung“ in der Wissenschaft etabliert werden.
[30] Schon im Mittelalter wurde in literarischen Werken die Verachtung der Frau thematisiert. So bspw. im ca. 1405 erschienen Werk „Das Buch von der Stadt der Frauen“ (Originaltitel: „Le Livre de la Cité des Dames“) von Christine de Pizan, in welchem sie die Idee einer utopischen Gemeinschaft entwickelt, in den Frauen der gleiche rechtliche Status wie Männern zugesprochen werden soll.
[31] Bezüglich der Sprachlichkeit wurde zum Beispiel gefordert, die Begriffe männlich und weiblich abzuschaffen.
[32] Das Ignorieren jeglicher Geschlechtlichkeit (der weiblichen!) führte dazu, dass der Gleichsetzungsprozess von Mensch- und Mannsein den Mann als „universelles Neutrum“ und damit als Subjekt festschreiben konnte. Der allgemeine Begriff Mensch steht also für den geschlechtlichen des Mannes.
[33] Vgl. hierzu Birkhan 1993: 20.
[34] An dieser Stelle sind die Sprachtheorie de Saussures, Althussers Ideologietheorie oder die Ansätze Lacans, Derridas oder Foucaults zu verorten.
[35] Wenn auch später als problematisch verworfen, da die Fragestellung die Stellung der Frau als ein Anderes des Mannes manifestiert
[36] So führt sie unter anderem die psychischen und physischen Belastungen von Menstruation, Schwangerschaft, Geburt, Klimakterium ins Feld, um ihre Aussagen zu untermauern.
[37] So fragt Beauvoir: „ Wie kommt es zur Unterwerfung der Frau? “ (Beauvoir 1992: 12).
[38] Neben einer Ich-Identität werden „[…] zugleich normierende Effekte eines Ideals der Zwangsheterosexualität erzeugt.“ (Drygala 2005: 13).
[39] „Der Fakt, dass es zwei Geschlechter gibt und dass wir uns über Sexualität fortpflanzen, ist das Empirische der condition humaine schlechthin. Davon ausgehend hat die Menschheit begonnen, über sich nachzudenken, sich selbst als denkende konstruiert. Was man dabei auf keinen Fall verwechseln darf, sind also Empirizität und Natur.“ (Fraisse 2001).
[40] Sie orientiert sich dabei an Foucaults Diskursanalyse: er sieht Macht als einen immer neu vermittelten Diskurs an; im Kontext der Betrachtung der Beziehung der Geschlechter, interpretiert er die Verschiedenheit dieser als das Ergebnis ökonomischer Zwänge.
[41] Probleme bei der Umsetzung ihres Konzepts sieht Fraisse im Widerstand psychoanalytischer Auslegung des Begriffes von Geschlechtlichkeit - Freud bescheinigte die Ungleichheit weiblicher und männlicher Sexualität.
[42] „[…] sodaß wir dazu neigen, auch die Auswirkungen der Herrschaft als ursprüngliche Differenz zu interpretieren oder umgekehrt die ursprünglichen Differenzen als Auswirkungen der Herrschaft.“ (Fischer, Franco et al. 1993: 44).
[43] Betrachtet wird hierbei die Verbindung zwischen einer älteren Frau als Lehrmeisterin mit einem Überschuss an aus Erfahrungen generiertem Wissen und der jüngeren Frau, die dieses Wissen aufnehmen kann. Diese Differenz kann als eine vom Männlichen unabhängige bezeichnet werden. Vertikale, patriarchal geprägte Beziehungsgefüge werden von horizontalen abgelöst. (vgl. Meyer 1994: 162 ff.).
[44] Geschlechterdifferenz ist ursprünglich im Sinne des Schon-Da-Seins, denn: „ Gehört zu dem sich darbietenden Vorhandensein der menschlichen Kreatur nicht etwa auch das schon immer Verschieden-geschlechtlich-Sein, so und nicht anders?“ (Cavarero 1993: 101).
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Erstausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2012
- ISBN (Paperback)
- 9783863414979
- ISBN (PDF)
- 9783863419974
- Dateigröße
- 363 KB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- FernUniversität Hagen
- Erscheinungsdatum
- 2015 (Februar)
- Note
- 1,8
- Schlagworte
- Differenzphilosophie weibliche Identität Dekonstruktion Feminismus Gender Mainstream queer theory
- Produktsicherheit
- BACHELOR + MASTER Publishing