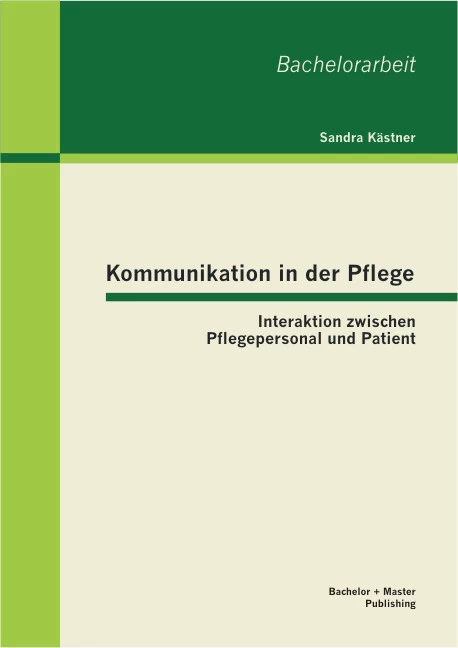Kommunikation in der Pflege: Interaktion zwischen Pflegepersonal und Patient
Zusammenfassung
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
2.2 Die fünf Axiome der Kommunikation nach Paul Watzlawick
Watzlawick entwarf fünf Regeln oder auch Merkmale, welche jede übermittelte Nachricht mit sich bringt. So genannte Axiome.
„Die Unmöglichkeit, nicht zu kommunizieren“
Diese Regel sagt aus, dass jeder Mensch, ob er will oder nicht, ständig mit seinen Mitmenschen kommuniziert. Ob er nun etwas sagt, eine gewisse Gestik macht oder still schweigend in einer Ecke sitzt. Durch das persönliche Verhalten eines Menschen ist es Mitmenschen möglich zu erkennen, ob dieser gerade gesprächig und gut gelaunt ist oder ob er lieber in Ruhe gelassen werden möchte (vgl. Matolycz, S. 11 ff). Das Verhalten einer Person erkennt sein Gegenüber unter anderem zum Beispiel durch Körperhaltung, Mimik und Gestik, also mit anderen Worten an allem was die Person macht, auch wenn sie nichts zu tun scheint. Somit findet ständig Kommunikation statt, ob gewollt oder ungewollt, da andere Personen jegliches Tun und Verhalten für sich interpretieren und verstehen und dementsprechend darauf reagieren (vgl. Watzlawick, S.58 ff).
„Die Inhalts- und Beziehungsaspekte der Kommunikation“
Denkt man an den Begriff Kommunikation, so wird dieser in erster Linie als Austausch von Informationen verstanden, doch es steckt viel mehr dahinter, als nur ein Informationsaustausch unter Personen. Der Sender der Nachricht übermittelt seinem Gesprächspartner mit der Nachricht automatisch mit, wie dieser sie verstehen soll. Ob zum Beispiel als Aufforderung etwas sofort zu tun, oder nur als Hinweis, dass es noch getan werden muss. Wie der Empfänger diese Nachricht allerdings aufnimmt und darauf reagiert, liegt an der Beziehung zwischen den beiden Kommunizierenden. Das Kommunizieren über die gegenseitige Beziehung der Gesprächspartner wird als Metakommunikation, also eine Kommunikation, die über eine Kommunikation stattfindet, bezeichnet. Ohne das Metakommunizieren ist es nicht möglich die eigentliche Nachricht als Empfänger richtig zu verstehen, da die Gesprächspartner nicht wissen, woran sie bei dem Anderen sind. Es ist nicht selten, dass Nachrichten falsch verstanden werden. Es liegt daran, ob das Gesagte so aufgenommen wird, wie es gemeint ist oder so, wie man es persönlich verstehen will, da man den Anderen mag, oder auch nicht (Matolycz, S. 18 ff).
„Die Interpunktion von Ereignisfolgen“
Findet eine Interaktion zwischen zwei oder mehr Personen statt, so werden andauernd Informationen zwischen Sender und Empfänger ausgetauscht, wobei der Sender auch zum Empfänger wird und der ursprüngliche Empfänger zum Sender. Die Positionen können in einer Interaktion ständig wechseln. Betrachtet man als Außenstehender ein solches Gespräch, so scheinen die Gesprächspartner auf den ersten Blick beliebig Informationen miteinander auszutauschen. Allerdings besitzt jede Interaktion einen bestimmten Aufbau. Diesen Aufbau bezeichnete Watzlawick als: „(…) Interpunktion von Ereignisfolgen“. Durch die Interpunktion entsteht ein Gesprächskreislauf. Der Sender der ursprünglichen Information schickt mit der Information und wie er sie übermittelt, einen Reiz an den Empfänger. Dieser nimmt den Reiz, also die Information und die Beziehung wahr, und antwortet dementsprechend, wie er den Reiz aufgenommen hat, für sich richtig, mit einer Reaktion darauf. Diese Reaktion nimmt der ursprüngliche Sender der Nachricht auf und verstärkt seinen Standpunkt noch einmal. Diese Vorgänge wiederholen sich beliebig oft. Die einzelne Nachricht führt also auf der einen Seite zu einer Reaktion beim Gesprächspartner und auf der anderen Seite wiederum auch zur eigenen Reaktion, auf die der Partner wieder reagiert. Entstandene Konflikte, bei denen solch wechselseitige Reaktionen stattfinden, scheinen einen undurchdringbaren Kreislauf darzustellen, da jede Person für sich richtig auf die Reaktion des Gegenübers agiert (vgl. Watzlawick, S. 64 ff). Der Kreislauf verschärft sich, wenn man als Teilnehmer versucht die Reaktion des Anderen zu verstehen. Für jeden scheint nur das eigene Verhalten, die eigene Meinung die richtige zu sein. Um den Kreislauf beenden zu können, ist es wichtig, als Teilnehmer des Gespräches, das Gespräch von außen zu betrachten, um seine eigene Reaktion auf die des Partners verstehen zu können. So kann man sich über die Beziehung zueinander unterhalten und diese versuchen zu klären. Ohne diese Klärung ist es nicht möglich, sich über die eigentlichen Informationen, welche ausgetauscht werden sollten, zu unterhalten(vgl. Matolycz, S.25 ff).
„Digitale und analoge Kommunikation“
Grundsätzlich kann Kommunikation auf zwei Wegen erfolgen. Zum einen lassen sich Dinge durch Worte beschreiben und zum anderen können sie bildlich dargestellt werden. Die Beschreibung durch Worte nennt Watzlawick digital, die bildliche Darstellung analog. Beide Arten der Kommunikation sind alleine nicht aussagekräftig genug. Die digitale Kommunikation ist nur durch ein Übereinkommen möglich. Das heißt, sie gilt nur in einem bestimmten Bereich, wie zum Beispiel innerhalb eines Landes mit der gleichen Sprache, wo die Bezeichnung für einen Gegenstand festgelegt wurde und von allen innerhalb des Landes verstanden und genutzt wird. Zudem lässt sich durch Worte nicht alles fassen, was vielleicht gesagt werden möchte. Beschreibungen sind nicht vollständig möglich, da das dementsprechende Vokabular dazu fehlt.
Die analoge Kommunikation, welche sich der Zeichen und Verbildlichung von Dingen bedient, ist unmöglich so eindeutig, wie die digitale. Unter analoger Kommunikation ist unter anderem die Mimik und Gestik, also die Körpersprache gemeint. Diese ist meist zweideutig. Weint eine Person so kann dies vor Glück, Freude und Überraschung sein, allerdings auch, aufgrund von Traurigkeit, Schmerz oder Schock. Der Empfänger muss für sich persönlich entscheiden, was gemeint ist. Somit sind beide Kommunikationsformen allein nicht aussagekräftig genug, um dem Gesprächspartner mitteilen zu können, was genau und wie es gemeint ist. Zusammen jedoch ergänzen sie sich perfekt. Das Digitale kann durch das Analoge unterstrichen und verdeutlicht werden. Das Analoge wiederum bekommt durch das Digitale seine Eindeutigkeit. Es ist also wichtig, sich beider Kommunikationsarten zu bedienen, um ein verständliches Gespräch führen zu können, wobei der Mensch oft automatisch und unbewusst seine Worte durch Körpersprache untermalt und somit dem Gesagten Ausdruck verleiht (vgl. Watzlawick, S. 70 ff).
„Symmetrische und komplementäre Interaktionen“
Interaktionen können entweder symmetrisch oder komplementär sein. Das Ganze lässt sich zurückführen auf die Beziehungen zwischen den Gesprächspartnern. Diese können entweder auf Gleichheit oder Verschiedenheit beruhen. Bei Interaktionen, deren Beziehungen auf Gleichheit basieren, haben die Gesprächspartner den gleichen Beweggrund für den Informationsaustausch. Zum Beispiel sind hier zwei Kollegen zu nennen, die gerade aus dem Urlaub zurückgekehrt sind und dem anderen mitteilen wollen, wie toll es war. Dabei wird wahrscheinlich jeder versuchen, den anderen mit den erlebten Ereignissen zu überbieten. Solche Interaktionen bezeichnet Watzlawick als „symmetrische Interaktionen“. Bei Interaktionen mit auf Verschiedenheit basierenden Beziehungen der Gesprächspartner, nimmt ein Akteur die superiore, übergeordnete Position ein, der andere die inferiore, untergeordnete. Dies bedeutet aber nicht, dass der eine besser oder schlechter als der andere ist. Beide sind voneinander abhängig und ihr Verhalten ergänzt sich gegenseitig (vgl. Watzlawick, S.78 ff). Diese komplementäre Interaktion findet auf gesellschaftlicher Basis statt. So, zum Beispiel auch in der Pfleger- Patient Beziehung. Allerdings kann es auch passieren, dass ein Interaktionspartner so sehr in seine Rolle gedrängt wird, dass seine Handlungen beeinflusst und eingeschränkt werden. So kann zum Beispiel das Pflegepersonal dem Patienten zu stark vermitteln, dass er sich in der hilflosen Rolle befindet und von Hilfe abhängig ist, dass der Patient nichts mehr alleine tut, da das Personal alles für ihn übernimmt (vgl. Matolycz, S. 35 ff).
2.3 Themenzentrierte Interaktion
Die Themenzentrierte Interaktion entstand 1975 durch die Psychotherapeutin Dr. Ruth Cohn. Sie setzte sich mit der Kommunikation auseinander, die zwischen Menschen in Gruppen stattfindet und der ein bestimmtes Thema zugrunde liegt (vgl. Ostermann 1996, S. 142ff). Cohn entwickelte für die Interaktion in Gruppen Regeln, da sie der Auffassung war, dass bei der Zusammenarbeit in Gruppen hauptsächlich das Thema im Mittelpunkt steht, die Bedürfnisse der einzelnen Gruppenmitglieder allerdings meist wenig oder gar nicht berücksichtigt werden, was die Zusammenarbeit einschränken kann. Dabei bezieht sie sich ursprünglich auf die Situation während des Unterrichtes (vgl. Marwedel 2008, S. 193). Für Cohn steht bei der Interaktion innerhalb einer Gruppe demnach nicht nur das Bearbeiten eines spezifischen Themas im Mittelpunkt, sondern es muss eine Ausgeglichenheit zwischen dem einzelnen Mitglied (demIch), der Beziehung des Einzelnen zur Gruppe (demWir), demThemaund bestimmten Rahmenbedingungen vorhanden sein. In Abbildung 2 wird der Zusammenhang der einzelnen Bestandteile der Themenzentrierten Interaktion graphisch verdeutlicht.
Für den beschriebenen Ausgleich und das dadurch effektive Zusammenarbeiten, ist der Leiter der Gruppe zuständig. Er hat die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die Bedürfnisse der einzelnen Mitglieder abgedeckt sind und sie sich wohl fühlen, dass ein gutes Miteinander vorhanden ist und dass sich alle auf das Thema konzentrieren und es bearbeiten können. Er darf sich nicht ausschließlich auf das Thema konzentrieren und damit das Ich und das Wir in den Hintergrund stellen. Würde er das tun, so wäre der Unterricht nicht effektiv und die Beteiligten könnten nicht richtig lernen, da ihre eigenen Bedürfnisse nicht gestillt sind. Ziel Cohns war es, durch die Regeln der themenzentrierten Interaktion, die Selbsterfahrungen der einzelnen Beteiligten, deren Erleben und Umgang miteinander innerhalb der Gruppe und die Aufgabenbewältigung des Themas in einem dynamischen Prozess erfolgreich umsetzen zu können. Dynamisch daher, dass immer wieder ein Ausgleich zwischen der Konzentration auf Ich, Wir und dem Thema stattfinden soll (vgl. Ostermann 1996, S. 142ff). Cohn beschreibt in diesem Zusammenhang acht wesentliche, hilfreiche Ratschläge. Zunächst sollen einzelne Beteiligte zu ihren Aussagen stehen und diese nicht durch Wörter wie man, oder wir verallgemeinern. So können auch persönliche Erfahrungen zum Ausdruck gebracht werden. Die nächste Regel hat den gleichen Hintergrund wie die erste. Wenn die Beteiligten Fragen stellen, dann sollen sie den Anderen im gleichen Zug mitteilen, was sie veranlasst hat, diese Frage zu stellen. So ist es den Beteiligten leichter möglich, die Beweggründe und den Standpunkt der jeweiligen Person zu erkennen, ihn besser zu verstehen und auf seine Frage eingehen zu können. Weiterhin soll die einzelne Person authentisch und selektiv in ihren Aussagen sein. Das heißt, sie soll sich ihrer Gedanken und Gefühle bewusst sein und sich genau überlegen, was sie den anderen von den eigenen Gedanken mitteilen will. Eine weitere wesentliche Regel beinhaltet, dass das Verhalten und die Aussagen anderer Gruppenmitglieder weder bewertet, noch interpretiert werden sollen. Um zu zeigen, wie das Verhalten auf die eigene Person wirkt, soll dieses hingegen reflektiert und Gefühle zum Ausdruck gebracht werden, die in einem durch das Verhalten des Anderen aufgekommen sind. Dadurch bekommt die jeweilige Person die Möglichkeit wahrzunehmen, wie sie auf andere wirkt, kann Rückschlüsse auf sich selbst ziehen und über sich selbst lernen. In Gruppenarbeiten kommt es oft zu störenden Seitengesprächen zwischen einzelnen Mitgliedern, deren Inhalt andere nicht hören können. Cohn vertritt die Meinung, dass vor allem diese Seitengespräche wichtig für die gesamte Gruppe sind und deshalb für alle zum Thema gemacht werden sollen. So ist es möglich, eventuelle Störfaktoren abzuschalten. Ebenso ist es wichtig, dass immer nur einer zur gleichen Zeit sprechen kann. Deshalb gilt es für den Rest der Gruppe, demjenigen aufmerksam zuzuhören und ihn aussprechen zu lassen. Möchte man ihm in Bezug auf das, was er geäußert hat etwas mitteilen, so ist danach Zeit dafür. Persönliche Mitteilungen an eine Person sind direkt an sie zu richten und nicht etwa über Dritte. Dabei gilt es Blickkontakt zu der Person zu halten und ihm auch zu vermitteln, was das Gesagte für die eigene Person bedeutet (vgl. Ostermann 1996, S. 143ff & Ruth- Cohn- Institute).
Grundsätzlich gilt für die themenzentrierte Interaktion, dass jeder Teilnehmer sein eigener Leiter ist und sich seiner Gedanken und Gefühle bewusst sein sollte, bevor er den anderen etwas mitteilt. Dabei muss ihm aber klar sein, dass auch jeder andere sein eigener Leiter ist. Akzeptieren das alle Teilnehmer und stellen für sich selbst ein Gleichgewicht zwischen Ich, Wir und Es, also dem Thema her, so ist die Balance für die Gruppe auch leichter aufrecht zu erhalten.
2.4 Symbolischer Interaktionismus
Der symbolische Interaktionismus wurde von dem Soziologen Herbert Blumer geprägt, der sich an den Grundlagen seines Lehrers orientiert hat. Blumer erklärt in seiner Theorie das Entstehen, beziehungsweise den Ursprung des menschlichen Verhaltens und Handels in der Gesellschaft. Interaktion, also die Kommunikation und gegenseitige Reaktion, besteht aus verschiedenen Handlungen der Beteiligten. Dabei prägt und beeinflusst das Verhalten des Gegenübers die eigene Einstellung und damit das eigene Handeln in Bezug auf eine bestimmte Sache. Überdenkt und interpretiert der Empfänger das Verhalten des Senders und versucht es für sich zu verstehen, so entsteht für die „Sache“ eine Bedeutung. Diese Bedeutung merkt sich der Empfänger und wenn er wieder mit dieser „Sache“ in Kontakt kommt, so weiß er um die Bedeutung und passt sein Handeln an die gegebene neue Situation an. Die „Sache“ kann ein Objekt, also zum Beispiel ein Stuhl sein, auf den man sich setzen kann, sie kann ein Mensch in einer bestimmten Rolle sein, wie zum Beispiel ein Arzt, oder sie kann der Glaube an etwas sein. Befinden sich beispielsweise zwei Menschen in einem Raum mit zwei Stühlen, die an einem Tisch stehen, so greifen beide auf ihre bisherigen Erfahrungen in einer ähnlichen Situation zurück. Jeder der beiden versucht daraufhin zu ahnen, wie der andere reagieren wird und möglicherweise kommt es dazu, dass sich einer der beiden einen Stuhl nimmt und sich darauf setzt, weil er das in einer ähnlichen Situation, bei einer anderen Person so gesehen hat und dabei gelernt hat, dass Stühle bequem und zum Hinsetzen geeignet sind. Die andere Person wiederum setzt sich auf den Tisch, da sie in einer ähnlichen Situation erlebt hat, dass sich ihr Gegenüber auf den Tisch setzte, da er, als er sich vorher auf einen Stuhl setzten wollte, damit zusammen gebrochen war. Dieses abstruse Beispiel verdeutlicht, wie das Handeln durch die Erfahrungen anderer in bestimmten Situationen das eigene beeinflussen kann. Der Mensch setzt sich immer wieder aufs Neue mit Objekten auseinander, auch wenn er sie und ihre Bedeutung schon kennt, denn diese kann sich durch das Handeln anderer stets wieder ändern. Der symbolische Interaktionismus beruht auf drei verschiedenen Grundlagen. Die erste ist, dass die Bedeutung von Objekten für den Einzelnen sein Handeln bestimmt. Er leitet sein eigenes Handeln somit von der Bedeutung des Objektes für sich selbst ab. Die zweite Grundlage beschreibt, dass die Bedeutung von Objekten durch soziale Interaktion, also gesellschaftliches Miteinander entsteht. Das heißt, ein Mensch leitet sein eigenes Handeln von dem, seines Gegenübers ab, welches er aufgrund der Bedeutung des Objektes für sich durchführt. Eine weitere Grundlage ist, dass sich die Bedeutung von Objekten ändern kann.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 3 Symbolischer Interaktionismus
Für jede Person hat ein Objekt eine andere Bedeutung und sie wird daher anders darauf reagieren, als eine andere Person. Jeder Kommuniziert anders, auf seine eigene gelernte Art und Weise.
Die Bedeutung beruht auf früheren Erfahrungen und man muss sich der Bedeutung von Dingen für sich selbst bewusst werden, danach handelt man dann so lange, bis irgendjemand durch sein Verhalten in Bezug auf das gleiche Objekt die eigene Bedeutung davon ändert. Um das Handeln eines anderen zu verstehen bedarf es Verständnis für dessen Gedanken und Gefühle. Daher ist es vor allem auch für ein gemeinsames Handeln wichtig, die Handlung einzelner Personen zu verstehen. Eine nicht symbolische Interaktion entscheidet sich von einer symbolischen darin, dass nur eine unbewusste Reaktion auf bestimmte Gestiken oder Handlungen stattfindet, ohne sich darüber Gedanken zu machen, oder die Handlung des anderen zu interpretieren (vgl. Matolycz 2009, S. 73ff).
In Bezug auf die Pflege und deren Interaktion spielt der symbolische Interaktionismus dahingehend eine Rolle, dass die Patienten verschiedene Bedeutungen für das Krankenhaus, Ärzte und ihre Krankheit haben können. Ein Patient, der beispielsweise einen Freund hatte, der mit der gleichen Krankheit im Krankenhaus lag wie er und daran verstorben ist, wird sicher sehr ängstlich und unsicher sein, da er davon ausgeht, dass es ihm ähnlich ergeht. Ein anderer Patient mit der gleichen Erkrankung, kann wiederum völlig andere Erfahrungen gemacht haben und ist daher positiv gestimmt und geht fest davon aus, bald wieder entlassen zu werden. Das zeigt sich dann natürlich auch in seinem Verhalten und seiner Kommunikation. Um das unterschiedliche Verhalten der Patienten zu verstehen und ihre Einstellung und ihr ursprüngliches Handeln in Bezug auf die Situation Krankenhaus und Krankheit im besten Falle positiv zu verändern und zu beeinflussen, muss man sich in den Patienten hineinversetzen und ihn als Individuum betrachten können. Patienten können nicht miteinander verglichen und gleich mit ihnen Umgegangen werden, da ihr Verständnis von der eigenen Situation ein grundverschiedenes sein kann und auf frühere Erfahrungen zurückgreift, die es zu verstehen und aufzuklären gilt. Wird das nicht akzeptiert, so kann es zu einem Abbruch der Kommunikation kommen.
3 Theoretische Modelle als Grundlage einer guten Kommunikation
Die folgenden zwei Modelle beschäftigen sich beide mit der Entwicklung von Beziehungen zwischen Pflegekraft und Patient und damit, wie Kommunikation aus psychologischer Sicht stattfinden sollte. Sie dienen nicht als Richtlinien, sondern sollen bei der Interaktion in der Praxis hilfreich sein.
3.1 Das Pflegeentwicklungsmodell nach Peplau
Peplau entwickelte als eine der Ersten ein Pflegemodell, in dem die Beziehung zwischen Pflegekraft und Patient im Mittelpunkt steht und als Grundlage der therapeutischen Pflege dient. In ihrem Modell befasst sie sich intensiv mit der Pflege – Patient - Beziehung. Um bei der Arbeit mit den Patienten Erfolg haben zu können und therapeutische Fortschritte zu erreichen, ist laut Peplau eine sich stets weiterentwickelnde Beziehung zwischen Pflegekraft und Patient unabdingbar. Sinn der Notwendigkeit der Beziehung sieht sie darin, dass beide Parteien im Laufe der eingegangen Beziehung zueinander, voneinander lernen und sich weiterentwickeln. Das Hauptziel, das Peplau mit dem Modell verfolgt, liegt darin, durch die Beziehung zum Patienten dessen Bedürfnisse erkennen und befriedigen zu können, um letztendlich den Pflegeprozess gemeinsam aktiv zu gestalten. Für die Pflege ist das keine leichte Aufgabe und setzt einige Kenntnisse und Fähigkeiten voraus. Pflegekräfte müssen sich immer wieder neu auf ihre Patienten einstellen, denn jeder Patient verhält sich anders. Auch das individuelle Verhalten eines Patienten kann und sollte sich während des Aufenthaltes im Krankenhaus verändern. Die Entwicklung einer Beziehung zwischen Patient und Pflegekraft ist demzufolge ein sich stetig verändernder Prozess, welchen Peplau alsdynamischbeschreibt. Hat die Pflegekraft nun zunächst einmal durch näheres Kennenlernen Zugang zum Patienten gefunden, so ist es ihre Aufgabe, sich in den Patienten hinein zu fühlen und dessen Gedanken und Gefühle zu verstehen, um zu erkennen, wie sie seine Bedürfnisse erfüllen kann.
Peplau bezeichnet diePflegeals einen bedeutsamen, ständig fortschreitenden, therapeutischen und zwischenmenschlichen Prozess, durch den das Wohlbefinden des Patienten gefördert oder wiederhergestellt werden soll. Für diesen therapeutischen Prozess stellt die Beziehung zwischen der Pflegekraft und dem Patienten die Grundlage und den Rahmen dar. Dadurch, dass jeder Patient andere Einstellungen, Sichtweisen und auch einen anderen Wissenstand hat, ist es die Aufgabe der Pflege sich Kenntnisse über diese ganzen Dinge beim Patienten einzuholen, sie zu erforschen und zu verstehen. Ebenso gilt es herauszufinden, was der Patient als seinen persönlichen gesunden Zustand empfindet, denn eben dieser soll durch den Pflegeprozess erreicht werden.
Gesundist für Peplau ein Mensch, der sich in seiner Persönlichkeit stets weiterentwickelt, verändert und an einem Leben in der Gesellschaft orientiert ist. Um gesund zu sein muss man dynamisch sein. Diese Dynamik führt bei gesunden Menschen zu einem physischen und sozialen Wohlbefinden und einem Leben in Harmonie in der Gesellschaft. Für Peplau ist das Wohlfühlen in der Gesellschaft ein wichtiger Faktor der Gesundheit. Eben deswegen legt sie großen Wert auf das Herstellen einer Beziehung zum Patienten, denn so wird trotz der Krankheit und erschwertem Leben in der Gesellschaft ein gesellschaftlicher Bezug hergestellt und angeboten. Um die Gesundheit eines Patienten wiederherstellen zu können sind seitens des Pflegepersonals Kenntnisse bezüglich der Kommunikation und pflegetherapeutischer Maßnahmen, sowie die richtige Organisation von Nöten. Es muss die Krankheit mit ihren Symptomen, Folgen und Therapiemöglichkeiten kennen und herausfinden, was die Krankheit speziell für diesen einen Patienten bedeutet. Um das herauszufinden und es auch dem Patienten zu verdeutlichen, muss das Personal den Patienten dabei unterstützen können, seine Gefühle und Gedanken zu äußern. Der Patient muss hingegen gesund denken können und darf sich nicht in seiner Krankheit aufgeben. Sind diese Bedingungen erfüllt, bedarf es nun noch einer guten Beziehung zwischen Pflegekraft und Patient, um den gemeinsamen Weg zur Genesung antreten zu können.
DieKrankheitdes Patienten bedeutet die Möglichkeit und die Notwendigkeit, für Pflegepersonal und Patient etwas voneinander zu lernen und sich so weiterzuentwickeln. Das Pflegepersonal muss sich bezüglich der Krankheit informieren, auf den bisherigen Wissensstand aufbauen und teilt einen Teil dieses Wissens dem Patienten mit. So lernt der Patient vom Personal etwas über seine derzeitige Situation und seine Krankheit. Dadurch weiß er nun, was mit seinem Körper durch die Krankheit passiert und wie sich der Heilungsprozess gestaltet. Anhand dieser Kenntnis kann er sich sein zukünftiges Leben vorstellen. Dieses Wissen ermöglicht es dem Patienten die eigenen Gedanken und Gefühle über die Krankheit und seine derzeitige Situation wahrzunehmen und zu verstehen. Die Pflege hat jetzt die Aufgabe den Patienten tatkräftig durch Gespräche und Zuhören zu bestätigen und ihm zu helfen die Gefühle zum Ausdruck zu bringen, um schließlich an gemeinsamen Zielen zusammenzuarbeiten.
In Peplaus Modell wirdder Menschmit seinen ständigen Veränderungen des Verhaltens und Handelns als ein „Organismus, der in einem nicht stabilen Gleichgewicht lebt“ beschrieben. Dabei wird das Leben eines Menschen an sich, als Prozess betrachtet, in dem nach einem grundständig stabilen Gleichgewicht gestrebt wird. Dieses kann laut Peplau durch die ständigen Veränderungen des Menschen allerdings erst mit dem Tod erreicht werden. Die ständige Weiterentwicklung der individuellen Persönlichkeit des Menschen, ist die zentrale Aufgabe, sozusagen der Sinn, im Leben des Einzelnen. Die Krankheit, durch die der Kontakt zwischen Pflege und Patient hergestellt wird, schränkt diese Persönlichkeitsentwicklung ein und es liegt in der Therapie und Erziehung der Pflege diese zu unterstützen und wieder möglich zu machen. Nur so kann der Patient später wieder unabhängig in der Gesellschaft agieren. Helfen kann die Pflegekraft, indem sie das Verhalten des Patienten versteht, denn dadurch, wie der Patient sich verhält, äußert er, was er braucht beziehungsweise was ihm fehlt (vgl. Simpson 1997, S.10ff).
3.1.1 Phasen der Beziehung zwischen Pflegekraft und Patient
Peplau beschreibt die Entstehung einer Beziehung durch das Agieren von Patient und Pflegekraft in verschiedenen Interaktionsphasen. Diese Phasen sind durch verschiedene Umstände sowie das sich entwickelnde Verhalten des Patienten geprägt. Damit ein Bezug zum Patienten hergestellt werden kann, muss die Pflegekraft wissen, in welcher Phase sich die Beziehung gerade befindet. Zu erkennen ist das am Verhalten des einzelnen Patienten. In jeder der Phasen befindet sich der Patient in einer für ihn neuen Situation. Die Pflegekraft hat die Aufgabe, diese zu erkennen und wiederum durch das Wissen um die Phase und die Situation, die Bedürfnisse des Patienten zu erfüllen.
Die erste Phase ist dieOrientierungsphase. Hier beginnt die Beziehung zum Patienten durch die erste Kontaktaufnahme zweier sich fremder Menschen. Durch die neue Umgebung, die Krankheit und die unbekannten Menschen haben die Klienten nicht selten Angst und fühlen sich unwohl. Das Pflegepersonal muss dem Klienten nun zunächst helfen, sich zurechtzufinden, also zu orientieren, ihm Informationen über den weiteren Ablauf zu geben und als Ansprechpartner bei Fragen vorhanden zu sein. Fragt er nicht nach, ist es von Vorteil ihn dazu anzuregen und ihm zu verdeutlichen, dass er gerne fragen darf. Hat der Patient alle nötigen und für ihn wichtigen Informationen erhalten, kann er sich ein Bild des Ganzen machen.
Noch während der Orientierungsphase beginnt schon Phase zwei, dieIdentifikationsphase. Der Patient hat während der Orientierungsphase mehrere Personen kennengelernt und kann einschätzen, von wem er Hilfe erwarten, beziehungsweise an wen er sich wenden kann. Seine Situation wird ihm immer bewusster und er wird sich mehr und mehr darüber klar darüber, dass er Unterstützung benötigt, die er in der Pflege findet. Er identifiziert sich also mit der Pflege. Durch die ersten pflegerischen Maßnahmen und eingehaltene Vereinbarungen entsteht im besten Fall Vertrauen zwischen Klient und Pflegekraft. Die Beziehung entwickelt sich und wächst langsam. Je nachdem, wie gut der Patient sich aufgehoben fühlt und ob die Pflegekraft entsprechende Bedürfnisse erfüllt, entscheidet sich in dieser Phase in welche Richtung sich die Beziehung entwickelt. Der Patient kann sich aktiv an der eigenen Pflege beteiligen, sie verweigern, oder sie einfach stillschweigend über sich ergehen lassen.
Eine weitere Phase ist dieNutzungsphase. In dieser Phase beginnt der Patient aktiv zu werden. Er kennt nun seine Umgebung und die Personen etwas besser. Durch die Informationen, die er bekommen hat, weiß er um seine Krankheit, weiß was er will und braucht und fordert dies alles aktiv ein. Es kommt zu Gesprächen mit Zimmernachbarn und anderen Patienten, die sich in einer ähnlichen Situation befinden, wie der Patient selbst. Durch die Erfahrungen der anderen Patienten wird er sich seiner eigenen Situation noch bewusster. Der Patient ist nun nicht mehr so abhängig von der Pflege, wie zu Beginn, sondern er hat sich weiterentwickelt. Auf diese Weiterentwicklung muss die Pflege eingehen. Der Patient möchte nun in der Regel mitbestimmen, was, wie mit ihm geschieht und kann das durch die gesammelten Informationen nun zu gewissen Teilen auch tun. Es entsteht somit eine kooperative Zusammenarbeit zwischen Pflegekraft und Patient in Bezug auf dessen Genesungsprozess.
Als letzte Phase beschreibt Peplau dieAblösungsphase. Irgendwann neigt sich die Zeit des Krankenhausaufenthaltes dem Ende entgegen und die Entlassung des Patienten rückt näher. Der Patient kehrt aus der Abhängigkeit wieder in sein normales Leben zurück und darauf muss er vom Pflegepersonal vorbereitet werden. Die Beziehung zwischen Patient und Pflegekraft endet und beide müssen davon loslassen.
Alle der vier Phasen dienen auf ihre eigene Art und Weise der Entwicklung der Beziehung zwischen Pflegekraft und Patient. Sie können sich wiederholen und finden in einem fließenden Übergang statt. Die Pflegekraft sollte also wissen, in welcher Phase sich ihre Beziehung mit dem jeweiligen Patient befindet, damit sie richtig agieren kann (vgl. Simpson 1997, S. 30ff).
3.1.2 Effektive Kommunikation
In ihrem Interaktionsmodell vertritt Pelplau die Aussage, dass eine Pflegekraft verschiedene Fähigkeiten besitzen muss, um durch die Kommunikation mit dem Patienten bei ihm auch etwas zu erreichen und an ihn heranzukommen. Diese Fähigkeiten richtig zu kennen und anzuwenden bedarf Erfahrung in der pflegerischen Tätigkeit und im Umgang mit Patienten. Die Pflegekraft muss die Fähigkeit besitzen, dem Patienten richtig zuhören zu können. DasZuhörenstellt die Grundlage für die Beziehung dar, denn durch das selbstlose Zuhören der Pflegekraft dem Patienten gegenüber, bringt ihm diese Aufmerksamkeit und Interesse entgegen. Auch das richtigeSprechenmit dem Patienten zählt zu den Fähigkeiten, die eine Pflegekraft in Bezug auf die Kommunikation besitzen sollte. Ebenso, wie die Medizin, bedient sich die Pflege der Fachsprache. Die Patienten sind in der Regel Laien und können meist weder mit medizinischen, noch pflegerischen Begriffen etwas anfangen. Die Pflegekräfte sollten sich daher einer Sprache bedienen, die die Patienten verstehen können. Dadurch begeben sie sich mit den Patienten auf eine Ebene und sind für diese ein ebenbürtiger Ansprechpartner. Eine weitere Fähigkeit ist die,Fragenrichtig und passend stellen zu können. Passend soll bedeuten, dass die Fragen an den Patienten so gestellt werden, dass das Pflegepersonal die Antworten bekommt, die es braucht, oder mit den Fragen erreicht, was es bezwecken will. Vor allem zu Beginn der Beziehung, also während der Orientierungsphase, sollte die Pflege die Führung der Gespräche übernehmen. Um ein Gespräch aufrecht zu erhalten und um Interesse zu zeigen, ist das Stellen von Fragen wichtig. Ist die Pflege- Patient- Beziehung schon weiter fortgeschritten, geht die Kommunikation auch oft vom Patienten aus und es besteht eine wechselseitige Interaktion. Um dahin zu gelangen, muss die Pflegekraft immer wieder versuchen, den Patienten mit in das Geschehen einzubeziehen. Das kann sie unter anderem durch einfühlsames Fragen erreichen.
Hildegard Peplau beschreibt in ihrer Theorie vier verschiedene Varianten von Fragen. Eine wesentliche Rolle spielen die sogenanntenoffenen Fragen. Offene Fragen entlocken dem Patienten mehr als nur eine Ja/Nein- Antwort. Durch sie soll der Patient seine Gedanken, Gefühle und Bedenken mitteilen und zum Beispiel beschreiben, wie er seine eigene Situation gerade wahrnimmt. Stellt das Pflegepersonal zielgerichtete offene Fragen, erhält es vom Patienten auch Informationen und Äußerungen von Gedanken, an die es persönlich gar nicht gedacht hat. Zum Beispiel könnte eine offene Frage lauten: „Sie sehen sehr nachdenklich aus. Was beschäftigt sie gerade im Moment?“.
Auf die offenen Fragen aufbauend empfiehlt Peplau die Verwendung vonklärenden Fragen.Klärende Fragen beinhalten Informationen, die vom Patienten gerade geäußert wurden und dienen vor allem dem besseren Verständnis des Gesagten, also wie die Pflegekraft die Antwort des Patienten verstanden hat: „Sie sagen also, dass sie Angst vor dem haben, was später auf sie zukommt. Was meinen sie damit genau?“ Durch diese klärenden Fragen ist es möglich kurze Dialoge zusammenzufassen und gegebenenfalls Missverständnisse durch falsches Verstehen schnell aufzuklären.
Ebenso wie die klärenden Fragen, bauenerweiternde Fragenauf offene auf. Diese Art von Fragen führen zu tiefergreifenden Gesprächen und Auseinandersetzungen mit bestimmten Themen. Dadurch, dass diese Fragen so tiefgreifend sind, lassen sie sich gut zur Klärung von bestimmten Sachverhalten und Problemen nutzen. „Was ist denn im Moment die Ursache dafür, dass sie sich Sorgen um ihre Selbstständigkeit in der Zukunft machen?“
Hypothetische Fragenbeziehen sich nicht auf die momentane Situation oder Vergangenes, sondern auf die Zukunft. Sie sind zum Beispiel nützlich, wenn die Pflegekraft wissen möchte, wie der Patient sein Leben mit oder nach der Krankheit in Zukunft einschätzt und was er erwartet: „Wie denken sie, werden sie in Zukunft mit ihrer krankheitsbedingten Einschränkung zurechtkommen?“. Der Patient darf durch die Fragen nicht überfordert werden. Daher ist es wichtig, die richtigen Fragen im richtigen Moment zu stellen. Je nachdem, was für Fragen gestellt werden, kann sich der Gesprächsverlauf beeinflusst lassen. Dem Patienten muss Zeit zum Nachdenken und Antworten gegeben werden. Auch das Schweigen der Pflegekraft in gewissen Situationen kann den Patienten zum Sprechen anregen und ihm das Gefühl vermitteln, dass man für ihn da ist (vgl. Simpson 1997, S. 35ff).
3.1.3 Rollen des Pflegepersonals
Bestimmte Situationen und Phasen in der Pflege erfordern ein gewisses Verhaltensmuster von der Pflegekraft. Dieses Verhaltensmuster ist geprägt, durch bestimmte gesellschaftliche Normen, also gewisse Richtlinien, an die sich die Pflegekraft in der jeweiligen Situation halten sollte. Das erforderliche Verhaltensmuster verdeutlicht die Pflegekraft am besten, in dem sie in verschiedene Rollen schlüpft. H. Peplau beschreibt in ihrem Modell sechs verschiedene Rollen, in die die Pflegekraft schlüpfen kann.
Zu Beginn der Pflege- Patient - Beziehung nimmt sie dieRolle als Fremderein. Es ist ganz normal, dass einem Menschen auf den ersten Blick entweder sympathisch oder unsympathisch sind. Das kann an ihrem Aussehen, an ihrer Art sich zu bewegen oder zu Sprechen liegen. Natürlich ist das auch in der Pflege der Fall. Nur darf eine Pflegekraft Patienten nicht in irgendwelche Schubladen stecken, sondern sie muss sie so akzeptieren, wie sie sind. Ihre Aufgabe ist es, den Patienten als Individuum zu betrachten und ihm Respekt und Verständnis entgegenzubringen. Würde die Pflegekraft sich von Sympathie oder Antipathie leiten lassen, würde eine gestörte Beziehung zum Patienten entstehen, welche auf Vorurteilen basiert.
Eine andere, weitere Rolle, nimmt derPflegende alsInformationsquelleein. Diese Rolle ist hilfreich um dem Patienten die nötigen und geforderten Informationen über seine Krankheit, zukünftige Maßnahmen und zur örtlichen Orientierung zu vermitteln. Die Pflegekraft muss in dieser Rolle unterscheiden können, ob die an sie gerichteten Fragen auch wirklich als Informationssammlung und zur Lösung von Problemen dienen, oder ob sie andere Hinter- beziehungsweise Beweggründe haben. Wichtig ist, dass die Patienten nicht mit Informationen überhäuft werden, sondern, dass die Pflegekraft einschätzen kann, wie viele Informationen der Patient im Moment verkraftet. Ein Pflegender in dieser Rolle sollte sich gut in seinen Patienten einfühlen und ihn beobachten können, um zu wissen, ob, welche und wie viele Informationen in seinem Fall angemessen sind. Im Laufe der Tätigkeit im Beruf bekommt man als Pflegekraft dafür mehr und mehr ein Gespür.
Ist die Pflege- Patient- Beziehung etwas weiter fortgeschritten und der Patient weiß um seine Situation, befindet sich also somit in der Lage sie auch einschätzen zu können, kann die Pflegekraft in dieRolle des Lehrendentreten. Hier steht die Vermittlung von Wissen über die Krankheit des Patienten, ebenso wie ihre Behandlung und pflegerische Maßnahmen im Vordergrund. Die Pflegekraft muss den Patienten auf seinem Wissensstand abholen, um ihn erfolgreich lehren zu können. Ziel der Wissensvermittlung soll auch sein, dass der Patient mit seiner Krankheit umgehen kann. Ist dies der Fall, können beide gemeinsam über den weiteren Therapieverlauf diskutieren und partnerschaftlich zusammenarbeiten, um gemeinsam gesteckte Ziele zu erreichen. Pflegetherapeutische Maßnahmen sind seitens der Pflege wesentlich leichter umsetzbar, wenn der Patient darüber aufgeklärt ist und auch um die Hintergründe weiß. Für ein effektives Lehren sind Einfühlsamkeit, Geduld und Verständnis für den Patienten wichtig, um das richtige Maß der Wissensvermittlung, mit den richtigen Worten zu ermöglichen.
Jede Pflegekraft besitzt eine andere Persönlichkeit und geht Dinge individuell an. Folglich ist auch der Umgang einzelner Pflegekräfte mit ihren Patienten verschieden. Wie die Pflegekraft mit ihren Patienten umgeht, zeigt sich nach Peplau, in ihrer Rolle alsFührungspersönlichkeit. Selbstverständlich spiegelt sich auch ein Teil davon, wie mit den Patienten agiert wird, in der Struktur der jeweiligen Einrichtung, in Anlehnung an die Gesundheitspolitik und verschiedenen Leitlinien wieder. Wichtig ist jedoch, dass Pflegekraft und Patient zusammenarbeiten und so eine sogenannte demokratische Pflege stattfindet. Jeder Patient braucht einen anderen Führungsstil. Manche Patienten benötigen eine starke forsche Art, andere wiederum viel Zusprache, Lob und Motivation. Das Ziel soll eine gute und effektive Zusammenarbeit unter der Führung der Pflegekraft sein.
Neben der führenden Position, nimmt die Pflegekraft auch dieRolle als Beraterfür den Patienten ein. Ziel des Beratens ist nicht etwa das Geben persönlicher Ratschläge, sondern eher die Vermittlung von Verständnis und Akzeptanz für die Situation des Patienten. Denn die positiven Erfahrungen, die der Patient dadurch macht, wirken sich auch positiv auf die Förderung seiner Gesundheit aus. Erreicht wird dies, durch Einfühlsamkeit, kommunikative Kenntnisse und Fachwissen der Pflegekraft. Die Rolle als Berater ähnelt der Beziehung zwischen einem Therapeuten und seinem Klienten, gleicht ihr aber nicht, da ein Therapeut in der Regel mehrere, oder gar alle Probleme seines Klienten therapiert, die Pflegekraft hingegen nur eins. Durch das Einfühlen in den Patienten und das gewonnene Vertrauen von ihm, ist es der Pflegekraft möglich, Probleme des Patienten zu erkennen und ihm zu helfen, diese aufzuklären. Sie nimmt sich Zeit, spricht mit dem Patienten über das Problem und hilft ihm, sich selbst zu verstehen, um es dadurch möglicherweise zu lösen. Grundlegend besteht die Rolle der Pflegekraft als Berater darin, dem Patienten aktiv zuzuhören, seine Aussagen und Gefühle noch einmal zu wiederholen, um ihm neutral zu verdeutlichen, wie es ihm geht und was in ihm vorgeht.
Zudem stellt Peplau dieRolle der Pflegekraft als Stellvertreterdar. Diese Rolle entsteht durch den Patienten. Es kann sein, dass die Pflegekraft den Patienten in ihrer Art, ihrem Verhalten, ihrem Aussehen oder ihrer Stimme jemandem ähnelt, den der Patient kennt. Möglicherweise steht diese Person dem Patienten nahe und das Auftreten der Pflegekraft erinnert ihn an gewisse Gefühle in Bezug auf die Person. Sicher wird er dies gegenüber der Pflegekraft erwähnen und in ihr automatisch die ihm bekannte Person sehen. Dadurch fühlt er sich nicht mehr fremd und wahrscheinlich auch nicht mehr so hilflos und allein, denn nun ist jemand da, den er kennt und an den er sich wenden kann. Nimmt die Pflegekraft die Rolle an, so wird die Barriere zwischen Pflegekraft und Patient gelöst und sie kann somit eine tiefergehende Beziehung zum Patienten aufbauen.
Welche Rolle das Pflegepersonal einnehmen kann oder sollte, wird im Laufe des Pflegeprozesses deutlich. In einer Beziehung zwischen Pflegekraft und Patienten sind nicht immer alle Rollen vorhanden. Es ist von Patient zu Patient unterschiedlich, ob und in welche Rolle das Personal schlüpfen kann, um dem Patienten zu helfen und die Beziehung zu ihm zu stärken. Ebenso ist es wichtig, dass dem Pflegepersonal die Rollen bekannt sind, denn nur so kann es ahnen, wie der Patient in Bezug auf das rollenspezifische Verhalten reagiert. Durch die verschiedenen Rollen in der Pflege wird deutlich, was Peplau unter effektiver Pflege versteht. Effektive Pflegebedeutet für Peplau, sich als Pflegekraft gegenüber dem Patienten in verschiedensten Situationen richtig verhalten zu können, um gemeinsam mit dem Patienten an seiner Genesung zu arbeiten und für sein Wohlbefinden zu sorgen (vgl. Simpson, S.41ff).
Verschiedene ähnliche Aspekte dieses Modells finden sich auch in der partnerzentrierten Gesprächsführung von Rogers wieder, die folgend beschrieben wird.
3.2 Die partnerzentrierte Gesprächsführung nach Carl Rogers
In diesem Kapitel der Arbeit wird bevorzugt die Bezeichnung Klient statt Patient benutzt, da Rogers auf diese Ausdrucksweise im Zusammenhang mit seiner Arbeit Wert gelegt hat: „Während ein Patient Objekt einer Behandlung ist, bleibt der Klient in der Gesprächspsychotherapie Subjekt“, (Ostermann 1996, S.134).
Carl Rogers entwickelte Regeln für eine Gesprächsführung, welche sich hauptsächlich am Interesse des Gesprächspartners orientiert. Diesem soll dadurch vor allem das ehrliche Interesse an seiner Person verdeutlicht werden. Im Gegensatz zu der partnerzentrierten Gesprächsführung existiert auch eine Grundhaltung in der vorwiegend die eigene Person im Mittelpunkt steht. Diese wird als Ich - zentrierte Grundhaltung bezeichnet. Auch in der Pflege tritt die Ich- zentrierte Grundhaltung sehr oft auf. Klienten befinden sich mit ihrer Krankheit in einer misslichen Lage, haben Angst und sind verunsichert. Sie wenden sich an das Pflegepersonal um in diesem jemanden zu finden, der ihnen zuhört und sie versteht. Allerdings will dieses dem Klienten in einer schwierigen Situation helfen und gibt nicht selten gut gemeinte Ratschläge oder erzählt aus dem eigenen Leben, in dem es vielleicht ähnliche, vergleichbare Umstände gab. Damit will das Pflegepersonal dem Klienten Hoffnung machen und ihm zeigen, dass es Menschen in ähnlichen Situationen gibt, denen es jetzt wieder gutgeht. Allerdings hilft dies dem Klienten in der Regel nicht weiter. Der Klient wird der Pflegekraft entweder einfach Recht geben, oder streitet die Meinung oder den Lösungsvorschlag vehement ab, da dieser seiner Situation nicht gerecht wird. Egal wie der Klient darauf reagiert, er wird sehr wahrscheinlich unzufrieden sein und sich in seiner Person nicht verstanden fühlen, denn was hat er mit Situationen aus dem Leben der Pflegekraft zu tun? Hier muss es also noch eine andere Möglichkeit geben, dem Klienten in seinem Anliegen besser entgegenzukommen. Diese besteht darin, sich ausschließlich an dem zu orientieren, was der Gesprächspartner, also in diesem Fall der Klient sagt und fühlt. Bei der partnerzentrierten Gesprächsführung ist es wichtig, die eigene Meinung und eigene Erlebnisse in den Hintergrund zu stellen, auch wenn das anfangs sicher schwer fällt. Die eigenen Gefühle müssen einem aber trotzdem bewusst sein, denn nur so kann man sich auf die des Patienten einlassen und ihm offen und ehrlich entgegentreten. Viel wichtiger, als gut gemeinte Ratschläge, ist es für den Klienten, sich in seiner Situation und Person verstanden zu fühlen. Carl Rogers vertritt die Meinung, dass jeder Mensch seine Probleme am besten selbst lösen kann. Allerdings ist dies nur möglich, wenn die jeweilige Person frei von Ängsten und Sorgen ist, denn mit diesen ist es ihr nicht möglich klar zu denken. Das heißt also, Ziel der partnerzentrierten Gesprächsführung ist es, dafür zu sorgen, dass sein Gegenüber klar denken kann und sich selbst versteht.
Das Pflegepersonal hat demnach laut Rogers die Aufgabe, dem Klienten gegenüber Interesse aufzubringen. Dieses sollte echt und nicht aufgesetzt oder geheuchelt sein, denn das spürt der Patient anhand der nonverbalen Zeichen, welche gleichzeitig übermittelt werden. Um wirkliches Interesse zu verdeutlichen, empfiehlt Rogers, dass die Pflegekraft die vom Klienten angesprochenen Gefühle noch einmal wiederholen und ihm damit das Gefühl der Bestätigung und des Verstandenwerdens vermittelt werden soll. Auch hier ist es wieder wichtig, dass keine eigene Meinung, zum Beispiel in Form einer Bewertung des vom Klienten Gesagten, eingebracht wird. Dieses echte Interesse und das dadurch beim Patienten ausgelöste Vertrauen sorgen laut Rogers dafür, dass die Ängste und Unsicherheiten der Patienten langsam abgebaut werden. Dadurch, dass die Gefühle und Äußerungen des Klienten ernst genommen undakzeptiertwerden, ohne dass daraufhin Ratschläge oder Wertungen seitens der Pflege folgen, ist es dem Klienten möglich, zu sich selbst zu finden. Um den Klienten verstehen zu können ist eine weitere Regel von Rogers dieEmpathie. Durch die Empathie, also das Einfühlen in den Gesprächspartner, ist es der Pflegekraft möglich, vielleicht Dinge zu verstehen, die der Klient selbst nicht versteht oder erkennt. Wenn diese Dinge beziehungsweise Gefühle nun paraphrasiert werden, so gibt das dem Klienten eine weitere Chance sich selbst zu verstehen und kann zur Problemlösung beitragen. Beim Paraphrasieren wiederholt die Pflegekraft das, was der Klient gesagt hat mit eigenen Worten, so, wie sie es verstanden hat. Durch das Paraphrasieren kann auch enorm an Zeit gespart werden, denn dadurch, dass der Empfänger die Nachricht des Senders noch einmal so wiederholt, wie er es verstanden hat, können eventuelle Missverständnisse sofort geklärt und beseitigt werden, ohne das es zu größeren Konflikten kommt (vgl. Ostermann 1996, S.131ff).
Um die einzelnen Aspekte der partnerzentrierten Gesprächsführung näher zu beschreiben werden sie folgend noch etwas genauer erläutert.
3.2.1 Akzeptanz
Wie oben bereits erwähnt ist das akzeptieren der Gefühle des Patienten eine von Rogers ernannten Regeln in der partnerzentrierten Gesprächsführung. Unter Akzeptanz wird eine uneingeschränkte, positive Wertschätzung des Klienten verstanden. In dieser Vorstellung müssen alle Äußerungen über Gefühle und die eigene Welt des Klienten ernst genommen und akzeptiert werden. Wichtig ist allerdings, dass das Gesagte des Klienten nicht den eigenen Wertvorstellungen und Gefühlen entsprechen muss, sondern eigenem Empfinden auch durchaus widersprechen darf. Nur soll dem Klienten nicht widersprochen und seine Meinung und sein Verhalten nicht bewertet werden. Würde dies geschehen, ist es dem Klienten kaum möglich, seine Gefühle zuzulassen, geschweige denn zu äußern. Um dem Klienten Akzeptanz gegenüber zu zeigen ist es wichtig, dass ihm keine persönlichen Ratschläge entgegengebracht oder Vorschriften gemacht werden. Auch wenn das nur gut gemeint ist, kann es beim Klienten dazu führen, dass er sich missverstanden und nicht akzeptiert fühlt. Folgend ist es sicher nicht mehr so einfach, ihn dazu zu bringen, dass er sich offen über seine Gefühle und Gedanken äußert. Wirkliche Akzeptanz zeigt sich vor allem durch gutes Zuhören, Respekt, Anteilnahme und Verständnis. Weiterhin sollte die Hingabe gegenüber dem Klienten ohne jegliche Bedingungen und nicht Mittel zum Zweck sein: „Na gut Her Müller. Ich gebe Ihnen 5 Minuten, da können Sie mir erzählen was mit Ihnen los ist, wenn Sie sich danach endlich von mir helfen lassen.“ Fühlt der Klient sich akzeptiert, so wird seine Selbstwertschätzung steigen und seine Unsicherheiten wie auch Ängste sinken. Vorher möglicherweise vorhandene Abwehrhaltungen gegenüber dem Pflegepersonal und der Behandlung werden weniger und der Patient beginnt sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, was den Heilungsprozess durchaus positiv beeinflussen kann (vgl. Wingchen 2000, S. 50ff).
3.2.2 Kongruenz
Unter der Bezeichnung „Kongruenz“ versteht Rogers das Übereinstimmen der eigenen Gefühle und Gedanken einer Person, mit dem was sie verbal und nonverbal zeigt. Das heißt, es ist wichtig, sich gegenüber seinem Gesprächspartner so zu verhalten und zu geben, wie man wirklich ist. Durch verstellen, gekünsteltes Verhalten oder ein sogenanntes „Maskengesicht“ kommt bei dem Gegenüber nur unnötiges Misstrauen auf, was den Prozess der Interaktion behindert. Das Pflegepersonal muss zu seinen eigenen Gefühlen stehen und diese auch mitteilen, ohne den Klienten dabei zu bewerten oder zu verletzen. Gefühle, die während eines Gespräches aufkommen, sollten keinesfalls geleugnet werden, denn durch das Verdrängen der eigenen Gefühle kann es zu erheblichen Missverständnissen kommen. Fühlt sich eine Pflegekraft beispielsweise durch einen Klienten verletzt und sagt diesem das nicht, so kann es nicht zu einer Klärung der Situation kommen. Daraufhin wird die Pflegekraft das Zimmer dieses Klienten stets mit Vorurteilen betreten und nur das nötigste tun und sagen. Daraus kann sich ein großer Teufelskreis der Missverständnisse entwickeln und der Genesungsprozess des Patienten kann durchaus beeinflusst werden. Zum Äußern der eigenen Gefühle empfiehlt es sich, sich der „Ich - Botschaften“ zu bedienen, auf die später näher eingegangen wird. Wichtig ist allerdings, dass die Kongruenz dem Klienten angepasst wird. Mit dementen Klienten ist anders umzugehen als mit einem „normalen“ Patienten. Dieses Anpassen geschieht am besten durch die Empathie (vgl. Matolycz 2009, S. 102ff).
Positiv wirkt sich auch das Vorstellen der eigenen Person aus. Dabei ist darauf zu achten, sich nicht hinter einer bestimmten Berufsbezeichnung zu verstecken wie Schwester oder ähnliches, sondern den richtigen, vollständigen Namen zu nutzen. Das gibt dem Klienten das Gefühl als Pflegekraft nicht unantastbar, sondern für ihn, als Patient auch erreichbar zu sein. Dadurch und durch die dem Klienten gegenübergebrachte Echtheit kann dieser Vertrauen fassen und die Pflegekraft ernst nehmen und achten. Der Klient ist durch die Kongruenz des Pflegepersonals in der Lage, sich mit sich selbst auseinanderzusetzten. Ihm wird verdeutlicht, wie andere seine Gefühle aufnehmen, sie empfinden und darüber denken. Dabei ist darauf zu achten, dass sich die Pflegeperson nicht mit der Situation des Klienten übernimmt. In solchen Fällen ist es dringend anzuraten, psychologisches Fachpersonal mit einzubinden. Das Pflegepersonal ist dazu da, dem Klienten zu helfen und dafür ist es wichtig, dessen Gefühle zu kennen und mit ihm darüber zu kommunizieren. Nur so ist es möglich, den therapeutischen Hilfebedarf durch die Pflege abzudecken. Psychotherapeutisches Fachpersonal darf aber auf keinen Fall durch Pflegepersonal ersetzt werden (vgl. Wingchen 2000, S.55ff).
[...]
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Erstausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2012
- ISBN (Paperback)
- 9783955491253
- ISBN (PDF)
- 9783955496258
- Dateigröße
- 1.4 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Katholische Hochschule Freiburg, ehem. Katholische Fachhochschule Freiburg im Breisgau
- Erscheinungsdatum
- 2013 (Juli)
- Note
- 1,7
- Schlagworte
- Pflegeschüler Carl Rogers Pflegekraft Empathie Genesung
- Produktsicherheit
- BACHELOR + MASTER Publishing