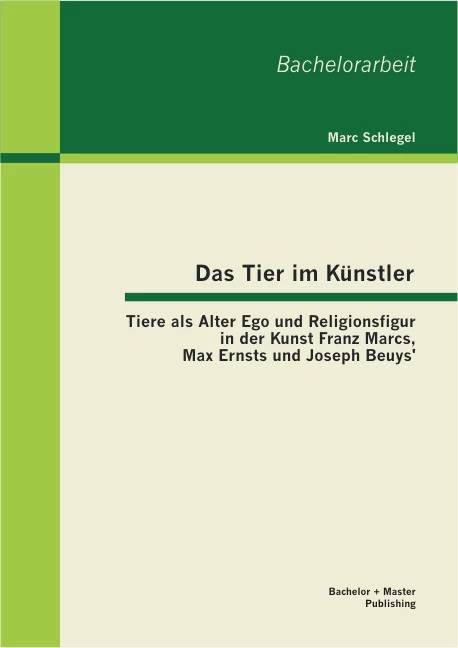Das Tier im Künstler: Tiere als Alter Ego und Religionsfigur in der Kunst Franz Marcs, Max Ernsts und Joseph Beuys'
Zusammenfassung
Diese besondere, spirituelle Bindung zwischen Mensch und Tier findet ihren Höhepunkt im späten 19. und 20. Jahrhundert. Initiiert durch Franz Marcs sensible Annäherung an Seele und Charakter des Pferdes, das zum Symbol seiner utopischen Zukunftsentwürfe wird, entwickelt sie sich über Max Ernsts teils skurrile, teils plakative Verschmelzung mit dem Vogel-Alter Ego Loplop zu einem wichtigen Element des Künstlercharakters. Sie gipfelt schließlich in den para-schamanistischen Ritualen Joseph Beuys‘, in denen er die Eigenschaften des Tieres auf sich zu übertragen und als Gesellschaftsheiler Tier- und Menschenwelt wieder zu vereinen versucht.
Anhand exemplarischer Beispiele aus dem Oeuvre Franz Marcs und Max Ernsts, sowie Joseph Beuys‘ Aktionen „Wie man dem toten Hasen die Bilder erklärt“, „I like America and America likes me: Coyote I“ und dem Goldhasen der „7000 Eichen“ werden in dieser Arbeit sowohl die reellen Grundlagen dieser Entwicklung in den einzelnen Künstlerbiographien als auch ihr großer Nutzen als nie versiegende Inspirationsquelle diskutiert.
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
2.2.2.2. Spielende Formen, 1914
[1] 1914 entsteht Marcs letztes großes Gemälde, das bezüglich seiner animistischen Qualität und als Weiterentwicklung der „Tierkomposition“ angesprochen werden sollte, auch wenn es nur bedingt als Tierdarstellung verstanden werden kann. Eine detaillierte Beschreibung der abstrakt aufgefächerten querformatigen Fläche würde wohl den Rahmen des Kapitels sprengen. Auf der linken Seite finden sich die quaderförmigen Strukturen der „Tierkomposition“ von 1913, hier in sanften Pastelltönen gestaltet und von tentakelartigen, organischen Formen bewachsen. Diese Zone geht in ein undurchdringliches Gemisch aus rundlichen, violett- und karminroten Feldern über, das in die rechte Bildregion greift. Sie wird von vegetabilen Halm- und Blätterformationen aus kühlen Grün- und Blauschattierungen belebt.
Auch inhaltlich lassen sich die „Spielenden Formen“ in drei Bereiche aufteilen. Die eckig geometrischen Figuren links lassen, wie schon in der „Tierkomposition“, Assoziationen zu kantigen Felslandschaften zu. Durch die feinen Farbtöne noch verstärkt, erinnern sie teilweise an bauklötzchenhafte Dach- oder Gebäudestrukturen. Ein milder, in Delaunayscher Abstraktion verborgener Hinweis auf Stadt bzw. Zivilisation scheint möglich. Die Formationen des rechten Bilddrittels sind am durchschaubarsten: ein Dschungel saftgrüner Ranken und Blätterpflanzen, die dem oberen Bildrand entgegen wuchern. Geschickt eingesetzte Blau- und Gelbschattierungen verstärken die imaginative Tiefe des Dickichts zusätzlich.
Problematischer und assoziativen Zugängen eher verschlossen zeigt sich der rote Kern in der Mitte des Werks, der nicht nur aufgrund seiner Farbe als der Fokus, das Herz des Ganzen erscheint. Jede Interpretation von Absoluter Malerei, die Marc nun endlich erreicht hat und die ihn vollkommen von der Form emanzipiert, mag tendenziell, oft auch erzwungen wirken. Doch zieht man zum Vergleich den direkten Vorgänger der „Spielenden Formen“, die 1913 vollendeten, großformatigen „Stallungen“[2] heran, so ist die Versuchung groß, aus den pulsierenden roten Körpern die Rundungen von Pferdeleibern herauszulesen, prismatisch in die Unkenntlichkeit aufgebrochen. Sie erinnern stark an das im Profil gezeigte orangerote Pferd der „Stallungen“, in dessen abstrahierten Körper sich ähnlich flammende Formungen finden. Auch der Schwung der beiden Halme, die sich aus der rechten Bildzone in die Mitte verirrt haben, ist nah an dem der Pferdeschweife in der Vorstufe von 1913. Marc selbst schreibt einige Monate später in einem Brief an seine Frau, dass „abstrakte Bilder ohne Gegenstand“ nicht existieren. Er „steckt immer drin, ganz klar und eindeutig, nur braucht er nicht immer äußerlich da und augenfällig zu sein.“[3]
Dennoch sind solche Interpretationsversuche immer derart subjektiv, dass ihnen nicht zu viel Bedeutung eingeräumt werden sollte. Es wäre aber falsch davon auszugehen, Marc habe in seinen abstrakten Werken völlig frei von natürlichem Bezug gemalt. Es würde weder zu seinen zeitnahen Aussagen noch zu seiner bisherigen Malerei passen. Seinen Weg in die Abstraktion, „in (der) das Lebensgefühl ganz rein klingt“, erklärt er ein Jahr später als Suche nach dem Reinen und Guten.[4] Doch darf man diese Begriffe nicht nur im romantischen, religiösen Sinne verstehen, der in Aussagen des frommen Franz Marc sicher mitschwingt. Als das Reine versteht sich auch die animistische Kraft der Natur, das Wesen der Dinge, hinter ihrer äußeren Fassade. Marc, der den Tod als Erlösung sieht, als „die Zerstörung der Form, damit die Seele frei wird“[5], versucht in seiner abstrakten Malerei eben dieser Energie nachzuspüren, indem er die Körper seiner Tiere auflöst, tötet, und ihre anima freisetzt. So führt er am Ende seiner künstlerischen Karriere „die Kreatur wieder in den Kreislauf der Schöpfung zurück“[6], die sich ausschließlich aus den titelgebenden „Spielenden Formen“ zusammensetzt. Einem Fenster gleich bietet er uns einen Einblick in sein pantheistisches Utopia, in dem die Lebenskräfte der Natur, ganz gleich ob von Erde, Pflanzen oder Tieren, unauflöslich miteinander verbunden sind. Er verschmilzt sie „zu einer neu von ihm eroberten Weltanschauung.“[7]
2.3. Das Tier als Identifikationsmittel
Eine zweite Konstante in der Kunst Franz Marcs ist der Versuch, die Tiere als Identifikationsfläche für das Publikum (auch für sich selbst) darzustellen. Diese Tendenz ist natürlich nicht strikt von seinen eher ideologischen, animistischen Bemühungen zu trennen, aber doch so ausgeprägt, dass sie gesondert betrachtet werden sollte. Die bereits angesprochene Suche nach dem Reinen im Tier ist dabei Ausdruck seiner Sehnsucht nach einer „vita nuova“[8], von der er im Vorwort zu einer geplanten, aber nie vollendeten zweiten Ausgabe des Almanachs „Der Blaue Reiter“ spricht. Als Gegenbewegung zu der in seinen Augen von der Natur entfremdeten, urbanen Welt beschwört er in seiner Kunst einen Umbruch, der den modernen Menschen zurück in den natürlichen, „frommeren“ Kosmos der Tiere führen soll. Ganz im Sinne seiner pantheistischen „vita nuova“, die Marc aus der Metropole München hinaus in die beschauliche bayrische Ländlichkeit führt, in der er zwischen Tieren arbeiten kann, schafft er Werke, die den Betrachter zwingen, sich in die Kreatur einzufühlen. So erfüllt sich sein Verlangen nach einer geistigen Vereinigung von Mensch und Tier wenigstens in der Kunst, in der er ähnlich den ihm philosophisch verwandten deutschen Romantikern des 18. und 19. Jahrhunderts das wichtigste Mittel der „kommenden geistigen Religion“ sieht.[9]
2.3.1. Pferd in Landschaft, 1910
[10] Ein frühes und prägendes Ergebnis dieser Sehnsucht ist das Gemälde „Pferd in der Landschaft“ von 1910. Es resultiert aus einem Detail dreier Vorarbeiten, die eine ganze Gruppe weidender Pferde zeigen.
Der tierische Protagonist des Gemäldes ist in die untere rechte Ecke gerückt und - untypisch für Marc - stark angeschnitten. Er setzt so den sanft zur Seite geneigten Kopf der Rückenfigur zentral in die Bildmitte. Die sich vor dem Pferd eröffnende horizontlose Landschaft ist bereits deutlich von Marcs Experimenten mit abstrakten Farbfeldern geprägt, aber als Weiterentwicklung der Vorarbeiten noch entfernt als mild ansteigende Hügellandschaft zu identifizieren. In satten Rot-, Gelb- und ihren Mischtönen gehalten, versetzen einzelne buschgrüne Flächen sie in einen monoton schwingenden Rhythmus.
Durch die ungewöhnliche Position des Tieres verringert Marc die Distanz zum Betrachter auf ein Minimum. Stellt er einige Monate später in einem Brief an Reinhard Piper die Frage „wie sieht ein Pferd die Welt, oder ein Adler, ein Reh oder ein Hund?“[11], so versucht er sie hier bereits zu beantworten. Das entstofflichte und damit unverständliche Stück Land, das sich in diesem Pferdeportrait vor dem Beschauer auftut, zwingt ihn in Verbindung mit der ungewöhnlichen Nähe zum Tier dazu, die Natur durch seine Augen zu erleben. Von der künstlerischen Konvention, in einem Gemälde „Tiere in eine Landschaft zu setzen, die unsren Augen zugehört“, rückt Marc hier erstmals ab, um sich „in die Seele des Tieres zu versenken, um dessen Bildkreis zu erraten“.[12] Das Tier ist nicht mehr nur durch das Künstlerauge gesehenes Bildobjekt. Indem der Betrachter sich in seine Wahrnehmung hineinfühlen muss, subjektiviert er es. So erklärt sich wohl auch, warum Marc gerade diesem Mitglied der „Weidenden Pferde“[13] ein eigenes Gemälde widmet. Schon in den Vorarbeiten scheint die Rückenfigur seltsam entrückt und in Gedanken versunken. Durch den kontemplativen Ausdruck dieser Rückenfigur gelingt es Marc, dass sich auch der Betrachter die Frage „Wie sieht ein Pferd die Welt?“ stellen muss. Er spricht dem Tier eine eigene Art der Wahrnehmung, ein eigenes Seelenleben zu, „erhöht (es) zu sich“[14] und damit auch zu uns. Denn indem wir uns mit diesem „Pferd in der Landschaft“ identifizieren müssen, um die abstrakte Bildwelt durch seine Augen zu sehen und zu verstehen, messen wir seinen Empfindungen den gleichen Rang bei wie unseren eigenen. Einige Kritiker mögen von einer Vermenschlichung des Tieres in seinen Werken sprechen[15], doch dieser Terminologie hätte sich Franz Marc wohl weniger angeschlossen. Vielmehr ist es der menschliche Beschauer, der „animalisiert“ wird und zu einer Einheit mit dem Ross finden muss.
2.3.2. Das Tier in Marc?
Einen ähnlichen Effekt erzielt ein Jahr später auch das „Blaue Pferd II“[16], eine Rückenfigur, die, wie ihr Vorgänger, mit leicht zur Seite geneigtem Kopf im verlorenen Profil in die abstrakt aufgelöste Landschaft schaut. Voll vergeistigter, meditativer Ruhe lädt das Tier den Betrachter ein, die Bildwelt durch seine Augen zu sehen. Es entsteht quasi als Spiegelbild zum „Blauen Pferd I“[17], in dessen monumentaler Entschlossenheit der Amerikaner Frederick S. Levine später gar ein Selbstporträt des Künstlers sehen will.[18] Ob Marcs eigene Identifizierung mit dem Tier wirklich so weit geht, ist unklar. Hinweise darauf finden sich jedoch im Schriftverkehr mit Freunden. So schickt er dem von konservativen deutschen Kunstkritikern enttäuschten Paul Klee 1914 eine Postkarte[19], auf der er Klee als stolz harrenden Löwen darstellt, der dem Angriff einer Meute blauer Füchse (den Kritikern) gelassen entgegensieht. Marc selbst wird auf der Karte von einem kleinen mitternachtsblauen Pferd verkörpert, das dem Löwen Klee schützend zur Seite steht.[20] Hier nutzt Marc also tatsächlich das blaue Pferd, das schon zu Lebzeiten synonym mit dem Künstler genannt wird, als Identitätsfigur. Um sich von der Kunst Kandinskys und Burljuks abzugrenzen, die seinen eigenen Stil radikal beeinflusst, beschreibt er selbst bereits 1911 das besondere, eigene, seiner Kunst als den „Hufschlag meiner Pferde“[21], eine Formulierung, die er vermutlich einem Brief August Mackes aus dem Vorjahr entnommen hat.[22] Nicht nur er selbst, auch Kollegen erkennen bereits früh den Menschen Marc und seine künstlerische Signatur als unumgänglich verknüpft mit seinen Pferdedarstellungen.
Else Lasker-Schüler schreibt ihm einmal scherzhaft: „(…) Du bist ja selbst ein Pferd, ein braunes, mit langen Nüstern, ein edles Pferd mit stolzem, gelassenen Kopfnicken.“[23] Und tatsächlich scheinen auch Marcs Wesen und sein Äußeres diese enge Verknüpfung mit dem Tier begünstigt zu haben. Kandinsky kommt nicht umhin, ihn in einer postumen Beschreibung mit seinem Schäferhund Russi zu vergleichen, „dessen Art, Charakterschärfe und Milde eine genaue vierbeinige Kopie seines Herrn bildeten“, um Marcs „organische, tiefinnere Beziehung (…) zu der gesamten Tierwelt“[24] zu betonen. Auch in Albert Blochs Charakterisierung aus demselben Jahr schleichen sich immer wieder direkte Vergleiche mit seinen Tieren sowie physiognomische Beschreibungen, die unweigerlich an eines seiner Pferde erinnern. Die „großen Knochen, großen Muskeln, (…) auf den ersten Blick etwas schwerfällig, (…) sich im Sprechen und Zuhören dem Begleiter entgegenneigend (…) und seine Gemälde sind alle in ihrer Art Ebenbilder dieser äußeren Erscheinung.“[25] Natürlich dürften diese und ähnliche Aussagen vom Andenken an Marcs künstlerisches Erbe beeinflusst sein. Sie sind ein Beweis für die anfangs angesprochene Verknüpfung von Künstler und Sujet.
Franz Marc schreibt in einem Brief an den kritischen Delaunay: „Ich male so, wie ich lebe: instinktiv. Erst wenn eine Arbeit fertig ist, wird mir meine Entwicklung bewusst.“[26] Angesichts überlieferter Vorstudien einiger seiner Gemälde mag der Wahrheitsgehalt dieser leicht mystifizierenden Aussage zwar relativ scheinen, doch kann man Marc vor dem Hintergrund zahlreicher Aussagen von Freunden und Kollegen wohl kaum absprechen, dass seine Werke Ausdruck seines Wesens, seines „inneren Tieres“, sind. Die Worte Theodor Däublers, „die Seele des Pferdes (heißt): Ins-Rasen-Geraten. Sein inneres Weiter-Muß erfaßt es in Spiralen, …“[27] verstärken diesen Eindruck. Denn welche Tierseele wäre dem ewig suchenden Franz Marc ähnlicher als die des nach außen ruhigen, innerlich rasenden Däublerschen Pferdes? Sein „Weiter-Muß“ zeigt sich in den enormen stilistischen Sprüngen, die Marc in seiner vergleichsweise kurzen künstlerischen Karriere macht, um seinem Ideal der reinen, moralischen Welt der Tiere näher zu kommen. Sein „Ins-Rasen-Geraten“ in der Leidenschaft, mit der er vom Anbruch seiner „vita nuova“ spricht und die seine „Milde“ und „Schwerfälligkeit“ so auffällig kontrastiert.
Sie verleitet ihn später dazu, sich freiwillig für den Ersten Weltkrieg zu melden. Anfangs sieht er in dem ungeahnt brutalen Krieg noch ein notwendiges Mittel, die alte Ordnung zugunsten der „vita nuova“ zu zerstören. Um diese neue Welt zu erreichen, „muss die Nabelschnur durchschnitten werden, die uns mit der mütterlichen Vergangenheit verbindet.“[28] Die Realität der Schlacht holt ihn jedoch schnell ein und er fällt am 4. März 1916 bei Verdun, deutlich vom Krieg gezeichnet und der alten Weltordnung überdrüssig. Sein animistisches Utopia wird sich außerhalb seiner Kunst nicht erfüllen.
3. Max Ernst
3.1. Annäherung an das Tierische als Rebellion gegen menschliche Normen?
Ganz anders als Franz Marc, aus dessen Werken und Briefverkehr Hinweise auf den identitätsstiftenden Charakter des Pferdes mühsam herausgelesen werden müssen, hinterlässt der elf Jahre jüngere Max Ernst der Kunstgeschichte einen reichen Bestand an Schrift- und Bildquellen, in denen er seine psychische Bindung an ein tierisches Alter Ego offen kundtut. In voller Absicht kürt er den Vogel, erst Hornebom oder Loplop, später Schnabelmax genannt, zu seinem Totem und konstruiert um ihn herum einen pseudo-biographischen Künstlermythos, der sein gesamtes Oeuvre beeinflusst. Doch welchen Nutzen hat die Etablierung eines tierischen Ichs für Ernst?
Die Hinwendung zur Mythologie vergangener Völker und Jahrhunderte ist ein wichtiges Merkmal verschiedener Kunstrichtungen seiner Zeit. So hat Picasso seinen Minotaurus, Boiffard seine Sphinx – und auch der Vogel entspringt dieser mythischen Tradition, gehören doch „Menschen mit Vogelköpfen (zu den) ältesten mythologischen Erfindungen“[29] und lassen sich bereits in prähistorischen Höhlenmalereien nachweisen. Max Ernst geht jedoch weiter als seine Kollegen. Ihm reicht der einfache Bezug zur kollektiven menschlichen Sagenwelt nicht, in der die Vielfalt fantastischer Vogelwesen von den grauenhaften Sirenen und Harpyien der alten Griechen bis hin zu Vogelmenschen in einfacher Steinmalerei der Osterinseln reicht.[30] Vielmehr macht er sich diese mnemonische Kraft zu Eigen und bereichert mit ihr seine Künstlerpersona.
Max Ernst wird 1891 als drittes von insgesamt neun Kindern in die streng katholische Familie des Taubstummenlehrers und „Sonntagsmalers“[31] Philipp Ernst geboren. Die Kunst seines Vaters ist ihm zwar Anstoß für eigene Beschäftigung mit der Malerei, sein konservativer Stil dient ihm jedoch als Negativbeispiel. So will er schon als Kind erkannt haben, dass „etwas nicht stimmen (kann) in der Wechselbeziehung zwischen Maler und Modell“ und nimmt sich vor, „dem Unfug ein Ende zu machen“.[32] Auffällig ist, wie Ernst in der Rückbesinnung auf seine Kindheit die strikten Wertesysteme der elterlichen Religion verdammt und betont, dass ihm Pflichten schon als Kind zuwider sind.[33] Dagegen haben ihn „das Wertlose, die flüchtigen Vergnügen, das Schwindelgefühl, die kurz dauernde Wollust (…) eitle(r) Wahn (…) Augenlust, Fleischeslust, Hoffart angezogen“[34], die in der kleinbürgerlichen Welt des katholischen Brühl verteufelt werden. Die frühe Ablehnung normativer Konvention prägt sein gesamtes künstlerisches Schaffen. Nach dem Abitur studiert er von 1910 bis 1914 an der Universität Bonn die Fächer Kunstgeschichte und Philosophie, zeigt aber großes Interesse an Psychologie und Psychiatrie. Er besucht Vorlesungen dieser Fachgebiete und kommt erstmals in Kontakt mit den Lehren Sigmund Freuds und dessen Antagonisten C. G. Jung.[35] Diese psychoanalytischen Texte, deren Einfluss auf Kunst und Literatur des 20. Jahrhunderts wohl größer ist als auf die heutige Psychologie, bilden den idealen Nährboden für den Aufbau seines tierischen Alter Egos. Hinzu kommt eine durchgängige Begeisterung für das literarische Oeuvre skurriler, ins Phantastische driftender Schriftsteller.[36] Er verehrt den Wunderland-Schöpfer Lewis Carroll[37], E. T. A. Hoffmann (dessen Novelle „Der Sandmann“ zum Objekt psychoanalytischer Interpretation wurde[38] ) und Franz Kafka, der seinen tragischen Helden Gregor Samsa in „Der Verwandlung“ bereits 1912 einer Metamorphose ins Tier unterzieht, um Abgründe und Herzlosigkeit des Spießbürgertums aufzuzeigen. Genau auf diese Dekonstruktion der kleinbürgerlichen, verbohrten Welt, der seine Eltern angehören, zielt auch Max Ernst ab. So führt er nach der traumatischen Teilnahme am Ersten Weltkrieg „Angriffe auf die Zivilisation, die diesen Krieg herbeigeführt (hat)“.[39] Er besinnt sich in seinem graphischen Werk auf längst überholte Techniken wie den Holzschnitt zurück, um sich gegen den modernen Fortschrittsglauben zu richten[40] und fordert eine „Rehabilitierung des Übersehenen“, indem er sich in den Übermalungen und Collagen, die einen großen Teil seines Hauptwerks stellen, bevorzugt unspektakulärer, einfacher Bildteile aus Werbungen oder trivialer Illustrationen bedient.[41] Diese anti-kulturelle Haltung schlägt sich nicht zuletzt in der Selbstdarstellung als entmenschlichtes Vogelwesen nieder, als das er sich auf Kostümfesten der Künstlerin Léonor Fini auch ganz direkt präsentiert.[42] Im Sinne seiner eigenen Mystifizierung enthebt er 1951 auch seine Geburt der menschlichen Sphäre:
„Am 2. April 1891, um 9.45 Uhr, hatte Max Ernst seinen ersten Kontakt mit der fühlbaren Welt, als er aus dem Ei schlüpfte, das seine Mutter in eines Adlers Nest gelegt hatte, und welches der Vogel dort sieben Jahre lang ausgebrütet hatte.“[43]
Dieses sagenhafte Märchen seiner bereits pränatalen Bindung an die Welt der Vögel erinnert unweigerlich an antike Sagen, etwa die der Schönen Helena, die aus einem Ei der in einen Schwan verwandelten Leda schlüpft. Ernst verwischt die Grenze zwischen menschlicher und tierischer Sphäre gute zehn Jahre später biographisch etwas glaubhafter, als er 1962 in seinen „Biographischen Notizen“ von der Geburt seiner Schwester Loni 1906 berichtet. In derselben Nacht stirbt „ein Freund namens Hornebom, ein kluger, buntgescheckter, treuer Vogel“. Im kindlichen Gemüt des jungen Max kommt es „zu einer Art von Ausdeutungswahn, als ob die eben geborene Unschuld (Loni), sich in ihrer Lebensgier des lieben Vogels Lebenssäfte angeeignet hätte. Die Krise ist bald überstanden. Doch dauert in des Jünglings Phantasie eine freiwillige-irrationale Vorstellungs-Vermengung von Menschen mit Vögeln und anderen Lebewesen (an)“.[44]
Wie realitätsnah diese Anekdote ist, kann heute schwer nachvollzogen werden. Dass er es mit der Wahrheit nicht allzu genau nimmt, gibt Ernst aber schon 1921 zu, als er die Worte „Max Ernst ist ein Lügner“[45] auf ein Ausstellungsplakat drucken lässt. Später gesteht er seinem Sohn, der enigmatische Name „Loplop“ sei schlicht und ergreifend einem Spiel zwischen Vater und Kind entlehnt, dem er beim Reiten auf dem Schaukelpferd „Galopp – Galopp“ vorsingt.[46] Dies verschweigt er freilich dem Publikum; es habe ihm „zu viel Spaß gemacht, zu sehen, was sie sich selbst an Legenden ausdenken konnten.“[47] Ganz bewusst fördert er so die Mythenbildung um seine eigene Person. Ob es den Freund der Kindheit, der später als der Vogelobre Hornebom in seine Kunst einzieht, wirklich gab, ist dabei jedoch ebenso irrelevant wie die Unmöglichkeit einer menschlichen Geburt aus einem Ei. Ernst nutzt diese Märchen, um gegen das „generelle Gefangensein des Menschen“[48] zu protestieren und sich der realen Welt mit ihren „vom Kausalgesetz regierten Konventionen“[49], deren traditioneller Betrachtung seine eigene Kunst „unannehmbar“[50] ist, zu entheben. Er schafft sich einen surrealen Kosmos, in dem Mensch und Tier ineinander verschwimmen und löst so deren klassische Hierarchie auf.
3.1.1. Oedipe (Kap. 4, 131), Illustration aus „Une Semaine de bonté“, 1934
[51] Ein wichtiges und für Ernst typisches Mittel zur Zersetzung künstlerischer Normen sind die Collagenromane, in denen er literarische Konventionen demontiert. Innerhalb von nur fünf Jahren entstehen drei solcher Bildromane: 1929 „La femme 100 têtes“, in dem er gänzlich auf Narratives verzichtet und der gebrochen, zufällig scheint, 1930 der „Rêve d’une petite fille qui voulut entrer au Carmel“, dessen Bildunterschriften wenigstens eine ungefähre Handlung erahnen lassen, und 1934 „Une Semaine de bonté“. In diesem letzten und längsten Roman aus 184 Collagen in fünf Heften mit je sieben Kapiteln[52] fehlen narrative Bildunterschriften. Die einzelnen Bildtafeln der Kapitel sind durch ein gemeinsames Element geeint, das der Kapiteltitel diktiert. So findet sich etwa im dritten Heft, „La cour du dragon“, in jeder Collage an mehr oder minder prominenter Stelle ein amphibisches oder reptilienartiges Untier: der titelgebende „dragon“.
Das vierte Heft widmet Ernst dem Ödipus-Mythos, den Sigmund Freud 1923 der antiken Literatur entreißt und als Ödipuskomplex in die Psychoanalyse einführt.[53] Mittlerweile stark umstritten, dürften die von Freud heraufbeschworenen inzestuösen Konflikte zwischen Vater, Mutter und Sohn dank ihrer großen populärwissenschaftlichen Beliebtheit hinlänglich bekannt sein. Beispielhaft wird hier eine der Bildtafeln vorgestellt:
Vor einem undefinierbaren, stark schraffierten Hintergrund steht zentral ein Mischwesen mit Männerkörper und Vogelkopf in aufgebrachter Pose, samt Ausfallschritt und geballten Fäusten. In seiner rechten Hand führt er einen groben Dolch, mit dem er den Fuß des Frauenaktes durchstößt, der in irrealer Diagonale vor ihm schwebt und das Gesicht vom Betrachter abwendet. Der starr blickende Raubvogelkopf der bedrohlichen Chimäre wird im Profil gezeigt, zu ihren Füßen findet sich ein Nest mit einem einzelnen Ei. Ernst paraphrasiert hier die Ödipus-Thematik, indem er ihre zentralen Themen – Sex, Gewalt, Familie – in einer isolierten Gruppe und ohne offensichtlichen narrativen Bezug zur ursprünglichen Sage darstellt. Im Kontext der vorangegangenen Collagen müssen wir den eigentümlichen Vogelmenschen mit Ödipus gleichsetzen, dessen Mordlust sich im Original aber nie gegen eine Frau, nur gegen den Vater richtet. Der penetrierende Dolchstoß durch den Frauenfuß gewinnt so eindeutig sexuelle Konnotation. Sie wird durch die bloße Symbolkraft des Vogels noch verdeutlicht, der in der Traumdeutung nach Freud Träger sexueller Wunschphantasien ist.[54] Bereits in „La femme 100 têtes“ werden Vögel in den Dienst sexueller und sadistischer Triebe gestellt.[55] Ernst ist dabei keineswegs der erste Künstler, der sich die etwas geistlose, aber künstlerisch fruchtbare Parallele zum umgangssprachlichen „vögeln“ zu Nutzen macht. Bereits der überaus kontroverse geisteskranke Schweizer Künstler, Komponist und Schriftsteller Adolf Wölfli bedient sich ihrer in Form der in seinem Werk omnipräsenten „Vögeli“.[56] Wie den meisten seiner Stilkollegen dürften auch dem psychiatrisch interessierten Max Ernst solche Auswüchse der Art Brut bekannt gewesen sein, die so überaus fruchtbringend für den psychologisierenden Surrealismus dieser Zeit ist.
Das Nest samt Ei fügt der brutalen Sexualität der Collage den familiären Aspekt der Legende hinzu, symbolisiert Nachwuchs und mütterliches Brüten. In Verbindung mit dem adlerköpfigen Ödipus und einer nackten Frau erinnert es aber unweigerlich auch an den Ernstschen Geburtsmythos - verbirgt sich in dem Ei der Künstler, den der Adler noch ausbrüten muss? Die Assoziationsketten, die dieses einzelne Blatt auslöst, dürfte Ernst bewusst initiiert haben. Durch seine Schriften und Aussagen lenkt er die Aufmerksamkeit auf Begebenheiten seiner Kindheit (ob phantastisch oder real sei dahingestellt) und drängt den Betrachter mit dem Freudschen Titel des Kapitels noch willkürlicher dazu, die Collage ganz im Sinne der Psychoanalyse zu interpretieren.[57] Wie sein langjähriger Freund Werner Spies, den er später beauftragt, sein Werkverzeichnis zu verwalten, folgerichtig anmerkt, geht Ernst in seinen Werken von einer genauen Kenntnis Freuds beim Betrachter aus.[58] Er behindert so objektive Interpretationen in andere Richtungen und negiert konventionelle Künstler-Werk-Publikum-Beziehungen, in denen der Betrachter das Werk relativ frei deuten kann. Wir müssen in seiner Biographie nicht nach möglichen Anhaltspunkten suchen, um die rätselhafte Bildwelt zu erklären. Ernst nötigt uns diese Hinweise förmlich auf, indem er sie in Schriften deutlich herausstellt. Es gelingt ihm wie wenigen anderen Künstlern, Interpretationen seines Oeuvres ganz in seinem Sinne zu lenken.
Die unmittelbare Identifikation Ernsts mit dem Vogel ist bereits zeitgenössischen Rezipienten bewusst. Der befreundete surrealistische Dichter Paul Éluard charakterisiert ihn schon 1926 als „le supérieur des oiseaux“[59], den Obersten der Vögel. In der bereits erwähnten Vogelkostümierung lässt Ernst sich auch privat portraitieren.[60] Indem er sich seinen Zeitgenossen im vierten Band der „Semaine de bonté“, die 1934 in Paris veröffentlich wird,[61] als vogelköpfigen Ödipus präsentiert, auf dessen fatalen Sexualtrieb die Tiergestalt zusätzlich hinweist, entrückt er sich selbst der verhassten, regulierten Welt der menschlichen Normen und präsentiert sich näher an einer triebhaften, „abnormen“ Welt von Tieren und Geisteskrankheit.
„(…) er sah aus wie ein Urgott: primitiv, großartig (…) Max, das ist allgemein bekannt, sah sich selbst als einen Vogel. ‚Loplop, Supérieur des Oiseaux‘. Ich sah eine eher schauerliche Kreatur.“ [62]
3.2. Loplop als Über-Ich
Loplop ist „eine Figur, die vom eigenen Ich in gewisser Weise abgespalten bleibt“.[63] Mit dieser treffenden Charakterisierung von Max Ernsts tierischer zweiter Persona eröffnet Werner Spies eine weitere, in Ernsts Werk vermutlich sogar prominentere Freudsche Dimension des Vogels als Identitätsfigur. Ernst, der sich als Surrealist offensichtlich stark an den Lehren der Psychoanalyse orientiert, zersplittert sein öffentliches Ich bewusst in zwei Teile: den Menschen Max Ernst, der die Kunstwerke handwerklich schafft, und Loplop, das ihn begleitende „Privatphantom, das an Max Ernst gekettet ist“[64] und die Kunstwerke inspiriert, dem menschlichen Teil quasi aufträgt. Allein in den Jahren 1929 bis 1932 entstehen 90 Loplop-Collagen, unter denen die Werkgruppe „Loplop présente“ die prägnanteste darstellt.
3.2.1. Loplop présente une fleur, 1930
[65] Das Hochformat ist in streng geometrische Formen aufgeteilt. Zentral stellt Ernst ein hochkantiges Rechteck in hellem Ocker, das von in porösem Schwarz gestalteten Schluchten durchzogen ist, die spitz auf die obere Mitte der Fläche zulaufen und sie beinahe wie gefaltetes Papier wirken lassen. Fluchtpunkt dieser dreidimensionalen Pfeilspitzen ist ein abstrakt typisierter Vogelkopf, der im Profil über dem Rechteck schwebt. Sein kreisrunder Kopf und der lange dünne Schnabel sind in strahlenden Grün- und Gelbtönen gehalten, der flammende Hahnenkamm in naturalistischem Rot. Hinter dem zentralen Rechteck verschwindet ein zweites, kleineres, das ähnliche Schluchtenfalten in hellen Sandfarben zeigt und als Flügel des Vogels gedeutet werden kann. Die „Füße“ des Loplop bilden zwei gefaltete rosa Zettel. Auf dem Steinboden vor ihnen eine schmale gelbe Form, die, wie ihr Schatten anzeigt, ebenfalls aufrecht steht. Den unteren rechten Teil der anthropomorphen Figur überschneidet ein Viereck aus einem sich immer wiederholenden und mehrfach gedrehten Geflecht aus Blüten, Blättern und Meisen. Links darüber präsentiert Loplop das titelgebende Bild einer tropischen Blume. Sie wird uns mittig in einer hell- und dunkelblau geteilten Fläche dargeboten und erinnert in ihren zarten Weiß- und Rosatönen an eine Südseemuschel, wird in einem Alternativtitel der Collage dementsprechend auch als „fleur coquillage“ bezeichnet. Ernst behält die zusammengestückelte Wirkung einer Collage in diesem Blatt deutlich offensichtlicher bei als in seinen Bildromanen. Durch den deutlichen Schattenwurf ihrer einzelnen Teile könnte man sich die Figur auch als papierne Loplop-Skulptur vorstellen. Dies verstärkt ihren anthropomorphen Effekt zusätzlich.
Ernst selbst schreibt in einer Notiz 1936:
„(Ich) werde fast täglich vom Obersten Vogel Loplop – meinem Privat-Phantom – heimgesucht. Er schenkt mir ein Herz in einem Käfig, zwei Blütenblätter, drei Blätter, eine Blume und ein junges Mädchen.“[66]
Tatsächlich entnimmt Ernst die in dieser Werkserie von Loplop präsentierten Bildfetzen motivisch und technisch seinem bisherigen Opus.[67] Er macht die Reihe dementsprechend zu einem „Musterkatalog seines Schaffens“[68], in dem er die unüberschaubare Fülle der in seinen Collagen verarbeiteten Zitate und Bruchstücke zu ordnen versucht. Loplop schenkt ihm nicht nur die Inspiration zu seinen Werken, er hilft dem Menschen Max Ernst auch, sich nicht im verwirrenden Dickicht des eigenen Oeuvres zu verlieren. Ernst überträgt Loplop die Verantwortung für die unzähligen Bildschnipsel und –ausschnitte, die er mühsam zusammensucht, um sie zu eigenen Werken zusammenzufügen. Spätere Blätter der Serie[69] verlieren zunehmend den Status autonomer Kunstwerke. Bloße Teile des Ernstschen Formen- und Zitatekanons werden in übergeordneten Gruppen zusammengefasst: Loplop, dessen Omnipräsenz durch Abdrücke seiner Hand angezeigt wird[70], scheint diese für den Künstler zu sichten. Werner Spies zieht aus dieser Funktion des Loplop als „Autorität, die darüber befindet, was in die Collagen eingehen kann“[71] einleuchtend eine Parallele zu Freuds Strukturmodell der Psyche, in dem das triebhafte, körperliche „Es“ (in diesem Falle der unsystematisch sammelnde Ernst) durch eine Kontrollinstanz, das „Über-Ich“, reguliert werden muss. Wie der präsentierende Loplop, muss dieses „Über-Ich“ Ordnung in die instinktgesteuerte Welt des „Es“ bringen.[72] Es entspricht der ironischen Zivilisationsfeindschaft Max Ernsts, der sich „Augenlust, Fleischeslust und Hoffart“ hingeben will, dass er dieses „Über-Ich“, das in den Lehren Freuds der kulturelle Faktor ist, der den Menschen vom Tier unterscheidet, in der Gestalt eines Vogels manifestiert.
Indem er den Loplop als eigentlich für seine Kunst Verantwortlichen etabliert, tritt Ernst selbst als künstlerischer Akteur hinter ihm zurück und „wird damit zum ausführenden Medium, zum Erfüllungsgehilfen seines eigenen Kunstwerks“.[73] Im Zuge surrealistischer Ideen von automatischer Kunst negiert er so die traditionelle Heldenverehrung des Künstlers als Schöpfer und stellt sich als bloßes Ausführungsmittel einer übergeordneten gestalterischen Kraft (personifiziert durch den Loplop) dar. Passend dazu berichtet er von sich selbst meist in der dritten Person[74], distanziert sich somit vom eigenen Leben und Schaffen, ganz so, als würde das „Es“ bloß die Handlungen des „Über-Ich“ beobachten. Der unterbewusste Automatismus, den Ernst seiner Kunst zuspricht, ist allerdings mehr als fraglich. So berichtet er zwar immer wieder, dass sich ihm die oft kryptischen Titel seiner Werke förmlich aufdrängen[75] und stellt die Entwicklung neuer Techniken wie der Frottage in kleinen Anekdoten bevorzugt als glückliche Zufälle dar, in denen sein Unterbewusstsein ihm diese neuen Wege quasi von sich aus offenbart.[76] Solchen surrealistischen Methoden von unterbewusstem „kalkulierten Zufall“[77] widersprechen jedoch die tendenziösen Bildinhalte, mit denen Ernst uns die Interpretation förmlich oktroyiert (s. „Oedipe“) oder die peinliche Akribie, mit der er in seinen Collagen die einzelnen Bildkanten verwischt, um einen homogenen Bildeindruck zu schaffen, der sich eklatant von den tatsächlich zufälligen Collagen des kubistischen „papier collé“ unterscheidet.[78]
3.2.2. Le surréalisme et la peinture, 1942
[79] Seinen deutlichsten Ausdruck findet das Zurücktreten der Person Max Ernst als Künstler hinter den schöpferischen Loplop im großformatigen Gemälde „Der Surrealismus und die Malerei“ von 1942. Vor einer undefinierten Landschaft, die in ihrer Leere und Weite an die albtraumhaften Einöden Dalís erinnert, steht auf einer mit eigentümlichem Werkzeug gefüllten Kiste ein amorphes Wesen. Aus seinem organisch geformten Plasma wachsen drei ineinander verschlungene Vogelköpfe. Die transluzente Farbigkeit des gallertartigen Körpers lässt unvermittelt Assoziationen zu Eingeweiden, Schwellkörpern oder Venenwänden zu. Analog zur organischen Unbestimmtheit eines Amöbenkörpers entwächst ihm auf der rechten Seite ein lang geschwungener Arm, dessen menschliche Hand einen filigranen Pinsel hält. Er malt feine schwarze Linien auf eine Leinwand, die als kaleidoskopischer Kosmos verschwimmender Farbfetzen gestaltet ist. Ernst zitiert hier eindeutig das kurz zuvor entstandene „La planète affolée“.[80]
Er lässt uns am Entstehen dieses „verwirrten Planeten“ teilhaben, tritt selbst aber auch nur als Beobachter auf. Es ist sein Unterbewusstes, das „Privat-Phantom“ Vogel (in dessen drei Köpfen wir vielleicht sogar seine drei Manifestationen Hornebom, Loplop und Schnabelmax erkennen sollen), das hier das Kunstwerk schafft. Ernst verklärt so den surrealistischen Arbeitsprozess, auf den er im Titel hinweist, zum puren Ausdruck des Unterbewusstseins, das von dem realen Max Ernst abgespalten bleibt und setzt seinem tierischen Alter Ego so ein Denkmal. Oder setzt Loplop sich dieses Denkmal am Ende nicht selbst?
Auf diese Verwirrung legt Ernst es mit der Aufspaltung seines Ichs, dem Schreiben in der dritten Person, der künstlerischen Überhöhung des Loplop-Motivs zum autonom handelnden Wesen an. Sie macht den realen Künstler Max Ernst immer ungreifbarer. Er wird zu einer diaphanen, schwerlich zu beschreibenden Gestalt. So macht die Realität Platz für einen von ihm erfundenen Künstlermythos, der seine wahre Person verschleiert.
3.3. Alter Ego und Künstlerego
Neben diesen psychoanalytischen Erklärungsversuchen seiner Bindung an ein Tiertotem[81] dürfen wir nicht vergessen, dass ihre Grundlage die umfassende „Selbstdarstellung des Künstlers“[82] ist, die Max Ernst ganz gezielt vorantreibt. Mag er die Annäherung an den Vogel in seinen Märchen der eigenen Geburt und der spirituellen Verschränkung von Hornebom und seiner Schwester auch als schicksalshafte Notwendigkeit darstellen, so scheint sie doch eher bewusst gewählt. Schon Zeitgenossen sprechen der Physiognomie Max Ernsts deutliche Ähnlichkeiten zu einem Raubvogel zu.[83] Als er den Adler in seinen Jugenderinnerungen zum Vater macht, in dessen Nest die Mutter einer Leda gleich das „Max-Ei“ gelegt hat, dürfte dies durchaus Koketterie mit seiner Adlernase geschuldet sein. Es wird den akademisch gebildeten Ernst entzückt haben, gerade einem Vogel ähnlich zu sein, den bereits C. G. Jung in seinen Ausführungen zur Traumdeutung als Verkörperung der Seele - des Unbewussten - thematisiert[84] und der so zum perfekten Mittel eines selbst erdachten Künstlermythos wird. Auch die Rolle des Adlers bei seiner Wiedergeburt nach dem Krieg[85] führt unweigerlich auf mythologische Verknüpfungen von Vogel und Wiederauferstehung, wie den altägyptischen Phönix, zurück.
Einen weiteren Anstoß zur Wahl einer Vogelidentität dürfte dem selbstbewussten Max Ernst die Parallele zum Großmeister und Universalgenie Leonardo da Vinci gegeben haben, mit dessen Kindheitserinnerungen an einen Geier sich Freud bereits 1910 beschäftigt.[86] Der befreundete André Breton bezeichnet Leonardos Geier 1942 in einem Ernst gewidmeten Text als „Loplop im fünfzehnten Jahrhundert“.[87] Auch Werktitel aus Ernsts Dada-Zeit in den frühen zwanziger Jahren legen den Schluss nahe, dass der Brühler Künstler, von sich selbst als „born artist“[88] überzeugt, es auf eine geistige Verwandtschaft mit Leonardo anlegt. So erschafft er in Anspielung auf dessen Meisterwerk der „Heiligen Anna Selbdritt“, mit dem sich Freuds Leonardo-Analyse beschäftigt, eine „Anatomie Selbdritt“.[89]
Dass Ernst eine Identifikation mit großen Namen der Vergangenheit nicht scheut, beweist auch seine „Maximiliana“ aus den sechziger Jahren, in der er sich mit dem Leben des genialen Astronomen Wilhelm Leberecht Tempel auseinandersetzt, das für ihn zur „stellvertretenden Biografie“[90] wird. Die Selbstverständlichkeit, mit der er im Untertitel seiner „Biographischen Notizen“ – „Wahrheitsgewebe, Lügengewebe“ – den Titel von Johann Wolfgang von Goethes Autobiographie „Dichtung und Wahrheit“ paraphrasiert[91], ist ein weiterer Hinweis.
Ob man Max Ernst realitätsferne Hybris unterstellen möchte oder in all diesen Zitaten nur einen weiteren Weg sieht, das kunsthistorische Establishment zu verspotten, sei dahingestellt. Mit Hornebom, Loplop und Schnabelmax hat er ein vielschichtiges Alter Ego kreiert, das sein Oeuvre bis heute durchfliegt und belebt.
[...]
[1] S. Abb. 9.
[2] S. Abb. 10.
[3] Meißner, 1989, S. 147.
[4] S. Meißner, 1989, S. 140f.
[5] Karin von Maur, Von der Weltanschauung zur Weltdurchschauung, in: Holst 2000, S. 207.
[6] Maur 2000, S. 214.
[7] Zitiert nach Kandinsky, Holst 2000, S. 38.
[8] Kandinsky und Marc 1979, S. 327.
[9] Vgl. Fuhlbrügge 2011, S. 106f.
[10] S. Abb. 11.
[11] Johannes Janssen, Deine glückseligen, blauen Pferde, in: Klingsöhr-Leroy, Firmenich 2011, S. 146.
[12] Ebd.
[13] S. Abb. 12.
[14] Zitiert nach Paul Klee, Holst 2000, S. 33.
[15] Vgl. Franz 2011, S. 55ff.
[16] S. Abb. 13.
[17] S. Abb. 14.
[18] Holst 2000, S. 92.
[19] S. Abb. 15.
[20] Vgl. Janssen 2011, S. 144.
[21] Meißner 1989, S. 54.
[22] S. Holst 2000, S. 187.
[23] Zitiert nach Lasker-Schüler, Holst 2000, S. 38.
[24] Zitiert nach Kandinsky, Holst 2000, S. 31.
[25] Zitiert nach Bloch, Holst 2000, S. 32.
[26] Maur 2000, S. 210.
[27] Zitiert nach Däubler, Holst 2000, S. 237.
[28] Kandinsky und Marc 1979, S. 327.
[29] Eduard Trier, Schriften zu Max Ernst, Köln 1993, S. 49.
[30] Ebd.
[31] Julia Drost, Biographische Notizen, in: Max Ernst. Leben und Werk, hrsg. von Werner Spies, Köln 2005, S. 24.
[32] Ebd.
[33] Drost 2005, S. 22.
[34] Werner Spies, Max Ernst. Graphik und Bücher, Sammlung Lufthansa, Stuttgart 1991, S. 12.
[35] Vgl. Spies 2005, S. 13.
[36] Spies 1991, S. 10.
[37] S. z.B. Ernsts Anthologie „Lewis Carroll’s Wunderhorn“ von 1970.
[38] S. Sigmund Freud, Das Unheimliche. Aufsätze zur Literatur, Frankfurt a. M. 1963.
[39] Spies 1991, S. 14.
[40] Vgl. Spies 1991, S. 18.
[41] Spies 2005, S. 8.
[42] Rainer Zuch, Max Ernst, der König der Vögel und die mythischen Tiere des Surrealismus, 2004, S.3.
[43] Trier 1993, S. 54.
[44] Trier 1993, S. 10.
[45] Spies 2005, S. 17.
[46] Zuch 2004, S. 3.
[47] Ebd.
[48] Spies 1991, S. 13.
[49] Ebd.
[50] Spies 1991, S. 9.
[51] S. Abb. 16.
[52] Vgl. Julia Drost und Hanna Holtz, Gedruckte Träume, in: Druckgraphik, hrsg. von Markus A. Castor et al., Berlin 2010, S. 163.
[53] S. Sigmund Freud, Das Ich und das Es, Leipzig 1923.
[54] Zuch 2004, S. 5.
[55] Ebd.
[56] S. Theodor Spoerri, Die Bilderwelt Adolf Wölflis, Basel 1963.
[57] Vgl. Zuch 2004, S. 2.
[58] Spies 1991, S. 25.
[59] Zuch 2004, S. 3.
[60] S. Abb. 17.
[61] Drost und Holtz 2010, S. 165.
[62] Zt. nach Julien Lévy, Spies 2005, S. 110.
[63] Werner Spies, Max Ernst. Loplop, Köln 1998, S. 109.
[64] Zt. nach Max Ernst, Spies 1998, S. 9.
[65] S. Abb. 18.
[66] Zuch 2004, S. 4.
[67] Ebd.
[68] Spies 1998, S. 22.
[69] S. Abb. 19.
[70] Vgl. Spies 1998, S. 33 ff.
[71] Spies 1998, S. 109.
[72] Vgl. Freud 1923.
[73] Drost 2005, S. 27.
[74] Spies 1998, S. 107.
[75] Vgl. Spies 2005, S.8.
[76] Drost 2005, S. 28 f.
[77] Ebd.
[78] Vgl. Spies 1991, S. 17 ff.
[79] S. Abb. 20.
[80] S. Abb. 21.
[81] Die Motive des Adlers als „Geburtshelfer“ und als späteren Berater nach seiner Wiedergeburt, als die er das Ende des Ersten Weltkriegs bezeichnet, sind deutliche Parallelen zu dem Totemkult animistischer Völker, wie sie Freud 1913 in „Totem und Tabu“ beschreibt, s. Sigmund Freud, Totem und Tabu, in: Gesammelte Werke, Band 9, hrsg. von Anna Freud et al., London 1940.
[82] Drost 2005, S. 18.
[83] Zuch 2004, S. 3.
[84] Ebd., S. 6.
[85] Vgl. Trier 1993, S. 56.
[86] S. Sigmund Freud, Eine Kindheitserinnerung des Leonardo da Vinci, Frankfurt a. M. 1995.
[87] Spies 1998, S. 143.
[88] Drost 2005, S. 20.
[89] Spies 1998, S. 143.
[90] Spies 2005, S. 15.
[91] Drost 2005, S. 21.
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Erstausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2012
- ISBN (Paperback)
- 9783955492205
- ISBN (PDF)
- 9783955497200
- Dateigröße
- 7.1 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf
- Erscheinungsdatum
- 2015 (Februar)
- Note
- 1
- Schlagworte
- Animismus Schamanismus Pantheismus Tierdarstellung Aktionskunst
- Produktsicherheit
- BACHELOR + MASTER Publishing