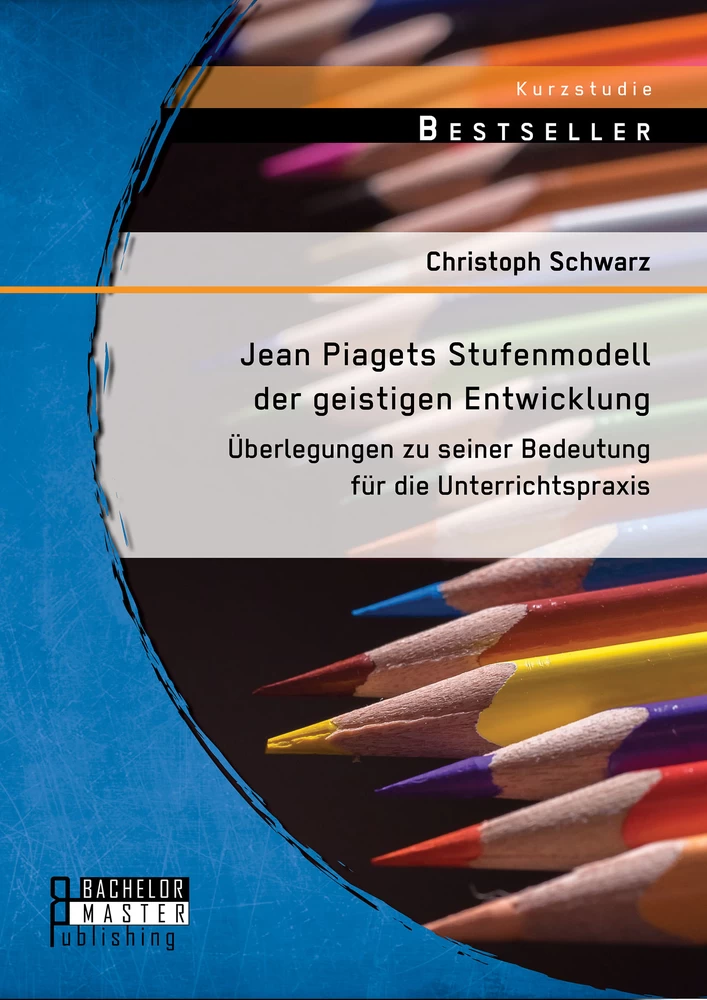Jean Piagets Stufenmodell der geistigen Entwicklung: Überlegungen zu seiner Bedeutung für die Unterrichtspraxis
©2001
Studienarbeit
31 Seiten
Zusammenfassung
Jean Piaget wird meist als Entwicklungspsychologe bezeichnet. Tatsächlich war er jedoch einer der letzten „Universalgelehrten“, der – neuartig für seine Zeit – versuchte mittels naturwissenschaftlicher Methoden Fragestellungen aus dem Bereich der Philosophie zu lösen. Aus diesem Ansatz resultierten interdisziplinär neue Impulse für Pädagogen, Philosophen, Biologen und Mathematiker. Die vorliegende Studie diskutiert die Konsequenzen aus Piagets Theorie der geistigen Entwicklung des Kindes für die pädagogische Praxis. Insbesondere wird dabei auf die konkretoperationale sowie die formaloperationale Stufe seines Modells eingegangen und diese in Bezug auf die Unterrichtsplanung an der Schule betrachtet.
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
5
,,Erkennen heißt, Realität zu transformieren, um zu verstehen, wie ein bestimmter Zustand zustande kommt."
(Piaget, 1973a, S.22)
Das heißt, Erkenntnis kann nicht losgelöst betrachtet werden von den Erkenntnisstrukturen des
Subjekts, mit denen es versucht, die Welt für sich zu ordnen und aus ihr Sinn zu machen (vgl.
Oser, S. 41, Buggle, S. 16). Hier werden nun die Parallelen zur Erkenntnistheorie Kants deutlich,
der Piaget in philosophischer Hinsicht stark beeinflusste.
4
Menschliche Erkenntnis stellt für Piaget ,,das Ergebnis eines langen phylogenetisch-
stammesgeschichtlichen wie ontogenetisch-individuellen biologisch-psychologischen
Entwicklungsprozesses dar." (Buggle, S.17, vgl. auch Vollmers, 1995, S.165; Vollmers, 1997,
S.74).
5
Die Genese menschlichen Erkennens war für Piaget am besten am Kind und am
Jugendlichen beobachtbar, weswegen er sich der Kinder- und Jugendpsychologie als einer
,,Brücke zwischen biologischen und psychologischen Faktoren" (Buggle, S.18) zuwandte. Zur
Untersuchung der Denkwege, auf denen Kinder bei bestimmten Problemstellungen zu ihren
Ergebnissen kamen (seien diese richtig oder falsch) entwickelte er seine Methode des klinischen
Gesprächs (vgl. Vollmers, 1997, S.76; Vollmers, 1995, S.158). Diese Methode modifizierte er
jedoch bald, indem er sie mehr auf die Beobachtung des Verhaltens ausrichtete, da die
,,artikulierenden Fähigkeiten des Kindes oft deutlich hinter denjenigen zurückbleiben, die in
seinem Handeln zum Ausdruck kommen" (Scharlau, S.23).
6
Durch diese Methode offenbarten
sich Piaget strukturelle Gesetzmäßigkeiten der Genese von Erkenntnis, die im Folgenden
skizziert werden sollen.
4
Piaget hat sich selbst lange Zeit als Nachfolger Kants gesehen. Vollmers hingegen sieht starke Parallelen zum
Werk Hegels. Dass Piaget diese Ähnlichkeit lange Zeit nicht bemerkt hat dürfte laut Vollmers ,,seinen wesentlichen
Grund darin haben, dass er dessen schwer verständliche Arbeiten lange Zeit schlichtweg nicht aus eigener
Anschauung kannte" (Vollmers, 1995, S.139) Später seien ihm jedoch die Parallelen zu Hegel ,,endgültig
aufgegangen" (ebd., S.169).
5
Piaget setzt die Wissenschaftsgeschichte analog mit der Entwicklung der Erkenntnis des Individuums. Dies lässt
sich recht gut anhand des Zeitbegriffs darstellen: so glaube das Kind anfangs an eine ,,Eigenzeit" der Individuen und
Gegenstände und habe noch kein Konzept der ,,Gleichzeitigkeit" (vgl. Buggle, S.19). Mit der geistigen Entwicklung
dezentriert sich dieser Standpunkt jedoch, hin zur Vorstellung einer objektiven Zeit. Wissenschaftsgeschichtlich
betrachtet besteht deren Objektivität seit der Entwicklung von immer präziseren Instrumenten zu ihrer Messung, die
nicht nur individuell, sondern gesellschaftlich Gültigkeit haben. Doch selbst dieses Konzept von Zeit wird mit
Einsteins Relativitätstheorie die für Piaget den vorläufigen Höhepunkt der Dezentrierung auf einer
wissenschaftlichen Ebene darstellt dezentriert und relativiert. Die Entwicklung von Erkenntnis erfolgt für Piaget in
einem Entwicklungskontinuum, was Entwicklungssprünge jedoch nicht ausschließt (vgl. Buggle, S. 24;
Ginsburg/Opper, S.207).
6
Bei der Entwicklung dieser Methode die er zuerst bei seinen eigenen drei Kindern anwandte kam ihm Methode
der minutiösen Beschreibung des Verhaltens, die er bei seiner zoologischen Ausbildung gelernt hatte, zugute
(Vollmers, 1995, S.158). An dieser Methode wurde viel Kritik geübt, wobei v.a. die mangelnde Standardisierung der
Experimentsituation bemängelt wurde (vgl. Kesselring, S.162; Buggle, S. 47; Scharlau, S.27 ). Dies zu verbessern
war ein Verdienst seiner langjährigen Mitarbeiterin Dr. Bärbel Inhelder, ,,deren eigenständige Leistung aufgrund der
Allgegenwart Piagets oft unterschätzt wird." (Aebli, S.78, vgl. auch Kesselring, S.192).
6
III. Piagets Theorie der Entwicklung
III.1. Aspekte der Entwicklung
Die Entwicklung der Erkenntnis wird laut Piaget zum einen von Faktoren der biologischen
Reifung (z.B. des Nervensystems) beeinflusst, zum anderen durch Erfahrung
7
.
Piaget unterscheidet hinsichtlich des Entwicklungskontinuums zwischen Funktionen, Strukturen
und Inhalten. Die Funktionen bleiben während der Entwicklung stets die selben, während die
Strukturen sich in ständigem Wandel befinden. Dennoch sind auch sie als ,,artspezifisch eher
konstant" (Buggle, S.27) zu verstehen, d.h. bis zu einem gewissen Grad bei allen Individuen sehr
ähnlich im Gegensatz zu den Inhalten, die am variabelsten, da weitgehend kulturell bestimmt
sind. Da sich aufgrund dieser Unterschiedlichkeit keine allgemein gültigen Inhalte i.S. Piagets
formulieren lassen, soll hier auf diesen Aspekt nicht genauer eingegangen werden. Für die
Skizzierung Piagets Stufenmodells ist es jedoch notwendig, die Begriffe der Funktion und der
Struktur zu klären, was im Folgenden geschehen soll.
III.1.1. Strukturen
Der von Piaget zur Kennzeichnung von Strukturen am meisten benutzte Begriff ist der des
Schemas:
,,Ein Schema ist die Struktur oder Organisation der Aktionen, so wie sie sich bei der Wiederholung dieser
Aktion unter ähnlichen oder analogen Umständen übertragen oder verallgemeinern." (Inhelder/Piaget, S.19)
Die Aktion bzw. Handlung stellt für Piaget bekanntermaßen den Ursprung der Erkenntnis dar.
Verhaltensschemata ergeben sich aus der sinnvollen Strukturierung einzelner Aktionen. Bei der
Beschreibung des Stufenmodells wird zu sehen sein, wie sich zunächst sehr rudimentäre und
beobachtbare Verhaltensschemata
8
mit zunehmender Verinnerlichung zu abstrakten kognitiven
Schemata bzw. Denkschemata entwickeln. Damit einher geht ein Prozess der Ausdifferenzierung
7
Unter Erfahrung versteht Piaget zum einen soziale Erfahrungen, und zum anderen solche, die weitgehend natürlich
bestimmt sind (etwa physikalischer Art, z.B. dass Gegenstände herunterfallen können). Hinsichtlich letzterer
differenziert er wiederum zwischen physischer Erfahrung, ,,die darin besteht, auf die Gegenstände einzuwirken und
ihre Eigenschaften abzuleiten" und logisch-mathematischer Erfahrung, ,,die darin besteht, auf die Gegenstände
einzuwirken, aber um das Ergebnis der Koordinierung der Aktionen kennenzulernen" (Inhelder/Piaget, S.153). Die
Faktoren Erfahrung und Reifung unterliegen wiederum Einflüssen von Erbgut, physischem Milieu, sozialem Milieu
und der Möglichkeit der Herstellung eines Gleichgewichts (vgl. Piaget, 1999, S.231), worauf unter III.1.2.1. genauer
eingegangen wird.
8
Zur Veranschaulichung kann hier das Greifschema dienen. Laut Buggle ist es eines der ,,für die kognitive
Entwicklung an ihrer Basis wichtigsten Schemata (vgl. ,Begreifen' als schon sprachlich deutlich fundamentalen
kognitiven Begriff)". Es stellt eine Handlungssequenz dar, deren einzelne ,,Handlungssegmente Ausstrecken des
Armes, Ausstrecken der Finger, Berühren und Umklammern des zu Greifenden Gegenstandes, Heranziehen des
Armes in festliegender Abfolge angeordnet sind. Eine Veränderung der notwendigen Abfolge würde Funktion und
konstituierende Struktur der Greifhandlung paralysieren." (Buggle, S. 31)
7
der Schemata, der schon in den frühen Lebensmonaten setzt einsetzt, ,,wobei sich anfänglich
getrennte Verhaltensbereiche (Sehen, Hören, Greifen, Saugen) zu extrem feinmaschigen
Verhaltensschemata hoher Organisationsstufe verbinden" (Vollmers, 1995, S.151).
Piaget beschreibt die kognitive Entwicklung als einen ,,Übergang von den kaum im
Gleichgewicht befindlichen oder instabilen Strukturen (senso-motorische oder perzeptive) zu den
höheren, äquilibrierten Formen (logische Operationen)" (Piaget, 1999, S.235). Auf die Funktion
der Äquilibration soll im Folgenden eingegangen werden.
III.1.2. Funktionen
III.1.2.1. Äquilibration
Piagets Theorie baut auf der Grundannahme auf, dass jeder Organismus nicht nur nach einem
immer wieder herzustellenden Gleichgewicht sucht, sondern ständig bestrebt ist, eine höhere d.h.
stabilere Form des Gleichgewichts zu finden (ebd., S.153, Buggle, S.49). Die Äquilibration stellt
damit eine übergeordnete Funktion dar (vgl. Vollmers, 1995, S. 151). Dieser Ausgleichsprozess
ist nicht zu verstehen
,,im Sinne eines bloßen Gleichgewichtes der Kräfte wie der Mechanik, oder einer Zunahme der Entropie wie
in der Thermodynamik, sondern in dem Sinne, wie er heute dank der Kybernetik bekannt ist, einer
Selbstregulierung, das heißt einer Folge von aktiven Kompensationen des Subjekts als Antwort auf die
äußeren Störungen und einer gleichzeitig rückwirkenden [...] und vorausgreifenden Regulierung, die ein
permanentes System solcher Kompensationen darstellt." (Inhelder/Piaget, S.155)
Jedes Handeln und jede Aktivität ist laut Piaget auf allen Entwicklungsstufen des Individuums
stets durch ein Ungleichgewicht in Form eines Bedürfnisses bzw. Interesses motiviert, ,,ob es
sich nun um ein physiologisches, affektives oder intellektuelles Bedürfnis handelt; auf allen
Niveaus versucht die Vernunft zu verstehen oder zu erklären usw." (Piaget, 1999, S.154, vgl.
auch S.155). Die Interessen selbst unterscheiden sich von Stufe zu Stufe jedoch beträchtlich. Das
Bedürfnis nach einer neuen Erklärung ist z.B. abhängig vom Bewusstsein darüber, in welchen
Punkten die eigenen Erklärungen in Widerspruch zu einander geraten. Der Übergang von einer
Entwicklungsstufe zur nächsten erfolgt in einem Prozess krisenhafter Umstrukturierung der
herkömmlichen Denkstrukturen, die nun nicht mehr zur Erklärung oder Lösung eines Problems
ausreichen.
Kognitives Gleichgewicht zeichnet sich dabei nicht etwa durch einen stabilen Ruhezustand aus,
vielmehr entspricht dem Maximum an Gleichgewicht ein Maximum an Aktivität des
Individuums (vgl. ebd., S.230), d.h. Gleichgewicht ist ,,stets mobil [...] (was seine eventuelle
Stabilität nicht im mindesten ausschließt)" (ebd., S.237). Diese äquilibrierende Aktivität äußert
8
sich in den Unterfunktionen der Adaption und der Organisation, wobei erstere sich auf das
Gleichgewicht der Interaktion von Innen und Außen, letztere sich auf die Gleichgewicht im
Innern des Körpers bezieht (vgl. Vollmers, 1995, S.152).
III.1.2.2. Adaption: Assimilation und Akkomodation
Die Adaption kann unter zwei Aspekten gefasst werden, sie ,,ist immer sowohl Anpassung (und
damit Umgestaltung) der Umwelt an den Organismus als auch Anpassung des Organismus und
seiner Strukturen an die Umweltgegebenheiten" (Buggle, S.25). Der erste der beiden Aspekte
wird von Piaget als Assimilation, der zweite als Akkomodation
9
bezeichnet. Wird von einem
Kind ein Schema (z.B. das Greifschema) auf einen zuvor noch unbekannten Gegenstand (z.B.
eine Schnur) angewendet, so sind beide Modi wirksam: zum einen wird der neue Gegenstand
dem Schema assimiliert, d.h. ,,in eine bereits bestehende Struktur integriert" (Inhelder/Piaget,
S.16), zum anderen wird das existierende Schema an den Gegenstand akkomodiert, d.h. ,,bei der
Handhabung eines neuen Gegenstandes an die Eigentümlichkeiten des Gegenstandes angepasst"
(Vollmers, 1995, S.153). Die Adaption wird wiederum optimal realisiert in einem zunehmenden
Gleichgewicht zwischen Assimilation und Akkomodation (vgl. Piaget, 1999, S.157, Buggle, S.
37). Auf niedrigeren Entwicklungsstufen konstatiert Piaget jedoch generell ein Überwiegen der
Assimilation. Ferner überwiegt nach dem Erreichen einer neuen Entwicklungsstufe zunächst
immer die egozentrische Assimilation an die neu konstruierten Schemata, und erst ,,nach einer
solchen Assimilation der Objekte sind Handeln und Denken genötigt, sich an diese zu
akkomodieren" (Piaget, 1999, S.157, vgl. auch S.130, S.205).
III.1.2.3. Organisation
Mit dem Begriff der Organisation wird die Koordination und Verflechtung der Schemata
untereinander bezeichnet, so z.B. von Sehschemata und dem eben erwähnten Greifschema (vgl.
Inhelder/Piaget, S.20). Dadurch wird das Gleichgewicht im Innern des Organismus erhalten,
welches die Adaption ermöglicht und begleitet (vgl. Vollmers, 1995, S.152; Buggle, S.26).
9
Die Begriffe der Assimilation, Akkomodation und Äquilibration übernimmt Piaget aus der Biologie (vgl.
Inhelder/Piaget, S.16), wo sie eigentlich somatische Vorgänge bezeichnen: z.B. wird durch die Aufnahme von
Nahrung diese dem Körper assimiliert, oder die Augenmuskeln akkomodieren, wenn sie einen Gegenstand fixieren.
Ursprünglich haben diese also ,,eine sehr anschauliche konkret-materielle Bedeutung. Es sind Begriffe, die
unmittelbar beobachtbare materielle Veränderungen im Organismus bezeichnen [...]. Bei Piaget bekommen sie einen
abstrakten Sinn. Sie bezeichnen etwas nicht unmittelbar Beobachtbares" (Vollmers, 1995, S.152, vgl. auch Buggle,
S. 30), nämlich menschliche Erkenntnisleistungen.
9
Bei der folgenden Beschreibung des Stufenmodells wird zu sehen sein, wie diese Koordination
der kognitiven Schemata untereinander auf der höchsten Stufe in der Organisation eines
logischen Systems der Strukturen ihren Höhepunkt findet, das eine ungleich höhere
Äquilibration gewährleistet, indem es nicht nur die Widersprüche der eigenen Erklärungen
wahrnimmt wird und teilweise überwindet, sondern laut Piaget auch die eigenen Affekte des
Individuums in ein Gleichgewicht bringt.
III.2. Das Stufenmodell der Entwicklung
Für Piaget stellt sich die kognitive Entwicklung als eine Abfolge von Stufen dar, die nicht nur als
willkürliche festgelegte Abstände auf dem Entwicklungskontinuum zu sehen sind, sondern
,,durch das Auftreten originaler Strukturen gekennzeichnet" (Piaget, 1999, S.155) sind, d.h.
durch empirisch nachweisbare qualitative Brüche. Beim Übergang von einer Stufe zur nächsten
erfährt das gesamte System von Denk- und Erklärungsschemata aufgrund der Konfrontation
mit Problemen, für deren Lösung das bisherige System nicht ausreicht eine qualitative
Umstrukturierung (vgl. ebd., S.154). Darüber hinaus sind die Stufen durch ihre invariante
Sequenz bestimmt jede Struktur einer Stufe stellt die Voraussetzung für die darauffolgende dar
(vgl. Ginsburg/Opper, S.206; Buggle, S.49). Grundsätzlich gilt dieses Stufenmodell laut Piaget
universell.
10
Wie schon in III.1.2.1. erwähnt, ist eine bessere Äquilibration durch eine höhere Mobilität
gekennzeichnet. Wie im folgenden zu sehen sein wird, findet diese bei den sich neu
entwickelnden Strukturen ihren Ausdruck in einer von Stufe zu Stufe zunehmenden
Dezentrierung des Denkens, welche die Koordination von zunehmend mehr Perspektiven und
Aspekten der Realität ermöglicht, sowie schließlich auf den operationalen Stufen durch die
Ausbildung der Reversibilität des Denkens (vgl. Ginsburg/Opper, S.200).
III.2.1. Die senso-motorische Stufe
In den ersten vier Lebensmonaten ist das geistige Leben des Neugeborenen zunächst weitgehend
durch Reflexe
11
und Instinktkoordination bestimmt, aus denen sich später die ersten senso-
10
Interessanterweise erreichen Gruppen von Menschen in bestimmten ländlichen Regionen nicht die letzte (die
formaloperationale) Stufe vermutlich, weil für die Lösung ihrer unmittelbaren Probleme nicht die Notwendigkeit
dazu besteht , doch die Abfolge der Stufen ihrer Entwicklung verläuft bis dahin analog der von Menschen in
städtischer bzw. industrieller Umgebung (vgl. Ginsburg/Opper, S.203). Gegen diese Annahme wurde oft der
Vorwurf des Ethnozentrismus erhoben (vgl. Kesselring, S.203).
11
Wie weiter oben schon erwähnt betont Piaget, dass ,,diese Reflexe, soweit sie Verhaltensweisen anlangen, die für
die weitere psychische Entwicklung eine Rolle spielen, nichts von jener mechanischen Passivität an sich haben, die
10
motorischen Schemata entwickeln (vgl. Buggle, S.51). Erst danach spricht Piaget von senso-
motorischer Intelligenz
12
. Diese ist ,,in ihrem Wesen auf das Praktische ausgerichtet, das heißt,
sie erstrebt Erfolge und will nicht Wahrheiten aussprechen" (Inhelder/Piaget, S.15, vgl. auch
Piaget, 1999, S.158). Das ursprüngliche Universum des Säuglings ist ganz auf den eigenen
Körper und das Handeln zentriert so ,,erklären" sich die Objekte für ihn aus dem Gebrauch,
den er von ihnen macht (vgl. Inhelder/Piaget, S.23).
13
Im Handeln selbst baut der Säugling bestimmte Kategorien auf, darunter die Vorstellung von
ihm unabhängig existierender Gegenstände
14
. Dies befähigt ihn gegen Ende der senso-
motorischen Stufe (im Laufe der ersten 18 Monate) eine Art ,,kopernikanische Wende" zu
vollziehen: der eigene Körper wird als ,,unter anderem existierend" in den äußeren Raum
eingeordnet. Mit dieser gewaltigen Dezentrierung gelingt es der senso-motorischen Intelligenz
,,den einsetzenden Verstand aus seiner radikalen Ich-Bezogenheit zu befreien und ihn in eine
,Welt' einzufügen, so praktisch und wenig ,überlegt' diese auch bleiben mag." (Piaget, 1999,
S.163, vgl. auch ebd., S. 154; Inhelder/Piaget, S.23, S.33)
man ihnen zuzuschreiben versucht ist [von Seiten der behavioristischen Schule], sondern dass sie von Anfang an
eine echte Aktivität zeigen, welche die Existenz einer frühen Assimilation erweist." (Piaget, 1999, S.158) Am
Beginn der Ausbildung der senso-motorischen Schemata stehe ,,immer eine Reflexperiode, bei der jedoch die
Übung keine reine Wiederholung darstellt, sondern neue Elemente einverleibt und mit diesen, mittels allmählicher
Differenzierungen, umfassender organisierte Ganzheiten bildet." (ebd., S.159)
12
Intelligenz beschreiben Inhelder/Piaget als ,,die Anpassung par excellence, das Gleichgewicht zwischen einer
dauernden Assimilation [...] und der Akkomodation." (Inhelder/Piaget, S.39). Intelligenz hat ihren Ursprung nicht
allein in der Wahrnehmung, wie etwa die Gestalttherapie annimmt, vielmehr stellen die Aktionen, bzw. die ,,senso-
motorischen Strukturen] die Grundlage für die späteren Denkoperationen" dar (ebd., vgl. auch S. 20, 39, S.130, vgl.
Piaget, 1999, S.256).
13
Ein Gegenstand ist demnach für das Kind zuallererst durch das jeweilige Schema bestimmt, das es auf ihn
anwendet, d.h. zum Saugen, Horchen, Schauen etc. (vgl. Piaget, 1999, S.158/159). Es hat kein Konzept von ,,fest"
und ,,flüssig", sondern von ,,greifbar" und ,,schöpfbar" (vgl. Buggle, S. 31ff.; Kesselring, S.120). Damit wird
deutlich, was es bedeutet, dass dieser Stufe die Assimilation der Objekte an die Verhaltensschemata überwiegt, und
welche starke Begrenzung der senso-motorischen Intelligenz dies darstellt.
14
Inhelder und Piaget sprechen hier von den ,,großen Kategorien des Tuns" (Inhelder/Piaget, S. 23), die die senso-
motorische Intelligenz ,,eben durch ihr Funktionieren" (ebd.) konstruiert, nämlich die Schemata des permanenten
Gegenstandes, des Raumes, der Zeit und der Kausalität. Piaget betont, dass ,,natürlich alle vier praktische
Kategorien oder Kategorien reiner Aktion sind, und noch nicht Kategorien von Begriffen des Denkens." (Piaget,
1999, S.161) Diese Kategorien lassen sich wie folgt erläutern: Das Objektschema (Ding) ist ,,im Effekt der Glaube,
dass einer wahrgenommenen Gestalt ,irgend etwas' entspricht" (ebd., S.162). Dies ist bereits das ,,senso-motorische
Äquivalent der Erhaltungsbegriffe, die sich später auf der operationellen Stufe entwickeln" (Piaget, 1973a, S.53),
und die hier später beschrieben werden sollen. Hinsichtlich des Raumes bemerkt Piaget, für den Säugling existierten
zu Anfang ,,ebenso viele untereinander nicht koordinierte Räume wie sensorische Bereiche (oraler, visueller,
taktiler Raum usw.)" (Piaget, 1999, S.162). Das Schema des Raums entsteht durch die Konstruktion eines
allgemeinen Raumes, der alle anderen mit einbezieht (vgl. ebd.). Der Aufbau der Zeit verläuft ,,parallel zu dem des
Raums und komplementär zu jenem der Objekte und der Kausalität. [...] Der Zeitbegriff wird also an seinem
Ursprung noch mit den Eindrücken der psychologischen Dauer vermischt, die in den Attitüden der Erwartung, der
Anstrengung der Befragung, kurz, in der Aktivität des Subjekts liegen. Diese Dauer wird dann in immer engere
Beziehung mit den Ereignissen in der Umwelt gesetzt. An seinem Endpunkt ist der Zeitbegriff in den Rang einer
objektiven Struktur des Universums aufgestiegen." (Piaget, 1975, S.310) Mit der Kausalität wird die ,,für das
Individuum lange Zeit zufällige Zusammenhang zwischen einem empirischen Ergebnis und irgendeiner Aktion,
die dieses erbracht hat" (Piaget, 1999, S.162/163) bezeichnet, wobei die Ursachen zunehmend objektiviert und
auseinandergehalten werden, womit die Kausalität ihren ,,magischen" Charakter verliert.
11
Im Gegensatz zu späteren Entwicklungsstufen, in denen die kognitive Entwicklung sich nicht nur
im Umgang mit den Dingen selbst, sondern zu einem ganz wesentlichen Teil durch die
,,Manipulation verinnerlichter Repräsentationen (Vorstellungen, Begriffe, Worte usw.) der realen
Dinge und Relationen vollzieht" (Buggle, S.51), hat die senso-motorische Intelligenz noch keine
Sprache und keine Symbolfunktion ihre Konstruktionen stützen sich ausschließlich auf aktuelle
Wahrnehmungen und Bewegungen (vgl. Inhelder/Piaget, S.15/16).
15
Doch im Handeln selbst,
durch den Aufbau immer komplexerer Assimilationsschemata, entfaltet sich ,,eine Art Logik des
Tuns" (ebd., S.23), die den Ausgangspunkt für die späteren Denkstrukturen darstellt.
III.2.2. Die präoperationale Stufe
Vom 2. bis 7. Lebensjahr durchläuft ein Kind in der Regel die präoperationale Stufe. Der
zentrale Prozess dieser Stufe ist die Entwicklung der Symbolfunktion (vgl. Buggle, S.49, S.
64ff.). Sie ermöglicht ihm, nun auch nicht unmittelbar präsente oder wahrzunehmende Dinge in
sein Handeln einzubeziehen, indem es sie durch ein Symbol eine symbolische Vorstellung, ein
Wort oder einen Gegenstand repräsentiert. Piaget erklärt diese Abstraktionsleistung als eine
Verinnerlichung von Verhaltensschemata, mit der sich das Kind ein Stück weit vom Hier und
Jetzt befreit (vgl. Ginsburg/Opper, S.95, S.110): es kann Aktionen wiederholen oder zukünftige
planen, diese Pläne sprachlich äußern
16
, und es entwickelt nicht zuletzt eine lebhafte Phantasie,
die sich z.B. im Spiel äußert.
17
Damit jedoch ,,sieht sich das Kleinkind nicht mehr wie zuvor bloß
dem physischen Universum, sondern zwei neuen und übrigens eng verknüpften Welten
gegenüber: der sozialen Welt und der Vorstellungswelt." (Piaget, 1999, S.165) Die
Differenzierung zwischen diesen beiden Welten und die erforderliche Akkomodation an die
Erwartungen der sozialen Welt stellen das Kleinkind vor neue Probleme
18
, die es zwingen, eine
fortschreitende Dezentrierung und eine ,,auf neuen Ebenen verlaufende partielle Wiederholung
der bereits vom Säugling auf der elementaren Stufe der praktischen Anpassungsvorgänge
15
Daher zeigt das Kind noch kein ,,Denken und keine Affektivität [...], die mit Vorstellungen verbunden wäre, durch
die es Personen oder Gegenstände in ihrer Abwesenheit bezeichnen könnte" (Inhelder/Piaget, S.15, vgl. auch S.32).
16
Dabei fördert der Erwerb und der Gebrauch der Sprache die Kerneigenschaften des kindlichen symbolisch-
voroperationalen Denkens besonders (vgl. Buggle, S. 67; Piaget, 1999, S.163).
17
Laut Piaget überwiegt im Spiel grundsätzlich die ,,verzerrende Assimilation des Realen an das eigene Ich"
(Piaget, 1999, S.170). Mit der Zeit verwandeln sich jedoch die Kleinkinderspiele ,,durch ihre eigene innere
Entwicklung nach und nach in umweltangepasste Wesenheiten, die immer mehr echte Arbeit erfordern" (ebd.,
S.130). Um ein Gleichgewicht zwischen Assimilation und Akkomodation herzustellen, braucht ,,dauernde
spielerische Übung" (ebd., S.131), womit das Spiel eine Funktion erfüllt, die über eine bloße ,,Abreaktion
überschüssiger Energien" (ebd., S.128) hinausgeht, wie es die herkömmliche Pädagogik deutete. Für Piaget ist das
Spiel ,,die ursprüngliche Aktivitätsform fast jeder Fähigkeit oder zumindest eine funktionelle Übung" (ebd., S.170),
womit er sich auch auf Karl Groos bezieht (vgl. ebd., S.123)
18
Beispielsweise versucht das Kind in diesem Stadium oft ,,durch seine Schlussfolgerungen bestimmte Ziele zu
erreichen, aber sein Denken verzerrt die Wirklichkeit entsprechend seinen Wünschen." (Ginsburg/Opper, S.109)
12
durchgemachten Entwicklung" (ebd.) zu vollziehen. Es entwickelt dabei eine Vielzahl von oft
widersprüchlichen Erklärungsmustern für die unterschiedlichsten Problemstellungen.
19
Logisches Schlussfolgern ist auf dieser Stufe noch nicht möglich, da es den Denkstrukturen noch
an Reversibilität und damit verbunden einem elementaren Erhaltungs- bzw.
Gleichheitsbegriff
20
fehlt (vgl. Inhelder/Piaget, S.33). Das zeigt sich beispielhaft am
Wasserglasexperiment: wird das in einem niedrigen, flachen Glas enthaltene Wasser in ein
höheres, schmaleres Glas umgeschüttet, so wird ein Kind auf der präoperationalen Stufe in der
Regel behaupten, die Wassermenge habe dabei zugenommen, und hierbei auf den gestiegenen
Wasserspiegel verweisen. Hier wird deutlich, dass seine Wahrnehmung auf einen Aspekt der
Realität zentriert ist den höheren Wasserstand , der nicht mit den anderen relevanten
Aspekten der schmaleren Form des Glases koordiniert wird (vgl. Ginsburg/Opper, S.146).
Doch auch wenn die Kinder bei derartigen Experimenten nur selten sinnvolle Erklärungen
abgeben können, sind sie schon imstande, Phänomene vorauszuahnen. Diese Intuition bezeichnet
Piaget als die dem Realen angepassteste Form des Denkens auf der präoperationalen Stufe (vgl.
Piaget, 1999, S.134, S.170). Die Intuition stellt die Grundlage für die Entwicklung der
Operationen und damit für den Übergang auf die folgenden Stufen dar. Für diesen Übergang
fehlt nur noch, ,,dass das bereits bekannte Handeln des Individuums in beiden Richtungen
19
Piaget beobachtet auf dieser Stufe strukturell verschiedene parallel existierende Erklärungsmuster für
physikalische Fragestellungen, die er als animistisch, artifizialistisch, finalistisch oder realistisch bezeichnet, womit
er diese mit den Erklärungsansätzen sogenannter ,,primitiver" Kulturen in Beziehung setzt, denen sie in vieler
Hinsicht gleichen: So wird etwa den Gegenständen ein Bewusstsein (Animismus) oder ein mit subjektivem Sinn
gesetztes Ziel (Finalismus) zugeschrieben (vgl. Piaget, 1999, S.170ff.) oder es wird davon ausgegangen, sie seien
von einem Schöpfer nach menschlichen Herstellungsprinzipien gemacht (Artifizialismus) (vgl. ebd., S.174), oder
Namen werden materiell den Dingen zugeordnet (Realismus) (vgl. Inhelder/Piaget, S.111). Dies kann als ein
Hinweis auf die Gültigkeit der These, dass Phylo- und Ontogenese nach den gleichen Gesetzmäßigkeiten verlaufen,
gesehen werden (vgl. Piaget, 1999, S.174). Der Realismus in moralischer Hinsicht äußert sich, wenn Kinder in
einem bestimmten Stadium davon ausgehen, dass eine Lüge um so schlimmer ist, je realitätsferner sie ist hingegen
wird die der Lüge zugrundeliegende Absicht oder ihre Konsequenzen für die Bewertung nicht in Betracht gezogen
(vgl. Inhelder/Piaget, S.124ff.)
20
Dem Aspekt der Reversibilität des Denkens hat Piaget besonders hohe Bedeutung beigemessen. Er fasst ihn als
einen Indikator für den erfolgten Übergang zur konkretoperationalen Stufe. Als weiteren Indikator dafür führt er die
Einsicht in das Prinzip der Mengenerhaltung, d.h. das Vorhandensein eines Erhaltungsbegriffes an (vgl. Kesselring,
S.143ff., S.157). Letzterer leitet sich laut Piaget interessanterweise aus der Reversibilität ab, nicht aus der Identität
(vgl. Piaget, 1999, S.190). Erhaltung setzt eine Quantifizierung voraus, während Identität zunächst qualitativ
bestimmt ist. Laut Piaget gibt es ,,wohl kaum etwas Variableres [...] als den Begriff der Identität, der im Verlauf der
intellektuellen Entwicklung des Kindes keineswegs derselbe bleibt." (Piaget, 1973a, S.63) Schon auf der senso-
motorischen Stufe ist ein gewisser Begriff von Identität gegeben, ,,wenn das Kind erkennt, dass ein Objekt eine
bestimmte Konstanz besitzt" (ebd.). Ähnlich das präoperationale Kind: es wird beim Wasserglas-Experiment u.U.
zugeben, dass das Wasser dasselbe geblieben sei, dass man nichts hinzugetan und nichts weggenommen habe -
dennoch habe sich die Menge verändert (vgl. Piaget, 1999, S.190). Der Identitätsbegriff der konkretoperationalen
Stufen ergebe sich nun implizit oder explizit aus der Reversibilität (vgl. Inhelder/Piaget, S.103, Fußnote). Während
das Kind also auf einer früheren Stufe glaubt, ,,dass Objekte in dem Maß identisch sind, in dem man dasselbe mit
ihnen tun kann." (Piaget, 1973a, S.64) gewinnt die Identität auf der konkretoperationalen Stufe einen quantitativen
Charakter, indem die Einsicht, dass man dem Wasser nichts hinzugefügt und nichts weggenommen habe, mit der
Einsicht der Reversibilität der Handlung koordiniert wird (vgl. Kesselring, S.146). Laut Piaget gewinnen die Kinder
zuerst die Erkenntnis der Erhaltung eines Stoffs, später dann seines Gewichts, und zuletzt die seines Volumens (vgl.
Piaget, 1999, S.189, S. 194).
13
fortgesetzt wird, dass es mobil und reversibel wird." (ebd., S.178) Diese Voraussetzungen sind
als ,,Anfänge von Antizipation und Rekonstruktion" (ebd.) bereits in der gegliederten Intuition
angelegt.
21
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass für Piaget die präoperationale Phase den Beginn des
eigentlichen Denkens darstellt, eines Denkens jedoch, das immer noch einem Handeln in der
Vorstellung gleicht denn präoperationale Denkschemata sind im wesentlichen verinnerlichte
senso-motorische Verhaltensschemata (vgl. ebd., S.169), und lassen daher keine
Vorstellungstätigkeit zweiter Ordnung zu.
22
III.2.3. Die konkretoperationale Stufe
III.2.3.1. Kognitive Aspekte
Bei dem eben erwähnten Wasserglasexperiment beobachtete Piaget bei Kindern auf der
konkretoperationalen Stufe, also zwischen 7 und 11 Jahren, eine sehr viel logischere
Schlussfolgerung und Argumentation: in der Regel antworteten sie, die Wassermenge habe sich
nicht erhöht, und führten dazu mindestens einen der folgenden Beweise an: es sei dasselbe
Wasser, man habe nichts hinzugetan und nichts weggenommen; man könne das Wasser einfach
zurückgießen; das zweite Glas sei zwar höher, aber auch dünner als das erste (vgl.
Inhelder/Piaget, S.102; Kesselring, S.140). Anhand dieser Argumente lässt sich verdeutlichen,
was Operationen i.S. Piagets im Wesentlichen sind:
,,Piaget definierte Operationen als verinnerlichte (,interiorisierte'), umkehrbare (,reversible') Handlungen, die
miteinander zu einem System koordiniert sind." (Kesselring, S.142)
Mit dem Begriff der Verinnerlichung wird auf die zunehmende Fähigkeit des Kindes verwiesen,
Handlungen in Gedanken mit den jeweiligen Objekten zu vollziehen. Das Denken ist dabei nicht
mehr nur auf die unmittelbaren wahrnehmbaren Zustände zentriert, sondern kann auch
21
Piaget unterscheidet hier zwischen der primären und der gegliederten oder artikulierten Intuition. Erstere ist
demnach ,,lediglich ein in den Denkakt transponiertes sensomotorisches Schema, dessen Merkmale sie natürlich
übernimmt" (Piaget, 1999, S.178). Die gegliederte Intuition geht darüber hinaus, indem sie die Folgen der Aktionen
antizipiert und die vergangenen Zustände rekonstruiert (vgl. ebd.).
22
Zur Veranschaulichung bietet sich ein Experiment, in dem präoperationale Kinder mit einem Problem der
Inklusion konfrontiert wurden (vgl. Kesselring, S.133ff.): Sie sollten bei einer Menge Holzperlen davon die
Mehrzahl braun, einige wenige weiß angeben, ob man mit den Holzperlen oder mit den braunen Perlen eine
längeres Halsband machen könne. Die Kinder hatten verstanden, dass alle der Perlen aus Holz waren, antworteten
aber trotzdem, mit den braunen könne man ein längeres Band machen, da diese mehr als die dann übrigbleibenden
weißen seien. Das Problem verlangte von Kindern, sich zwei Perlenketten nebeneinander vorzustellen, um sie
vergleichen zu können. Dieser Vergleich ist als eine konkrete Handlung jedoch nicht möglich: sind die braunen
Perlen einmal in ein Halsband eingereiht kann man sie nicht noch einmal an anderer Stelle verwenden bzw. wenn
das Kind ,,an den Teil A denkt, bleibt B nicht mehr als Einheit erhalten, und der Teil A ist dann nur noch
vergleichbar mit dem komplementären Teil A'[...]. Diese Einschachtelung gelingt mit ungefähr 8 Jahren und
kennzeichnet dann die operative Klassifizierung. " (Inhelder/Piaget, S.106)
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Erstausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2001
- ISBN (Paperback)
- 9783958203952
- ISBN (eBook)
- 9783958208957
- Dateigröße
- 3.4 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
- Erscheinungsdatum
- 2015 (Oktober)
- Note
- 1
- Schlagworte
- jean piagets stufenmodell entwicklung überlegungen bedeutung unterrichtspraxis
- Produktsicherheit
- BACHELOR + MASTER Publishing